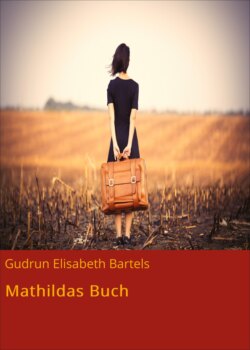Читать книгу Mathildas Buch - Gudrun Elisabeth Bartels - Страница 5
Marissa
ОглавлениеDas reetgedeckte niedrige Haus duckte sich hinter den Dünen vor dem Wind der See zusammen. Im Laufe der langen Jahre, die es hier schon kauerte, war es alt und grau geworden, hatte Falten und Furchen. Die Fenster waren blind geworden von der salzigen Gischt, die immer wieder bei kräftigem Wind und Sturm dagegen peitschte.
Der Hauseingang wurde von einem Vordach geschützt. Ein kleiner, schmaler grob gepflasterter Weg führte den Ankömmling zur Türe, an der die Jahre ebenfalls nicht spurlos vorüber gegangen waren. Das Holz war grau und porös, die Angeln rostig. Aber die massive Konstruktion hielt bisher allen Wettereinbrüchen stand.
Neben der Tür blickten rechts und links die beiden kleinen Fenster jedem Besucher freundlich entgegen. So freundlich wie jeder empfangen wurde, der den schweren, goldenen Türklopfer betätigte. Diesen hatte ein Vorfahr des letzten Eigentümers von einer seiner abenteuerlichen Reisen mitgebracht. Er war höchst kunstvoll geschmiedet und hielt jeden, der ihn berührte, erst einmal zum staunenden Betrachten an.
In der Tat war es eher ein Schmuckstück denn ein Gebrauchsgegenstand, den man da in der Hand hielt. Ein goldener Reif, kunstvoll geschmiedeter ineinander verflochtener Stränge, die sich wie ein Gitter verwoben. Geschmückt mit bunten, großen, gläsernen Steinen, die – wenn die Sonne darauf fiel – in großartigen Kaskaden funkelten und Lichtersträuße auf Tür und Eingang zauberten. Vielleicht waren es wertvolle Edelsteine. Vielleicht nur billiges Glas. Niemand hatte sich bisher die Mühe gemacht, das zu erforschen. Aber das war auch nicht wichtig. Wichtig waren nur die Freude, die der Anblick in Jedem auslöste und ein Gefühl von Glück.
Als Marissa durch die Dünen kam und die steinige Wegpflasterung zum Haus hinunterging, spürte sie sogleich dieses wundersame Glücksgefühl, das ihr entgegenwehte wie schon der Wind am Strand, über den sie zuvor hierher gestapft war. Sanft und leicht wie eine streichelnde Hand. Und das Licht hinter den milchigen Fenstern strahlte zu ihr wie eine Ermunterung. Das genügte um ihr den sonst schon dunklen Weg zu erhellen und sie sicher bis zur Haustüre zu führen.
Dort angekommen strich sie über die kunstvollen Verzierungen des Türklopfers, hob ihn an und ließ ihn gegen die Holztür fallen. Nur ganz leicht. Sie wartete nicht, bis ihr geöffnet wurde. Sie wusste, sie wurde erwartet.
Lange war sie nicht hier gewesen, doch sobald sie die Schwelle überschritten hatte, war alles wieder da. Die Vertrautheit, die Wärme, die Geborgenheit.
Gerade die Wärme tat ihr augenblicklich überaus wohl. Ihre Haare und Kleidungsstücke klebten ihr verschwitzt am Körper und sie schmeckte Salz auf ihren Lippen. Sie war sehr müde. Sie sehnte sich nach einem weichem Bett, einer warmen dicken Decke, in die sie sich kuscheln konnte, eintauchen in tiefe Traumwelten weit ab von der Wirklichkeit.
Sobald sich ihre Augen an die dämmrige Helle des Raumes gewöhnt hatten, nahm sie immer mehr die altvertrauten Gegenstände war. Den Kamin, in dem an Winterabenden ein wohliges Feuer brannte, jetzt aber dunkel vor sich hin schlief, der alte Lehnstuhl davor, auf dem noch immer die alte bunte Flickendecke lag, die die Großmutter vor langer Zeit in liebevoller Handarbeit selber hergestellt hatte und dem Großvater viele Jahre die alten, müden Beine wärmte.
Auf dem kleinen, runden Holztisch lagen Stapel von Büchern, gelesenen und ungelesenen. Daneben standen Becher und Teekanne für den sofortigen Gebrauch. Auf dem Kaminsims lehnten Schwarz-Weiß-Fotos alter Verwandter und - wie ein Fremdkörper - eine Fotografie aufgenommen in modernster Digitaltechnik. Marissa musste nicht näher gehen um zu sehen, wer darauf abgebildet war. Vielmehr ließ sie ihren Blick rasch darüber hinweggleiten, hin zu dem Schrank mit den Glastüren, hinter denen sich Schätze aus aller Welt befanden. Krüge, Gläser, Steine, Becher aus Gold, verzierte Teller und Gefäße. Errungenschaften von den weiten Reisen des alten Seefahrers, dem das Haus einst gehörte und mit dem Inventar von seinen Erben an die neuen Eigentümer verkauft worden war. Marissa fand sie wunderschön. Sie öffnete eine der Türen des Schrankes und nahm zielgerichtet ein kleines, wundersam filigranes hölzernes Schmuckkästchen heraus, welches es ihr schon als Kind angetan hatte und das sich auf besondere Weise von den anderen Sätzen unterschied, so als ob es nicht dazugehörte. Der Deckel war geschmückt mit einer kunstvoll geschnitzten Rose, die sich von oben herab um das ganze Kästchen rankte. Vorsichtig strich Marissa über die Blütenblätter, die Stile, spürte sacht die kleinen Stacheln und meinte den feinen Duft der Rose zu riechen als sie ihre Nase daranhielt. Immer wenn sie früher das Kästchen in der Hand gehalten hatte, war die Neugierde groß gewesen zu erforschen, was es wohl enthielt, aber der Deckel war verschlossen. Einen Schlüssel gab es nicht und sie hatte sich nie getraut, den versteckten Verschlussmechanismus zu erforschen. Auch niemand sonst hatte bisher scheinbar das Bedürfnis gehabt, an das Innere zu gelangen. Irgendwie gehörte dieses Geheimnis zu dem Kunstwerk und machte es wohlmöglich noch bedeutsamer.
Sie lächelte leicht als sie es zurück an seinen Platz stellte und die Schranktür schloss.
„Da bist du ja.“ Die Stimme hinter ihr klang rau und etwas heiser.
Marissa drehte sich um und sah sich von den Augen der kleinen Frau vor sich eingenommen. Klein war sie immer gewesen, aber jetzt kam es ihr vor, als hätte sie sich nochmal mehr ein Stück in sich zusammengezogen.
„Oma“. Vorsichtig trat sie zu ihr und umarmte sie leicht wie ein zerbrechliches Gut.
„Issa…“ Die warme Hand der alten Frau legte sich auf die junge Wange der Enkelin. „Wie schön.“ Dann bemerkte sie das leichte Zittern, das Marissa durchlief, sah auf ihre nackten Füße.
„Was ist passiert – wo sind deine Schuhe?“
„Ach, die habe ich irgendwo am Strand liegengelassen und meinen Rucksack auch. Ich musste doch gleich zum Meer. Jetzt bin ich müde und mir ist kalt.“
Die Großmutter nickte: „Geh nach oben in dein Zimmer. Nimm dir Handtücher und ein paar Sachen aus dem Schrank. Ich koche derweil einen Tee.“
Marissa küsste die faltige Wange der Großmutter und stieg dann die enge Holztreppe hinauf. Im oberen Stockwerk war es nahezu dunkel und nicht so warm wie unten. Der Flur kam ihr sehr niedrig vor. Die Kammer links war das Zimmer ihrer Großmutter. Das große Bett war für zwei bezogen aber nur eine Decke war zurückgeschlagen. Auf dem Nachttisch neben der unbenutzten Seite stand ein Bild mit einem großen, stämmigen, gutaussehenden Mann, der auch trotz seines weißen Haupthaares und den tiefen Stirnfurchen, bubenhaft frech aus den Augen blickte. Marissa grinste kurz als sie dem Blick des Großvaters begegnete. Er war immer ein großer Junge gewesen, bis zum Schluss und hatte mit ihr, der jungenhaften Enkeltochter viele, wilde Abenteuer durchlebt.
Das Zimmer gegenüber war immer ihres gewesen. Sie liebte das schmale Bett, das sich unter die Dachschrägen zwängte und den Blick durch die Dachluke mit Sicht auf den Himmel. Der wackelige Tisch, der alte Korbstuhl, das Regal mit den abgegriffenen, zerlesenen Büchern ihrer Kinderzeit.
Im Schrank fand sie Handtücher, rubbelte sich die verschwitzen kurzen Haare trocken und schälte sich aus dem unangenehm klebrigen Kleidern.
Der dicke, blaue Pullover mit den weißen Streifen roch nach Vergangenheit als sie ihn überstreifte und die selbstgestickten Strümpfe kratzen angenehm an den nackten, kalten Füße. Das Bett war bezogen. Auf dem Kopfkissen lag wie immer ein Säckchen mit Lavendel. Marissa nahm es in die Hand, roch daran und sank hinein in die Weichheit der Daunenfedern.
Als die Großmutter mit einer Tasse Tee ins Zimmer kam, schlief sie bereits.
*
Da war eine wohlige Wärme an ihren Füßen und eine schmeichelnde Bewegung. Noch halb im Schlaf nahm sie wahr, wie da etwas unter ihre Bettdecke zu kommen versuchte. Es dauerte eine Weile bis sie sich erinnerte, wo sie war, in welchem Bett sie lag und wer sie gerne früh morgens besuchte, wenn sie hier war.
„Teo…“ Sie richtete sich halb auf, griff suchend mit der Hand an das Fußende des Bettes. „…komm her, mein Süßer.“ Eine warme, feuchte Nase berührte vorsichtig ihre Finger, bevor eine kleine Zunge anfing, daran zu lecken und spitze Zähne ein wenig ihre Haut berührten.
Jetzt setzte sich Marissa gänzlich auf und umfing das Fell des alten Katers, der kaum Halt auf dem weichen Bettzeug fand. „Wie geht es dir, alter Freund?“ Sie kraulte ihm liebevoll den Hals und sogleich schnurrte das Tier zufrieden. Sie nahm ihn auf den Schoß und sah ihn aufmerksam in die grünen Katzenaugen. Sein ehemals dickes, schwarzes Fell war merklich ausgedünnt und wies einige kahle Stellen auf.
„…wirst auch nicht jünger, was?“ sprach sie zu ihm und merkte, dass sie diese Tatsache genauso berührte wie das Erkennen des Altersprozesses bei ihrer Großmutter. Und sie selber - sie wurde auch jedes Jahr älter, ohne dass sie etwas daran ändern konnte. Noch war sie jung genug, das nicht so wichtig zu nehmen aber hin und wieder ertappte sie sich dabei, wie sie darüber ins Grübeln geriet. In letzter Zeit verstärkt und ohne einen für sie erkennbaren Grund.
Durch das schräge Dachfenster blinzelte die Sonne zu ihr und den schwarz-grauen Kater in ihrem Arm. Es sah aus als würde es ein schöner Tag werden.
„Komm, Teo – auf nach draußen.“ Der Kater sprang noch recht behende vom Bett als Marissa die Decken zurückschlug und aufstand.
Sie hörte ihre Großmutter bereits unten in der Küche werkeln. Die alte Dame stand stets vor sechs Uhr auf und blickte ihrer Enkelin munter entgegen.
„Gut geschlafen?“ wollte sie wissen.
„Und wie…“ Marissa reckte ihre Arme hoch über den Kopf. „ - himmlisch, wie immer hier.“
„Möchtest du draußen frühstücken? Auf der Terrasse ist es schon warm.“
Noch bekleidet mit ihrem dicken Wollpullover und den Socken lief Marissa durch die Küche hinaus ins Freie. Die Sonne strahlte ihr sogleich hell ins Gesicht und ließ sie die Augen schließen. Als sie diese wieder öffnete, blickte sie auf das blühende Prachtmeer aus Blumen, Sträuchern und Gräsern, Kräutern, Obstbäumen und Gemüsebeete, das wie eine Naturorgie den Garten hinterm Haus vereinnahmte. Lediglich die kleine Terrasse ließ Platz zum Niedersetzen auf der alten Holzbank mit dem selbstgezimmerten Tisch. Auf diesem stand bereits alles für ein ausgiebiges Frühstück bereit.
Marissa ertappte sich dabei, wie sie gleichsam wie der Kater anfing zu schnurren vor lauter Wohlbefinden. Das war das Paradies.
Ihre Großmutter kam mit der dicken, geblümten Teekanne aus der Küche und lachte. „Meine kleine Katze. Setz dich und lass es dir schmecken.“
Marissa zog die Socken aus, krempelte die Ärmel des Pullovers hoch und ließ sich mit allen Sinnen in diesen Sonnenmorgen gleiten.
*
Und dann - das Meer.
Eine Stunde später lief sie barfuß in dem alten Kleid, das sie im Schrank ihrer Großmutter hatte hängen sehen, hinunter zum Strand. Aus einem Impuls heraus hatte sie sich das augenscheinlich selbstgenähte Kleidungsstück übergeworfen. Es war aus leichtem Stoff, altmodisch mit großen Blumenmuster bedruckt und ihr viel zu weit, aber es schmiegte sich angenehm weich an ihre Haut und flatterte jetzt luftig um ihrem Körper als sie über den Sandstrand lief.
Das Meer rauschte in einiger Entfernung gemäßigt vor sich hin, zog sich mit der Ebbe immer mehr vom Land zurück und ließ den Wattboden mit seiner einzigartigen Welt sichtbar werden. Marissa konnte es kaum erwarten, ihre Füße im Schlick zu versenken und durch die Priele zu waten. Aber erstmal musste sie ihren Rucksack finden, den sie gestern irgendwo am Rande des Strandes hatte fallen lassen als sie ihre Schuhe und Strümpfe auszog, um über den noch warmen Sand zu laufen. Das war ihr erster Gang gewesen. Gleich nachdem sie die Fähre verlassen hatte, war sie hierhergekommen. Zu ihrem Strand. Zu ihrem Meer. Die Abendsonne war schon dabei gewesen, einzutauchen in das Wellenmeer, dessen Schaumkronen rötlich schimmerten.
War das tatsächlich erst gestern gewesen? Nach der schier endlosen Reise durch ganz Deutschland schien es ihr schon wie eine Ewigkeit her, dass sie aufgebrochen war um sich hierher auf den Weg zu machen. Hierher in das Oasen-Paradies ihrer Kindheit, in dem sie sich sicher und aufgehoben fühlte.
Sie spürte bereits wie sie hier freier atmete, sich ihre Muskeln entspannten, ihre Seele anfing Flügel zu bekommen. Die noch junge Morgensonne glitzerte auf dem fernen Wasser, nur wenige feine Federwolken durchzogen den blauen Himmel.
Außer dem Meeresrauschen war nichts zu hören. Noch waren keine Menschen am Strand, bis zu dieser entfernten Stelle verirrte sich kaum Jemand, der sich in der Gegend nicht auskannte. Ein stilles Fleckchen Erde abseits der lauten Welt. Genau der Ort, wo sie jetzt sein wollte.
Ihr Rucksack wartete auf sie. Ihre Schuhe und Strümpfe waren voller Sand und feucht von der Nacht. Sie schlug sie aus, setzte sich den Rucksack auf und lief mit den Schuhen in der Hand Richtung Wasser. Endlich versanken ihre Zehen in dem matschigen Wellenboden. Genüsslich suhlte sie diese darin und freute sich, wenn es ein schmatzendes Geräusch gab, sobald sie den Fuß wieder herauszog. Ein kleiner Krebs kam ihrem großen Zeh bedrohlich nahe. Marissa stieg leicht über ihn hinweg, wich so gut es ging einem Haufen Wattwürmer aus.
Liebend gerne wäre sie stundenlang so weiter durch das Watt gezogen, aber der Rucksack drückte ihr unangenehm auf den Schultern und die Schuhe in der Hand schränkten ihre Bewegungsfreiheit zusätzlich ein. Sie lenkte ihre Schritte Richtung Strand, hob eine große weiße Muschel auf und stapfte durch ihr Gepäck beschwert durch den Sand zurück.
Wenn sie die Sachen im Haus abgeladen hatte, würde sie wiederkommen.
Sie hatte vor, die Zeit, die sie hier sein würde, fast gänzlich am Strand zu verbringen, das Meer zu beschauen, den Himmel zu sehen, die Sonne zu spüren. Wind zu schmecken und Wasser zu riechen. Sich fallen zulassen und in sich zu horchen, sich selbst zu begegnen und Klarheit zu finden. Bilder, Gedanken und Ideen. Oder auch nur die Stille und Ruhe des Augenblicks.
Ohne Zwang, ohne Druck, ohne Ziele. Und dann – wer wusste schon, was kommen würde. Sie wollte Vertrauen gewinnen, Zuversicht und Glauben. An sich, an das Leben.
Die Sachen in ihrem Rucksack waren allesamt zerknüllt, sauber zwar aber ohne Sorgfalt hineingestopft, wahllos auch und ohne Überlegung. Ihr Aufbruch war recht überstürzt geschehen und hatte ihr nicht viel Zeit zum ausgiebigen Planen gegeben. Doch ihr Lieblingskleid mit den schmalen, fliederfarbenen Streifen fand sich inmitten des Kleiderknäuels und Marissa tauschte es sofort gegen das Blumengewand der Großmutter aus. Gleich fühlte sie sich mehr als sie selbst.
Das altmodische Kleidungsstück hatte ihr gleichsam ein Stück Vergangenheit angezogen, in der sie sich irgendwie unwohl fühlte. Als ob an dem Stoff etwas haftete, das sie in einen Strudel von gestrigem Geschehen ziehen wollte. Erst hatte sich alles so weich und luftig angefühlt und als sie über den Strand gelaufen war, war es gewesen als könne sie gleich davonfliegen. Aber hinter dieser Leichtigkeit war auch etwas Dunkles, Schweres zu spüren, was sie frösteln ließ.
Jetzt wo sie ihr eigenes Kleid anhatte und das alte neben ihr auf dem Boden lag, merkte sie den Unterschied. Irritiert nahm sie dieses in die Hand, befühlte es, drehte es hin und her als erwarte sie, etwas zu entdecken. Aber da war nichts. Es war nur ein Kleid.
Sie schüttelte den Kopf, nahm einen Bügel aus dem Schrank und hängte das Kleidungsstück hinein. Dann sortierte und faltete sie oberflächlich ihre mitgebrachten Sachen, legte sie ebenfalls in den Schrank, verstaute unten den Rucksack. Dann lief sie die Treppe hinunter in die Küche. Sie hatte es plötzlich ganz eilig. Die Großmutter erwartete sie schon, hielt ihr einen Beutel entgegen und meinte: “Du willst doch sicher den Tag am Strand verbringen. Ich hab dir etwas Proviant zusammengepackt.“
Marissa nahm den Beutel und drückte die Großmutter an sich. „Du bist lieb, Oma. Ist es dir denn recht, wenn ich dich einfach so alleine lasse?“
Die warme Hand der Großmutter legte sich liebevoll auf die Wange der Enkelin.
„Ich bin es gewöhnt, allein zu sein. Wenn du später wiederkommst, freue ich mich auf eine nette Unterhaltung. Genieß die Sonne und lass Gedanken, Gedanken sein.“ „Danke, Oma“. Marissa küsste sie leicht auf die Wange. Der lächelnde Blick der alten Dame begleitete sie über den Pfad hin zum Strand.
*
Die Morgensonne war von der Terrasse weggewandert über die Beete und Gewächse, hin zu den Heckenrosen, wo es von Insekten summte.
Von ihrem Platz auf der Bank, die nun angenehm im Schatten lag, genoss die alte Dame den prachtvollen Anblick ihres wilden Gartens. Er war ihre Freude und angenehme Beschäftigung, die ihr allerdings zunehmend schwerer fiel, was sie aber kaum zugegeben hätte. Manchmal ging es recht langsam voran mit Jäten, Unkrautzupfen, Schneiden und Pflücken. Doch die Pflanzen schienen es dieser Langsamkeit zu danken, indem sie üppig wuchsen und gediehen ohne mangelnde Pflege gleich mit Welken oder Verdorren zu beantworten. Als ob sie damit zufrieden waren, überhaupt da zu sein und ihrer Gärtnerin Lebensfreude zu schenken.
Der Garten und das alte Haus waren es, was ihr geblieben war. Vieles hatte sich im Laufe der vergangenen Jahre verändert, Menschen waren aus ihrem Leben verschwunden, die ihr viel bedeutet hatten, Umstände und Lebenssituationen waren andere geworden.
War es Schicksal oder Vorsehung, was alles so kommen ließ wie es kam? Emilia dachte kaum mehr darüber nach, nahm jeden Tag wie er war, ließ geschehen, was geschah. War zufrieden mit dem, was sie hatte und lebte jeden Augenblick als einmalig und einzigartig. Das machte sie zu einem zufriedenen, dankbaren Menschen. Wenn sie ein Wort für ihr jetziges Leben verwenden sollte, konnte ihr nur das Wort „Glück“ über die Lippen kommen.
Der Weg hin zum „Glück“ war lang gewesen, hatte ihr viel abverlangt und sie manchmal daran zweifeln lassen, dass sie ein Gefühl von Glück jemals erleben würde. Alt musste sie werden, um es zu erreichen und um zu erkennen, dass ihr das Glück trotz allem Unglück, das sie überstehen musste, immer zur Seite gestanden und über alle Widrigkeiten hinweggetragen hatte.
Jetzt wünschte sie sich nur noch, dieses Wissen um das Glück weiterzugeben an die, die es gerade nicht spüren konnten, die meinten, es wäre von ihnen gewichen. Sie wünschte, sie könnte es irgendwie verpacken und wie ein Geschenk vor sie stellen, damit sie es sahen und annahmen.
Zu allererst hätte sie es am liebsten ihrer Tochter Juliane überreicht, die es, wie sie fand, am nötigsten hatte. Aber sie wusste, sie würde dieses Geschenkglück nicht sehen, auch wenn es ganz nah vor ihr schweben würde. Sie würde einfach daran vorbeilaufen, blind und eilig.
Aber Marissa, ihre Enkelin mit dem jugendlichen Lebenssinn, die würde es wohl sehen. Bei ihr würde sie leichter Erfolg haben damit, ihr zu zeigen, dass trotz all dem schmerzvollen Leid, das ihr schon begegnet war, auch eine Helligkeit daneben stand. Und dann – so hoffte Emilia, würde dieses Erkennen auch die Augen ihrer Tochter öffnen. Ihre Augen – und ihr Herz. Es konnte nicht sein, dass sie sich dem Leben entzog. Und sich und die Tochter vergaß. Die Tochter, die noch da war und so viel Leben vor sich hatte.
Emilia hatte im Gesicht ihrer Enkelin eine große Menge an Lust und Freude gesehen als sie zum Strand gelaufen war. Schnell. Leicht. Da war nichts gewesen von dem Schatten, der manchmal um sie strich. Und das hatte Emilia aufatmen lassen. Es würde alles gut werden. Trotz dem Traurig-sein von gestern.
Schicksalhafte Wendungen gab es immer, würde es immer geben. Man wusste nie, ob und wann das Leben sie für einen bereithielt. Wie konnte man jemals sicher sein, vorbereitet oder stark genug für Einschläge, die plötzlich und aus scheinbar heiterem Himmel neben einem explodierten.
Auch die Menschen, die vor über siebzig Jahren sorglos den Jahrhundertsommer genossen, waren nicht im Geringsten darauf vorbereitet gewesen, was in den nächsten Jahren auf sie zukommen würde – auch wenn es Vorzeichen für die Katastrophe gegeben hatte. Sie lebten ihr Leben, lachten, liebten, gingen ihrer Arbeit nach, fuhren in den Sommerurlaub voller herrlicher Sonne.
1939 war Emilia fünf Jahre alt. Ein kleines Mädchen, das gerade seine Welt und sich entdeckte. Was wusste sie von der Welt draußen, was dort geschah, was sich langsam aber sicher zusammenbraute, bis es am 1. September 1939 zu dem verheerenden Angriff Deutschlands auf Polen kam. Und dann rollte ein unvorstellbares Inferno über ganz Europa und die Welt, das noch bis zum heutigen Tag seines Gleichen sucht und allen nachfolgenden Generationen immer wieder das Entsetzen ins Gesicht und die Tränen in die Augen treibt.
Emilias Vater war Postbeamter in Berlin, ihre Mutter arbeitete stundenweise in einem Laden für Schreibwaren, der für Emilia ein kleines Paradies war mit den vielen Farben und Stiften, mit denen sie die großen Bogen Papier verschönern durfte, die ihr die Ladeninhaberin in die Ecke legte, wo Emilia bleiben konnte, wenn ihre Mutter arbeitete. Sie war ein braves, ruhiges Kind, das sich gut selbst beschäftigen konnte. Stundenlang malte sie eifrig an einem Kunstwerk, wobei ihre kleine Zunge genauso eifrig von einem Mundwinkel zum anderen wanderte. Oder sie blätterte in bunten Büchern mit vielen Bildern und erzählte sich ihre eigenen Geschichten dazu.
Manchmal sang sie auch mit kräftiger, ausdrucksstarker Stimme, die jeden Zuhörer sogleich in den Bann zog. „Das Kind hat aber eine Stimme“, bemerkte wohl ein Kunde, der im Laden Briefpapier kaufte. Und Emilias Mutter nickte voller Stolz. Heimlich dachte sie bei sich: vielleicht wird sie mal eine große Sängerin. Wer konnte das schon wissen. Wer konnte schon wissen, was in den nächsten Jahren alles geschah. Welche Welten und Träume zusammenbrachen, welche Leben, kaum gelebt, wieder endeten, welche Städte zu Ruinen wurden.
Dieser Krieg. Immer wieder sehr präsent – gerade jetzt - durch den nahenden Jahrestag, die Berichterstattungen im Fernsehen, Dokumentation, Gedenkfeiern, Ansprachen, Umarmungen früherer Feinde und der besorgte Blick gen Osten, wo sich Unheilvolles zusammenbraute.
Emilia war es kaum möglich, die Bilder und Kommentare zu verfolgen. Doch ganz konnte sie sich diesen nicht entziehen. In ihr war sofort alles wund und schmerzend sobald sie nur den Ton des Fliegeralarms vernahm oder das Geräusch der sich im Anflug befindenden Maschinen….
Hier bei ihr war es friedlich und beschützt. Traumumfangen ruhig.
Sie blickte hinüber auf das Fleckchen Rasen mit den Gänseblümchen, auf dem sich gerade eine Amsel niedergelassen hatte. Später zum Tagesende hin würde sie wieder ihr Abendlied singen. Laut und zwitschern, voller Koloraturen in den höchsten Tönen, die Emilia sehr bewunderte. Niemals hatte sie es selber zu solcher Kunstfertigkeit geschafft, obwohl ihr Gesangstalent tatsächlich nicht unerheblich gewesen war, wie bereits im Kindesalter vermutet. Zur großen Gesangskarriere hatte es aber nicht gereicht. Wer wusste schon genau warum.
Aber sie bedauerte das nicht. Alles war letztlich für ihre Persönlichkeit so richtig gewesen, wie es gekommen war. Und schließlich hatte der Krieg das seinige dazugetan, eventuelle Träume und Wünsche verlöschen zu lassen.
Ein leiser Seufzer stieg in ihr auf. Sie schluckte ihn hinunter ohne ihn weiter wahrzunehmen, gab sich einen Ruck und erhob sich etwas mühsam von der Bank. Sie würde jetzt eine Kleinigkeit essen und dann ihr Mittagsschläfchen halten. Dann würde sie noch ein wenig im Garten arbeiten, wenn es nicht zu heiß war und schließlich würde Marissa wiederkommen.
Marissa, die ihren Namen von Anfang an verkleinert hatte. Marissa kam ihr nie über die Lippen. Als kleines Mädchen brachte sie gerade mal „Issa“ zustande. Eine Marissa wie sie sich selber vorstellte, war sie nicht. Das klang nach exotischer Schönheit mit langen, schwarzen Haaren und tiefdunklen Augen. Sie hielt sich weder für eine Schönheit, noch besaß sie eine lange, schwarze Haarpracht. Allein die Augenfarbe mochte etwas mit dem Bild einer Marissa übereinstimmen. Sie waren zwar nicht tiefdunkel, doch von einem angenehm warmen braun-grünen Farbton, der mitunter zu wechseln schien. Abhängig von der jeweiligen Stimmungslage, in der sie sich gerade befand. Ihre Haarfarbe war eher dunkelblond und derzeit mit einigen rötlichen Strähnchen durchzogen. Emilia fand ihre Enkelin durchaus hübsch, auch wenn sie sich mit ihrer bunten Frisur nicht ganz anfreunden konnte. Aber so war die Jugend nun mal.
Was war es für eine Revolution gewesen als Emilia sich nach dem Krieg gegen den Willen des Vaters ihre langen Zöpfe abschneiden ließ und eines Tages mit einem Bubikopf zuhause erschien. Das Donnerwetter darüber hatte sie noch heute in den Ohren. Aber für sie war es ein Sieg gewesen, ein Triumph über die despotische Strenge des Vaters und die weiche Nachgiebigkeit der Mutter, die immer auszugleichen versuchte und gerade dadurch mitunter Missstimmung hervorrief. Dabei hatte sie es als Jüngste immer noch vergleichsweise gut gehabt. Ihr älterer Bruder Nikolas war den Launen des Vaters ungleich häufiger ausgesetzt und lieferte sich mit ihm heftige Wortgefechte, die das eine oder andere Mal beinahe ins Handgreifliche überzugehen drohten, wenn die Mutter sich nicht rechtzeitig zwischen die beiden Streithähne gestellt hätte.
Das war jetzt schon eine Ewigkeit her doch für Emilia waren die Bilder dieser Szenen noch sehr präsent genauso wie das Gefühl von damals. Nicht schön.
Sie schüttelte unwillkürlich den Kopf während sie sich eine Scheibe Brot hinunterschnitt und es dick mit Käse belegte. Schüttelte die Bilder weg in die Vergangenheit. Die Decke auf dem alten Sofa lud sie schmeichelnd ein, sich auszustrecken, die Augen zu schließen und für eine Weile Erinnerungen und Jetztzeit zu vergessen.
*
Marissa fühlte sich im siebten Himmel. Der Strand schien ihr allein zu gehören. Hierher ans äußerste Ende verirrten sich kaum ein paar Strandläufer. Hin und wieder kam ein Hund angejagt, der seinem Besitzer ausgerissen war, blieb vor ihr stehen, umkreiste sie misstrauisch und jagte schließlich weiter, wenn der Ruf seines Herrchens ertönte.
Aber das alles war keine wirkliche Störung für sie, die sie ausgestreckt auf dem großen Handtuch lag, das sie mitgenommen hatte. Da sie keinen Hut hatte, hatte sie sich kurzer Hand ihren langen, weißen, dünnen Schal, den sie fast ständig bei sich trug, um den Kopf gewunden, um sich vor der intensiven Sonneneinstrahlung zu schützen. Sie kam sich ein wenig vor wie eine Beduinenfrau und hätte gerne noch einen weiten Kaftan gehabt, denn Sonnencreme hatte sie keine und musste befürchten, dass sie sich mit ihrer hellen Haut, die schnell zu Rötungen neigte, einen Sonnenbrand einfing. Aber letztlich wollte sie daran nicht denken, überhaupt nicht denken – an nichts - nur das Hiersein genießen. Schon als sie gestern hier ankam, hatte sie sich sofort leichter gefühlt. In der Stadt hatte sie immer den Eindruck, eingezwängt zu sein. Die Enge der Häuser, die Straßen, die vielen Menschen und der ewige Verkehr nahmen ihr die Luft und Raum, frei zu atmen. Das merkte sie immer besonders, wenn sie davon ausbrach und wie jetzt die Freiheit des Alleinseins und die wohltuende Ausgeglichenheit der Natur spürte, die sich ausbreitete wie es ihr gefiel. Dann fragte sie sich, was sie in der Großstadt zu suchen hatte. Warum sie nicht am Meer war, auf der Insel, in der frischen Luft.
Das Studium und München waren schon in weite Ferne gerückt, nicht nur durch die räumliche Entfernung. Das alles war jetzt unwichtig.
Es war so schön hier. Im Sand, in der Sonne…
Sie ließ sich von all dem umhüllen, von der weit entfernten Brandung des Meeres einlullen… von dem Gesang der Möwen wegtragen…
…war es das Bellen eines Hundes? Das Rufen einer Stimme? Oder etwas aus ihrem Inneren, das sie hochschrecken ließ? Es kam so plötzlich, dass sie abrupt aufsprang.
Das kunstvoll zum Turban gebundene Tuch auf ihrem Kopf geriet ins Rutschen und fiel wie ein zusammengebrochener Wasserfall zu Boden. Sie stand da, blickte darauf wie zu etwas Unwirklichem. Wie in Zeitlupe nahm sie es auf, steckte es in ihren Beutel mit dem Proviant, von dem sie nur wenig gegessen hatte, schlang sich das Handtuch um die Schultern und dann lief sie - so schnell es ging über den weichen Sand, der unter ihren Füßen immer wieder zur Seite wich und kaum Halt gab. Marissa fluchte vor sich hin, versuchte schneller zu laufen, verlor das Gleichgewicht und spürte einen stechenden Schmerz am rechten Fußgelenk. Augenblicklich schossen ihr Tränen in die Augen. Wütend wischte sie sie weg. Sie würde nicht weinen. Sie weinte nie.
Sie fühlte die Sonnenwärme über sich, sah in die Helle hinauf.
Das verwischte Weinen brannte auf ihren Wangen.
*
Das Schnarchen ihrer Großmutter hörte sie bereits als sie auf dem kleinen Trampelpfad um das Haus humpelte. Trotz der Schmerzen im Knöchel musste sie lachen. Wie oft hatten die Kinder sich früher heimlich in das Schlafzimmer geschlichen und die Großmutter beobachtet, die mit offenen Mund auf dem Rücken lang, wie ein Karpfen, der unfreiwillig Luft schnappte und diese unglaublichen Sägegeräusche von sich gab. Der Großvater daneben hatte meist die Decke über dem Kopf gezogen, auf dem er schon seine wollende Nachtmütze hatte und Wattebäusche in den Ohren. Geholfen hatte es nicht viel. Einmal hatte er im Vertrauen den Kindern zugeflüstert: „Es ist einfach furchtbar. Wenn ich es nicht schaffe, vor ihr einzuschlafen, ist es vorbei.“ Dann hatte er die Augen zum Himmel verdreht und theatralisch geseufzt. Er tat den Mädchen Leid, doch sie wussten, dass er trotzdem seine Frau über alles liebte und es nie über sich gebracht hätte, im Zimmer nebenan zu schlafen.
Und die Schwestern liebten das Schnarchen der Großmutter und erschraken gruselig-gerne, wenn ein überaus lauter Rachenton sie zusammenzucken und rasch wieder in die Betten rennen ließ. Das war lange her. So vieles war lange her.
Marissa setzte sich auf die Bank auf der Terrasse und lauschte dem Schnarchkonzert der Großmutter. Das Bein mit dem wehen Knöchel hielt sie ausgestreckt von sich. Es pochte da drinnen und brannte. Sie hatte große Lust sich selbst zu beschimpfen. Wahrscheinlich war es jetzt vorbei mit dem erholsamen Stranddasein. Sie wollte gerade eine gewaltige innerliche Selbstanklage beginnen, als ein lauter Schnarcher ertönte und ein darauffolgender Seufzer, der anzeigte, dass die Großmutter durch ihr eigenes Schnarchen wach geworden war. Marissa beugte sich von der Bank so gut es ging nach hinten, um einen Blick von der Großmutter auf dem Sofa zu erhaschen. Die hatte sich schon aufgesetzt, blickte etwas zerwühlt um sich und nahm sogleich die Enkelin wahr.
„Kind, bist du schon da? Wie lange habe ich denn geschlafen?“ Beim Aufstehen legte sie die Decke zusammen und schlurfte dann auf die Terrasse. Marissa hob die Schultern: „Ich weiß nicht, bin gerade gekommen.“
„Ist etwas?“ Die Großmutter blickte sie forschend an, merkte sogleich am Tonfall der Enkelin, dass irgendetwas nicht stimmte.
Marissa stieß voller Missbilligung sich selber gegenüber einen Zischlaut aus.
„Bin am Strand umgeknickt. Mein Knöchel tut ziemlich weh.“
„Ach je. Wie dumm. Soll ich dir einen kalten Wickel machen?“ Die Großmutter wurde gleich pragmatisch. Mit langen Gefühlsbekundungen hielt sie sich nicht auf. Marissa nickte. „ Das wäre nicht schlecht.“
Es war ihr unangenehm als die Großmutter schließlich mit einem feuchten Wickel wiederkam und ihr noch einen Schemel unter den Fuß stellte. „So – das sollte helfen. Sonst rufe ich morgen Dr. Schmidtmann an.“
„Tut mir Leid, Oma. Ich sollte dir helfen, nicht du mir.“ Marissas Stimme steckte tief in ihrem Hals.
„Papperlapapp. Watt mutt, dat mutt.“ Beruhigend legte sie ihre warme Hand auf die Schulter der Enkelin. „ Ich freu mich, dass du da bist. - Jetzt gibt es einen guten Tee und dann genießen wir den Nachmittag. Ich habe auch noch von deinen Lieblingskeksen…“ Die Großmutter zwinkerte vergnügt mit den Augen und schlurfte in die Küche.
*
Es tat ihr gut bemuttert zu werden. Seit sie zum Studieren in München war, musste sie für alles selber sorgen, um die täglichen Bedürfnisse und Notwendigkeiten abzudecken. Einerseits war es eine schöne Form der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit und Teil ihres Erwachsenseins. Anderseits aber sehnte sie sich doch hin und wieder danach, einfach das Essen vorgesetzt zu bekommen und die gewaschene Wäsche nur noch in den Schrank räumen zu müssen. Das waren Annehmlichkeiten, die sie jetzt richtig zu schätzen wusste, nachdem es diese so nicht mehr gab. Natürlich hatten diese früher bedeutet, unter den Blicken und der Kontrolle der Eltern zu stehen, sich anzupassen und immer wieder zu rechtfertigen, wenn sie zu spät nach Hause kam, schlecht gekleidet rumlief. Das war manchmal recht mühsam. Dabei waren ihre Eltern nicht mal wirklich richtig streng, da kannte sie weit schlimmere Ausführungen. Ihr Vater konnte zuweilen richtig cool sein und drückte viel öfter ein bis zwei Augen zu als ihre Mutter. Manchmal steckte er ihr auch unter der Hand zusätzlich zum Taschengeld einen weiteren Geldschein zu und freute sich mit Marissa über die kleine Heimlichkeit.
Das gefiel Marissa sehr. Nicht nur wegen des unverhofften Geldsegens, sondern weil sie es liebte Geheimnisse zu haben, verbotene Verbünde einzugehen, eine eigene Welt zu leben, die so niemand kannte. Als Kind war sie eine Art Meisterin darin gewesen, sich Geschichten auszumalen, Bilder heraufzubeschwören und sich selber in ein anderes Leben zu phantasieren.
Bis zu ihrem dreizehnten Lebensjahr teilte sie ein Zimmer mit ihrer jüngeren Schwester. Zwar war es hinreichend groß, sodass jede von ihnen an einem Ende des Raumes für sich eine eigene Ecke hatte, aber die Gegenwart der anderen war doch immer spürbar. Eine Privatsphäre war so gut wie nicht vorhanden und ihre Geheimnisse und das andere Leben geriet immer mehr in Gefahr. Als dann die Neugierde der Schwester in ihr Tagebuch eindrang, sahen die Eltern die Notwendigkeit ein, jeder von ihnen ein eigenes Zimmer zu ermöglichen.
Kurzerhand räumte der Vater sein sogenanntes Arbeitszimmer, in das er sich von Zeit zu Zeit zurückzog. Was genau er da tat, hatte Marissa nie recht herausgefunden und auch nicht sonderlich nachgeforscht. Vielleicht lebte er dort auch in einer anderen Welt. Wenn dem so war, konnte sein Opfer nicht hoch genug geschätzt werden, diese aufzugeben. Marissa nahm das Zimmer sofort als ihres in Beschlag. Zwar war es sehr viel kleiner als das andere, aber es lag hinten am Ende des Flures, ein wenig abseits von der übrigen Betriebsamkeit und das Fenster gab den Blick in den kleinen Garten frei. Ein Glücksraum für ihre Phantasiewelten. Die nächsten Jahre waren dann auch Glücksjahre zu nennen, auch wenn ihr es selber so nicht bewusst war. Das Glück lag einfach in dem Zustand der zufriedenen Bedürfnislosigkeit, den sie lebte. Von ihr aus hätte es immer so weiter gehen können.
*
Am nächsten Morgen fühlte sich ihr Knöchel wie ein unförmiger, schwerer Klumpen an, der an ihrem Fuß klebte und es ihr unmöglich machte, mit diesem aufzutreten. Versuchte sie es, durchzuckte sie augenblicklich ein stechender Schmerz und sie musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht aufzustöhnen.
Der Weg die Treppe hinunter in die Küche gestaltete sich für sie wie eine Art Übung zum Erlernen ungewöhnlicher Fortbewegungsmöglichkeiten.
Sie kam sich vor wie ein einbeiniger Storch, der eine Treppenstufe nach der anderen hinunterhüpfte. Allerdings nicht wirklich graziös, die rechte Hand krampfhaft um das Treppengeländer gekrallt. Mit ihrem Sinn für Humor konnte sich Marissa lebhaft ausmalen, was für ein kurioses Schauspiel sie da bot. Zum Glück gab es keine Zuschauer, die Großmutter war bereits lange unten und hätte es der Enkelin auch sicher verboten, hinunter zu kommen.
So schimpfte sie auch gleich als sie der Enkelin ansichtig wurde. „Issa, Kind. Das hättest du nicht tun sollen.“
Marissa ließ sich schwer aufatmend auf einen Küchenstuhl fallen.
„Ach, Oma. Was soll ich denn oben so alleine? Und dann bei dem schönem Wetter. Wenn ich schon nicht zum Strand kann, möchte ich wenigstens bei dir im Garten sein.“
Die Großmutter nickte verständnisvoll. „Ja – sicher. Doch ich glaube, ich werde besser Dr. Schmidtmann anrufen. Er sollte sich den Knöchel angucken.“
Marissa wollte den Kopf schütteln und ablehnen. Tapfer sein, wie so oft. Doch irgendwie fehlte ihr dazu jetzt die Kraft und sie spürte auch, dass der Knöchel ärztlich versorgt werden musste. „Danke – das ist lieb“, sagte sie als Emilia zum Telefonhörer griff, nicht ohne ihr zuvor einen großen Becher Tee eingeschenkt zu haben.
Während Emilia telefonierte, humpelte Marissa vorsichtig mit ihrem Becher in der Hand hinaus auf die Terrasse und machte es sich auf der Bank bequem. Auf dem Tisch stand wieder ein gutes Frühstück bereit und Marissa schnitt sich hungrig eine Scheibe von dem selbstgebackenen Brot der Großmutter hinunter, strich viel Butter und noch mehr Honig drauf, genoss die wunderbare Süße auf ihrer Zunge, am Gaumen, überall im Mund und spürte in ihrem Inneren, wie sich alles vor Wohlbehagen entspannte.
Wäre sie eine Katze wie der alte Teo, der sich heute Morgen noch gar nicht hatte sehen lassen, hätte sie angefangen zu schnurren. So beließ sie es aber mit einem überaus zufriedenen Seufzer. Die Sonne war wieder freundlich zur Stelle und schickte ihr zusätzlich warmes Gefühl ins Gesicht und auf den Körper.
Es war so schön, dass sie fast den schmerzenden Knöchel hätte vergessen können. Sie schloss die Augen für einen Augenblick in Richtung Sonne, sah sich in gold-rotes Licht gehüllt und warm umfangen.
*
Gegen Mittag kam der Arzt angeradelt auf einem alten aber robusten Fahrrad, das ihn vom Inseldorf über die Dünenwege hierher brachte. Ein kundiger Blick seinerseits auf Marissa geschwollenen Knöchel, brachte die eindeutige Diagnose einer Verstauchung und die Verordnung von Schonung, ruhiger Lagerung des Beines und Geduld.
„Das wird dann schon“, meinte der Mediziner, „aber weite Strandläufe sind erstmal nicht drin, junge Dame.“ Er sah Marissa mit einem jungenhaften Grinsen im Gesicht an. „Und auch sonst keine wilden Unternehmungen…“
Eine überflüssige Ermahnung, schon allein wegen mangelnder Möglichkeiten hier auf der Insel. Aber Marissa grinste zurück. Der Arzt war nett, sie mochte ihn. Sie hatte ihn schon früher ein paar Mal gesehen, wenn sie zu Besuch war. Aber das war lange her. Damals war sie noch ein Kind, ein Mädchen gewesen. Und er der alte Herr Doktor, obwohl er aus ihrer jetzigen Sicht als junge Erwachsene keineswegs sehr alt sein konnte. Vielleicht Anfang, Mitte Vierzig und noch sehr jugendlich in seinem Umgang. Sie spürte, dass er noch wusste, wie es war jung zu sein. „Ist recht, Herr Doktor“, meinte sie launig. „Ich habe es gut hier.“
„Das sehe ich“, gab er zurück. „Die Großmama ist ja auch eine Perle.“
Emilia lächelte geschmeichelt, bot dem Doktor zu trinken an und gab ihm noch ein Stück Kuchen mit auf den Weg. „Gerade eben fertiggebacken. Noch ein wenig warm.“
Dr. Schmidtmann sträubte sich nur sehr wenig, nahm das Stück Kuchen, das Emilia ihm eingewickelt hatte und verstaute es vorsichtig ganz oben in seinen Packtaschen. Dann schwang er sich rasch auf sein Fahrrad, nicht ohne zu versprechen, in den nächsten Tagen nochmal vorbei zu schauen und bei Bedarf natürlich auch eher. Er winkte ohne sich dabei umzudrehen und war bald außer Sichtweite.
Emilia sah ihm lächelnd nach. „Der Timo, das ist so einer“, meinte sie mit zweideutigem Unterton zu ihrer Enkelin.
„Ich finde ihn ganz nett“, entgegnete Marissa.
„Ja“, lächelte die Großmutter, „nett ist er.“
*
Der Nachmittag verging in einer sonderbar schönen Mischung aus Pflaumenkuchen mit Sahne, verschlafenen Dasein, schweigender Unterhaltung und fließender Ruhe, die durch den Garten schlich wie ein scheues Tier.
Marissa lag wohlgebettet in dem alten Liegestuhl, der im Schuppen hinten am Ende des Gartens sein Dasein gefristet hatte und hellerfreut war, als er von ihr mit Emilias Hilfe ans Tageslicht befördert wurde.
Die Großmutter hatte sich seiner erinnert als sie sich darüber Gedanken machte, wie es für Marissa im Garten am bequemster wäre. Auf der hölzernen Bank konnte man zwar ganz gut sitzen, aber für ein entspannten Liegen und hochlagern des Fußes war sie auf Dauer nichts.
„Ich benutze ihn nicht mehr, mir ist er zu tief. Aber für dich müsste er genau richtig sein.“ So waren die beiden zusammen zum Gartenende über den Rasen gegangen bzw. gehumpelt, wobei Emilia erst nichts davon hatte wissen wollen, dass Marissa mitkam. „Du sollst den Fuß schonen…“
„Ja, Oma“, nickte Marissa und humpelt los. Sie war einfach zu neugierig, was wohl sonst noch in dem Schuppen zu entdecken war, den sie aus ihrer Kinderzeit als unheimlich empfunden hatte. Sie hatte sich immer ausgemalt, dass dort vielleicht eine Hexe wohnte, wie bei Hänsel und Gretel. Oder dass da vielleicht eine Prinzessin gefangen gehalten wurde und dringend darauf wartete, befreit zu werden. Oder ein gefährliches Untier, das dort eingesperrt war. Es gab unzählige Möglichkeiten, eine gruseliger als die andere. Und alle hatten sie daran gehindert, in unmittelbare Nähe des Schuppens zu kommen oder wohlmöglich ins Innere vorzudringen. Undenkbar….
Auch jetzt so viele Jahre später, war ihr ein klein wenig mulmig als sie dem Holzverschlag so nah kam. Ihr Verstand sagte ihr, dass es dort nichts zu fürchten gab, aber – man wusste ja nie.
Die Türe quietschte ein bisschen in den Angeln als Emilia das rostige Schloss öffnete und ein muffiger Geruch schlug ihnen entgegen. In der Dunkelheit drinnen konnten sie kaum einen Gegenstand unterscheiden. „Hier muss doch noch Licht sein“, murmelte Emilia und tastete auf dem Fußboden nahe der Türe. „Wusste ich’s doch“. Sie hielt eine riesige Taschenlampe in der Hand. „Ob die wohl noch geht?“ Sie ging, auch wenn das Licht recht spärlich über das abgestellte Gerät glitt. Marissa hielt sich an der Tür gelehnt fest und versuchte, näheres zu erkennen. Alles in allem war das Ganze ziemlich enttäuschend. Von Geheimnissen, Gespenster oder ähnlichen mysteriösen Erscheinungen war nicht das Geringste zu entdecken. Nur altes Mobiliar, Bretter, Gerätschaften , ein vorsintflutlicher Rasenmäher, Staub und Spinnenweben – nichts ungewöhnliches.
„Da hinten – das könnte der Liegestuhl sein“, meinte sie schließlich als sie ihren Blick über das Inventar hatte schweifen lassen - und quietschte unvermittelt entsetzt auf als sich etwas mit rasender Geschwindigkeit auf sie zubewegte und schon verschwunden war, bevor sie es genau wahrgenommen hatte.
„Mäuse“, meinte Emilia trocken. „Komm hilf mir mit dem Liegestuhl, aber pass auf deinen Fuß auf.“ Schließlich bugzierten sie das Möbel auf der alten Schubkarre, die ebenfalls untätig im Schuppen stand und stellten ihn an einen Schattenplatz auf den Rasen. Gemeinsam befestigten sie noch das zugehörige Fußteil und dann ließ sich Marissa sofort auf dem neuem Sitzplatz nieder.
„Hier bleib ich“, verkündete sie. „Das gefällt mir.“
„Freut mich. Ist hoffentlich ein bisschen Ersatz für den Strand.“
„Absolut.“
Marissa lehnte sich hingegeben zurück und ließ sich in den nächsten Stunden mehr und mehr in die grüne Sommerblätterwelt ziehen. Wenn sie die Augen schloss, hörte sich das leichte Rauschen in den Zweigen wie sanftes Wellenspiel an. Manchmal trug ein Windhauch den Duft von Lavendel zu ihr.
Irgendwann im Laufe des Tages war Kater Teo aufgetaucht mit einem, wie Marissa fand, verwegenen Gesichtsausdruck, der von nächtlichen Abenteuern zeugte. Er sprang sofort zu ihr auf die Liege und machte es sich am Fußende bequem. Sein Fell schmiegte sich angenehm an ihre nackten Beine. Dem wehen Knöchel kam er dabei instinktiv nicht zu nahe. Manchmal kitzelten seine Barthaare in ihren Kniekehlen. Sein Schnurren klang behaglich an Marissas Ohren und mischte sich mit dem lauen Wind, dem Blätterrauschen.
*
Anfangs schien es so als ob sich die Tage einer wie der andere in gleicher, angenehmer Weise aneinander reihen würden.
Marissa schlief morgens lange, genoss es, sich im Bett zu räkeln und erst dann aus den Decken zu kriechen, wenn ihr danach war oder Kater Teo sie so penetrant mit seiner kleinen, harten Zunge an den Zehen leckte, dass sie sich vor Kitzeln das Lachen nicht mehr verkneifen konnte und aufgab. „Ist gut, Schnurre-Teo, ich steh auf.“ Mit ihrem Knöchel ging es zwar alles langsam aber von Tag zu Tag erholte er sich. Und Dr. Schmidtmann, der ihn sich ansah, war zufrieden. „Noch ein paar Tage, dann kannst du wieder an den Strand. Aber bis dahin: Geduld!“
Geduld – das war nicht unbedingt ihre Stärke, aber scheinbar hatte dieser ruhige, endlegende Ort eine besänftigende Wirkung auf sie, denn sie hatte kaum das Bedürfnis nach Unternehmungen oder Ablenkung. Es tat ihr einfach gut, hier zu sein. Ihre Großmutter war auch ein Schatz, verwöhnte sie so gut sie konnte. Einmal in der Woche kam der Kaufmann vom Dorf mit seinem Pferdefuhrwerk und lud eine ganze Ladung Lebensmittel vor Emilias Tür ab. Hinterher setzte er sich zu ihr auf die Terrasse oder bei schlechtem Wetter in die Wohnstube, bekam einen Kurzen – auch wenn er immer behauptete, während der Arbeit nicht zu trinken – und versorgte Emilia noch mit dem neuesten Klatsch und Tratsch der Insel.
Als Marissa ihn das erste Mal sah, konnte sie nicht glauben, was da für eine Erscheinung vom Kutschbock hinunterstieg. Ein altersloses Männlein, mit faltigem Gesicht, roter Nase und zwei Ohren, die derart weit vom Kopf abstanden, dass sie an ein paar Segel erinnerten. Vielleicht war er mal in einen Sturm geraten und hatte keine Mütze aufgehabt, dachte Marissa innerlich grinsend bei sich, hatte aber gleich ein wenig schlechtes Gewissen ob ihrer Respektlosigkeit. Und überhaupt war Knut Niederbrück ein Mann, der einem sofort in seinen Bann zog. Er konnte unglaublich farbig erzählen und besaß einen trockenen Humor, der jedes Zwerchfell arg strapazierte. Auch Marissa kam sehr bald in den Genuss, sich nicht mehr vor Lachen halten zu können. Von da an freute sie sich immer, wenn sie die Pferde von Knut Niederbrück herantraben hörte.
Ansonsten verbrachte sie viel Zeit im Garten auf ihrem Platz im Liegestuhl und gab sich dem süßen Nichtstun hin. Und dem Lesen. Sie hatte sich aus Emilias kleiner Bibliothek ein Buch geliehen und versank damit in die Tiefen der Welt voll Poesie und Wohllaut. Sie hatte immer gern und viel gelesen. Doch seit sie studierte, waren es nunmehr vorwiegend Fachbücher zur Veterinärmedizin, die sie sich zu Gemüte führte. Für unterhaltsame Literatur fand sie kaum Freiraum. Für was ein gestauchter Knöchel doch gut war.
Das Studium, so sehr sie sich dafür begeisterte, hatte sie zum Ende des Semesters sehr angestrengt. Irgendetwas in ihr war nicht mehr bereit gewesen, sich nach dem vorgesehenen Lehrplan zu richten, nach Vorlesungen. Alles ermüdete sie über Gebühr und nachts fand sie nicht die Ruhe, die ihr die benötigte Erholung hätte bringen können. Im Gegenteil fühlte sie sich in ihrem traumschweren Schlaf oft verfolgt, gedrängt, atemlos, sodass sie am Morgen müder erwachte als sie abends ins Bett gegangen war.
Die Bilder der Nacht standen schwarz-bedrohlich vor ihr, ohne dass sie sie hätte fassen und erkennen können. Sie verbargen sich hinter dem Vorhang der Taghelle ohne wirklich verschwunden zu sein. Eine unsichtbare Bedrohung von unwirklicher Realität.
Hier endlich konnte sie schlafen. Ruhig. Friedlich. Traumlos.
Das tat ihr gut. Das machte das Hiersein aus. Mehr war es nicht. Und doch so viel.
*
Emilia vermisste nichts. War sich selbst genug. Freute sich an ihrer Heimatoase, ihrem Pflanzenparadies, das sie noch mit Julius geplant und angelegt hatte.
Mitunter sah sie ihn wie aus dem Nichts neben den Rosensträucher stehen mit der Gartenschere in der Hand, sah wie er sich umdrehte. Hörte ihn rufen: „Lia. Soll ich noch mehr abschneiden oder ist es genug?“ Und es war immer gut, egal was er tat. Manchmal kam er mit auf dem Rücken verschränkten Armen langsam auf sie zu, blieb nahe vor ihr stehen und zauberte dann eine einzelne besonders schöne Rose hervor. Für sie. Grinste bubenhaft. Charmant. Unwiderstehlich. Emilia musste immer lachen.
Auch jetzt noch. Nach so vielen Jahren ohne ihn. Und war glücklich. Glücklich, dass sie hier noch so lange Zeit hatten leben können. Zusammen.
Die Sehnsucht nach Meer, Stille und Abgeschiedenheit hatte sie hierhergezogen.
Allen Protesten zum Trotze hatten sie sich auf die Suche nach einem Haus gemacht und waren überraschend schnell fündig geworden. Das alte Haus hinter den Dünen stand schon lange zum Verkauf, niemand wollte es haben, da das Inventar mitveräußert werden sollte. So stand es im Testament des Eigentümers. Die Möbel waren altmodisch und voller Patina. Es gab viele merkwürdige aber auch schöne Sammlerstücke, die von den Seefahrten des alten Kapitäns stammten, der hier während seiner Landaufenthalte gewohnt hatte.
Emilia hatte sich sofort in das Haus verliebt und Julius liebte alles, was seine Frau liebte. Und so zogen sie hierher und genossen jede Minute in ihrem neuen Heim. In ihrem Paradies am Meer.
Fünfzehn Jahre war das jetzt schon her. Sie waren glücklich gewesen in der Zeit, in der es ihnen vergönnt war, gemeinsam Inselfrieden einzuatmen.
Dann wachte Julius eines Morgens nichts mehr auf. Er schien etwas Schönes im Traum gesehen zu haben, denn es lag noch ein Lächeln auf seinem Gesicht. Doch seine Augen öffneten sich nicht und die Hand, die beim Einschlafen die ihre gehalten hatte, war kalt. Emilia spürte noch die Liebe, die zu ihr geflossen war und nahm die Hand wärmend in die ihre, drückte sie an ihr Herz und gab dann den Mann, den sie noch immer so liebte wie am ersten Tag, an die Macht zurück, von der er einst auf die Welt geschickt worden war.
Das war vor vier Jahren gewesen. Und es verging kein Tag, an dem sie nicht an ihn dachte. Mit vollem, warmen Herzen ohne Trauer. Er war bei ihr, auch wenn er jetzt woanders war. Sie fühlte seine Nähe und Gegenwart deutlich und war nicht allein.
*
„Vermisst du ihn?“ Marissa stand in der Tür des Schlafzimmers gelehnt und sah die Großmutter auf der leeren Bettseite sitzen, das Bild des Großvaters in der Hand.
„Ja .“ Emilia wandte ihren Blick nicht vom Bild. Wischte dann mit der Hand darüber. Eine liebevolle, streichelnde Geste, die Marissa unerwartet berührte. Dann stellte sie es auf das Tischchen neben dem Bett. „Komm setz dich.“ Sie klopfte einladend auf den Platz neben sich. Marissa schmiegte sich eng an die Großmutter und ließ es zu, dass diese fest den Arm um sie schlang.
„Aber weißt du, er ist da, bei mir“, sie legte die freie Hand auf ihr Herz. „Ich kann immer mit ihm reden und er redet mit mir.“
Marissa schwieg. Beide schwiegen eine lange Weile, aneinander gelehnt wie um sich gegenseitig Halt und Schutz zu geben. Um sich zu trösten und Mut zu verleihen und sich der Gegenwart der anderen zu vergewissern.
Der Wecker an Emilias Bettseite tickte langsam und stetig vor sich hin, lullte die beiden in einen tranceartigen Traumzustand. Die Luft flirrte wie feine Schmetterlingsflügel. Draußen war es schon dunkel und der Wind ließ manchmal die Fensterläden unten am Haus klappern. Sonst war es still und die Zeit schien zu schlafen. Sie war müde. Müde wie die beiden da am Bettrand.
Und dann sagte die Jüngere so leise, dass es wie ein Flüstern eines Schmetterlings klang: „Ich wünschte, ich würde Sandrina spüren…“
Die Umarmung der Großmutter wurde enger und mit einem Mal sank die Enkelin mit ihrem Kopf auf den Schoß der Älteren und mit ihr die Tränen, die in ihr festgesteckt gewesen waren. Sie flossen einfach aus ihr heraus. Die alte Frau strich sacht über den Arm der Jungen, hielt sie fest und ließ sie weinen. Auch in ihren Augen brannten die Trauertropfen und rannen lautlos über die Wangen.
Es dauerte seine Zeit. Und dann…dann hörte es auf - das Seelenweinen. Es schien erschöpft von der Anstrengung.
Alle waren erschöpft. Marissa blickte die Großmutter mit roten Augen an, ihre Nase tropfte noch aus undichtem Ventil. Alles war nass. Der Schoß, das Gesicht, die Kleidung. „Darf ich heute Nacht bei dir schlafen?“
Emilias Augen nickten leise. Wortlos trockneten sie sich die Tränenspuren aus den Gesichtern, wechselten die mitgenommene Kleidung. Als sie beide ins Bett krochen, schliefen sie schon bevor sie sich Gute Nacht sagen konnten.
*
Und morgen wird die Sonne wieder scheinen,
und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns,
die Glücklichen, sie wieder einen
inmitten dieser sonnenatmenden Erde…
und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
werden wir still und langsam niedersteigen,
stumm werden wir uns in die Augen schauen,
und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen…*
*(Text: Henry Mackay, Melodie: Richard Strauss)
Früh am Morgen wachte Emilia auf, hörte ganz deutlich in sich dieses Lied, das die wundervollen Worte mit schwebenden Noten zum Schwingen brachte. Eine Melodie Jenseits von Zeit und Raum, eine Poesie mit Flügeln. Zusammen berührten sie die Saiten der Seele.
Sie selber hatte es überaus gerne gesungen – damals nach dem Krieg als sie endlich Gesangsstunden nehmen konnte, leider nicht regelmäßig, denn die Stunden waren teuer, aber doch immer mit völliger Hingabe und Begeisterung. Dieses Lied wurde so etwas wie ein Symbol für sie dafür, dass es immer weiter ging, das es immer wieder ein Morgen gab.
Natürlich war es kein Zufall, dass sie sich gerade jetzt daran erinnerte. Emilia war erschüttert über den Ausbruch der Enkelin. Wieviel musste sich in dem Mädchen alles angestaut haben, dass es so heftig hervorbrechen konnte. Und warum hatte sie sich täuschen lassen von der fröhlichen Energie der Enkelin, von ihrem Überschwang, ihrem Lachen. Wahrscheinlich weil sie sich täuschen lassen wollte. Nicht sehen, was sie am ersten Abend gesehen hatte und dann weggeschoben hatte. Eine junge Frau, die weglief. Um Hilfe lief.
Vorsichtig setzte sich Emilia im Bett auf, der Wecker zeigte 5.30 Uhr. Das Gesicht ihrer Enkelin lag vergraben in den dicken Wolken des Kopfkissens. Nur die Nase war zusehen, klein, spitz und rot, durch die geräuschvoll der Atem ein und ausströmte.
„Arme Nase“, dachte Emilia. Langsam und so leise es ging, stand sie auf, schlüpfte in ihre Pantoffeln und hüllte sich in ihr Umschlagtuch, das am Fußende lag. Die Dielenbretter knarrten ohrenbetäubend und die Treppenstufen schlossen sich ihnen an. Unwillkürlich hielt Emilia den Atem an, damit nicht dieser auch noch Lärm machte.
Unten öffnete sie die Küchentür, sank wie erschöpft auf einen Stuhl und sog begierig die Luft ein, die zu ihr hineinfloss.
So saß sie bewegungslos ein paar Minuten, sah nach draußen auf den noch nebelverhangenen Morgen. Es war zu erahnen, dass sich hinter dem Nebel schon die Sonne für ihren Auftritt bereit machte. Es würde wieder ein schöner Tag werden.
An ihren Beinen spürte sie eine warme Bewegung, ein feuchtes Berühren. Sie beugte sich hinunter zu Teo, der sie mit sanften Schnurren daran erinnerte, dass er da war und Hunger hatte. Nachdem sie seine Schale mit Milch aufgefüllt hatte, trat hinaus auf die Terrasse und ließ sich vom Nebeldunst einhüllen.
Später saß sie mit ihrer Kaffeetasse am Küchentisch, hörte wieder das Lied in sich und wusste, dass sie alles tun würde, um ihrer Enkelin ein gutes Morgen zu bereiten. Noch wusste sie nicht wie. Erstmal würde sie für diesen Morgen sorgen - dass dieser gut war. Dann würde sich alles Weitere finden.
*
Marissa setzte sich mühsam im Bett auf, ihr Kopf fühlte sich dumpf und schwer an. Vage erinnerte sich an gestern, an das Weinen und spürte wie es hinter ihren Augenlidern noch immer heiß und brennend pochte, so als wolle sich da etwas erneut Bahn brechen. Die Tränenflut gestern hatte sie völlig unvorbereitet erwischt. Sie hatte keine Ahnung gehabt, was da in ihr lauerte. Am Strand vor ein paar Tagen war da so etwas wie ein Vorzeichen gewesen, doch sie hatte es nach unten gedrängt. Sie war so voller Glück gewesen, hier zu sein, in ihrem Paradies der Kindheit. Im Paradies konnte es keine Tränen geben.
Sie musste heftig schlucken, etwas Dickes, Unförmiges steckte in ihrer Kehle. Ein unterdrückter Laut, der sie würgte…
So schnell es ihr Knöchel zuließ, stand sie auf und stolperte hastig die Treppe hinunter. Sie wollte zu ihrer Großmutter, ihre Umarmung spüren, ihr Streicheln, ihre liebevolle Stimme.
Die Küche war leer. Durch die Tür fiel bereits warme, helle Sonne wie eine große Lichtflut. Marissa musste blinzeln um etwas draußen erkennen zu können.
Wie immer stand das Frühstück bereit auf dem Terrassentisch. Heute standen zudem ein paar bunte Blumen auf dem Tisch und es gab Kuchen. Ein Windlicht leuchte schwach gegen die Sonne an, die den ganzen Tisch umstrahlte. Marissa spürte wieder das Pochen hinter den Lidern, blinzelte es hastig weg, bemerkte so nicht, wie die Großmutter vom Ende des Gartens hinweg auf sie zukam. Erst als sie die wenigen Stufen zur Terrasse erklomm, nahm sie sie wahr.
„Issa“, die Großmutter war da und umarmte sie fest, gab ihr einen Kuß auf die Wange. „Alles, alles Liebe für dich zum Geburtstag.“
Marissa zuckte ein wenig zusammen. Das war es, was sie vergessen hatte. Deshalb die Blumen, der Kuchen…
Sie schmiegte sich eng an die Großmutter, unfähig etwas zu sagen. Dafür plauderte diese umso munterer darauf los: „ Setz dich, stärk dich erstmal. Der Tee ist gleich fertig und es gibt auch hartgekochte Eier, wenn du magst. Und – ach, ja: Stachelbeermarmelade - habe ich extra aufgehoben. Die liebst du doch so…“
Geburtstag. Marissa schüttelte innerlich den Kopf. Noch nie hatte sie ihren eigenen Geburtstag vergessen. Noch nie war er so unwichtig für sie gewesen. Sonst hatte sie sich immer darum bemüht, viele Leute einzuladen, zu feiern, zu lachen, Spaß zu haben. Tage vorher war sie schon mit Vorbereitungen beschäftigt, kochte und backte gerne selber und freute sich, wenn ihre Gäste vor Vergnügen die Augen verdrehten, sich die Bäuche hielten und Marissa immer wieder für die tolle Bewirtung lobten. Das machte sie glücklich, viel glücklicher noch als die Geschenke und Glückwünsche.
Gedankenversunken biss sie in den lockeren Kuchen, der auf der Zunge zu zergehen schien. Selber bewirtet zu werden war schon auch herrlich, sie entspannte sich und aß alles, was der Tisch zu bieten hatte. Ihre Großmutter sah ihr dabei lächelnd zu, war mit einem Mal auch wieder ins Schweigen verfallen und sog den Moment in sich auf.
Schließlich hielt sich Marissa den Bauch. „Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das Mittagessen kannst du dir sparen.“
Emilia lächelte wissend. „Na – mal abwarten, wenn du erst siehst, was es gibt, reden wir wieder drüber.“
„Oma, du willst mich mästen.“
„Na – ein paar Pfunde mehr können dir nicht schaden.“
Gemeinsam deckten sie den Tisch ab und Emilia machte sich an den Abwasch. Obwohl sie protestierte, nahm sich Marissa ein Geschirrhandtuch und trocknete ab. „An meinem Geburtstag kann ich machen was ich will – auch abtrocknen.“
„Machst du nicht immer, was du willst?“ forschte Emilia mit dem Blick auf das in schaumiges Wasser getauchte Geschirr.
„Vielleicht“, Marissa hob die Schultern.
Und dann sagte Emilia unvermittelt: „Deine Mutter hat angerufen.“
Marissa sah nicht auf, trocknete hingebungsvoll den Teller in ihrer Hand.
„Sie wusste nicht, dass du hier bist. Hat es aber vermutet.“ Marissa schwieg dazu. „Warum hast du ihr nichts davon gesagt, dass du hierher fährst. Sie macht sich doch Sorgen.“ Wider Willen war Emilia in einen tadelnden Tonfall verfallen, bereute es aber sofort. Sie spürte, wie sich Marissa weiter in sich zusammenzog. „Na – wie dem auch sei. Ruf sie doch nach dem Mittagessen an. Sie freut sich.“
Marissas Schweigen wurde mehr und mehr zu einem undurchdringlichen Nebel, der sich in der ganzen Küche ausbreitet und sie beide einhüllte. Es war plötzlich kalt hier und die Sonne schien ihre Kraft verloren zu haben. Und dann kamen wie von irgendwo her die Wörter: „…ich kann das nicht…“
Sie schienen nicht von Marissa zu kommen, klangen durch den Nebel dumpf und farblos. Und dann fiel etwas zu Boden, Scherben langen überall verteilt, zerschnitten den Nebel und ließen die Sicht klar werden auf das Mädchen, das mitten in ihnen kniete und dem lautlos die Tränen über die Wangen liefen.
*
Wie absurd zu glauben, es könne alles wieder gut sein nachdem der Seelenvulkan gestern seine Schleusen geöffnet hatte und nun weiter ungehindert überfloss. Emilia sah mit Bestürzung den erneuten Tränenanfall der Enkelin. Und fühlte sich überaus hilflos. Äußerlich reagierte sie ruhig und sachlich. Half Marissa ohne viele Worte die Scherben zusammenzufegen, reichte ihr Taschentücher und hielt sie schließlich minutenlang umfangen. Stand mit ihr inmitten des Scherbenhaufens, strich ihr über den Rücken, die Arme, hielt ihre Hände. Schließlich saßen sie zusammen auf der Bank im Garten, ließen die Sonne die Hitze der Tränen aufsaugen und suchten einander nah zu sein.
„Möchtest du reden?“ fragte Emilia nach langem Schweigen und drückte sanft die Hand der Enkelin. „Reden hilft.“
Marissa erwiderte den Händedruck, lehnte ihren Kopf an die Schulter der Großmutter. „…weiß nicht – vielleicht. Aber erstmal hätte ich gerne noch ein Stück Kuchen.“
Emilia lachte erleichtert und wollte schon aufstehen, um in die Küche zu gehen.
„Ich hole es mir selber.“ Marissa sprang auf und stand kurz darauf mit einem Stück Kuchen in der Hand in der Tür und biss hungrig hinein, setzte sich wieder neben die Großmutter. „…tut mir Leid, dass ich so eine Heulsuse bin…“
„Ach, Issa,… das ist wohl gerade einfach so. Das gibt es eben mal…“
Sie berührte leicht die Hand der Enkelin. In dem Moment tauchte Teo auf der Terrasse auf, maunzte laut und vernehmlich und sprang mit einem eleganten Satz, dem man ihm gar nicht mehr zugetraut hätte, zu den beiden auf die Bank. Ungeniert spazierte er über Emilias Schoß um sich dann genau zwischen Großmutter und Enkelin in die warme Enge zwischen deren Oberschenkel hineinzuzwängen. Marissa grinste: „Hey, du Stromer, das ist viel zu eng hier.“ Aber sie rutschte bereitwillig ein wenig zur Seite, damit es sich Teo gemütlich machen konnte. Dieser fing augenblicklich an, sich die Pfoten zu lecken, die Ohren zu putzen und sich überhaupt in akribischer Art und Weise zu Recht zu machen.
„Unglaublich, so ein Pascha“. Emilia schimpfte liebevoll. „Du bist viel zu verwöhnt.“ Sie kraulte ihn ein wenig im Nacken, worauf dieser sofort ein kehliges Schnurren hören ließ. Und dann saßen die Drei auf der Bank in der Sonne, genossen die Nähe und die schnurrende Ruhe, den leichten Wind und das Gefühl von Heimat.
*
Heimat. Das war für Emilia lange Zeit kein realer Ort gewesen. Sie hatte immer das Gefühl gehabt, unterwegs zu sein. Auf der Flucht, auf der Suche. War nie wirklich jemals irgendwo angekommen, nie wirklich zuhause. Hier auf der Insel hatte sie erst jetzt am Ende ihres Lebens tatsächlich das Gefühl von Heimat, von angekommen sein. Doch viel Zeit war darüber ins Land gegangen, viele Wege hatte sie gehen müssen. Und nun – so schien es ihr – gab es noch einen Weg zu gehen. Jetzt, wo sie selber an ihrem Lebensziel angekommen war, gab es noch ein Um-sich-blicken auf die, die nachfolgten. Die noch eine weite Strecke vor sich hatten.
Emilia wollte sich gerne hinsetzen, ausruhen von ihrem Weg, doch sie sah, dass es dafür noch zu früh war. Mit dem Blick auf ihre Enkelin schaute sie mit einem Mal in einen rückwärts gerichteten Spiegel, worin sich alle Generationen aneinanderreihten. Und ihr kam eine Ahnung in den Sinn. Die Ahnung einer ineinander verwobenen Verästelung des Familiengewebes. Einer vererbten Lebensspur, die sich in allen Abzweigungen wiederfand.
Jetzt als alte Frau war ihr Blick dafür scharf genug. Sie sah, dass Marissa am Ende einer Kette von leidvollen Erfahrungen stand, die die Frauen vor ihr in ähnlicher Weise ebenso durchlebt hatten.
Mit irritierender Klarheit sah Emilia ihre Mutter Mathilda, sah sich selber, ihre Tochter Juliane, Marissas Mutter, sah die Schwestern Marissa und Sandrina…
Jede dieser Frauen war Teil eines großen Bildes, das nun seit über hundert Jahren immer wieder die Farben wechselte, Veränderungen erfuhr, neue Details erhielt, Schaden nahm, ausgebessert wurde und sich im ständigen Wandel der Jahre erneuerte. Doch die Grundstruktur war immer die gleiche, der Rahmen blieb unverändert und presste die Personen, die darin ihr Leben lebten, mitunter sehr unsanft und rüde zusammen.
Und doch: es war das Bild einer Familie. Ihrer, Emilias Familie. Und sie war die letzte, die noch wusste, wie es ausgesehen hatte, als die ersten Farbstriche getan wurden.
Ihr Blick zurück war in erster Linie von ihren eigenen Lebensbildern geprägt. Sie sah mit ihren Augen auf Geschehnisse, Gefühle und Zeitenwandel. Konnte nur durch ihr eigenes Empfinden daraus ein Muster erkennen und versuchen, dieses zu entwirren und entschlüsseln um der nachfolgenden Generation den Weg ein wenig einfacher und klarer zu gestalten. Doch wieviel Einfluss und Macht ihr diesbezüglich zur Verfügung stand, war immer abhängig davon, wie bereitwillig diese aufgenommen wurde. Sie konnte nicht erzwingen, dass ihre Erkenntnis und Hilfe erwünscht war. Doch sie vertraute darauf, dass zum rechten Zeitpunkt sich die Gelegenheit für eine vertrauensvolle Herzensöffnung zeigte. Sie war sicher, sie würde sie sehen und gemeinsam mit der Enkelin in eine Zeit spazieren, die für diese unbekannt war und voller ungeahnter Hintergründe ihres Lebens.
*
Marissa erlebte diesen Geburtstag als eine wundersame Mischung aus trauriger Süße. Nach dem Salzgeschmack der Tränenflut am Morgen, war es den Tag über viel tröstende Kuchenseligkeit und weiche streichelnde Sonnenwärme, die ihr zusammen mit der liebevollen Zuwendung ihrer Großmutter zu teil wurden. Kater Teo schmiegte sich auffallend oft an ihre Beine, forderte Streicheleinheiten ein, die ihr selber so gut taten. Es war ihr ein Wohlgefühl, die Stunden mit ruhevoller Leichtigkeit zu verbringen. Das Weinen hatte sie befreit aber auch sehr müde gemacht. Sie spürte sich in allen Gliedern verlangsamt und dumpf. Ihr Kopf war leer und ihr Herz von Gefühlswallungen träge. Sie war froh, nicht viel reden zu müssen, nichts zu hören, was sie anstrengte. Nicht heute, nicht jetzt.
Sie hatte in der Frage ihrer Großmutter, ob sie reden wolle, etwas erspürt, dass sie unruhig machte und gleichzeitig anzog und zurückweichen ließ. Irgendetwas war da, was wichtig war, gesagt und gehört zu werden. Doch sie war von solch undurchdringbarem In-Sich-Gefangen-Sein umschlossen, dass es ihr unmöglich schien, daraus auszubrechen. Nicht heute, nicht jetzt.
Sie humpelte durch das Gras, blinzelte ins Sonnenlicht, döste im Liegestuhl vor sich hin, aß zu viel Kuchen, scheuchte Teo von den Vögeln weg und lauschte auf das ferne Rauschen des Meeres. Morgen würde sie versuchen, wieder an den Strand zu gehen. Sie sehnte sich nach Wellengekräusel und Sandgeriesel.
*
Emilia beobachtete ihre Enkelin vom Küchenfenster aus während sie sich an das versprochene Abendessen machte. Deren Angebot nach Hilfe hatte sie abgelehnt: „Heute ist dein Geburtstag – lass dich nur verwöhnen.“
„Aber du verwöhnst mich doch schon die ganze Zeit“, hatte Marissa gesagt aber nicht viel Widerstand geleistet als die Großmutter sie wieder nach draußen scheuchte. Vielmehr hatte sie gelacht und sich mit einem befreiten Seufzer wieder in den Liegestuhl sinken lassen.
Emilia hatte das mit Erleichterung bemerkt. Es schien ihr, dass sich Marissa ein wenig erholt hatte, wenngleich sie ahnte, dass in der Tiefe ihrer Seelenhülle noch ein Meer von ungelöster Schmerzenstropfen lauerte.
Sie hoffte darauf, dass die richtige Zeit kommen würde für das, was schon lange abgelebt war. Aber das dennoch so lebendig war, dass es ihm Moment des Jetzt noch seine Wirkung zu zeigte.
Emilia rührte schnell und gleichmäßig die Sauce im Topf, damit sie keine Klumpen bildete. Sah durch das Fenster in den Garten, nahm wahr wie Marissa mit einem aufgeschlagenen Buch auf den Beinen dasaß, den Blick in die Ferne gerichtet. Und Kater Teo, der an ihrem Fußende eingerollt lag und mit völlig losgelösten Gliedern ausgestreckt dort schlief.
Ein friedliches Bild, das sie an ein anderes Mädchen erinnerte. Ein Mädchen voll von Träumen und Wünschen mit vielen Talenten und Fähigkeiten. Vom Aussehen unterschied sich dieses sehr von der jungen Frau auf dem Liegestuhl. Diese hier war schlank und zierlich. Das Mädchen von damals war recht klein und hatte einiges an Gewicht zu viel auf den Rippen. Aber hübsch war sie auch gewesen. Nicht so durchscheinend wie Marissa mit ihrem blassen Teint, vielmehr blühend und rund mit einer Haarpracht, um die sie manches andere Mädchen glühend beneidete. Allerdings durfte sie ihre langen, dicken Locken kaum offen zeigen. Ihr Vater zwang die Tochter zu einer strengen Zopffrisur. Das Drama, das sich ergab als sie die verhassten Zöpfe abschnitt, war nachhaltig. Aber dieses Drama war vergleichsweise harmlos gegenüber den Dramen gewesen, die sie schon durchlebt hatte und noch leben würde….
Als das Telefon klingelte, schrak Emilia auf, zog rasch den Topf mit der Sauce von der Herdplatte, gerade noch rechtzeitig bevor diese am Topfboden ansetzte.
Die Stimme ihrer Tochter klang gepresst an ihr Ohr. Emilia spürte die angestaunten Emotionen darin. „Kann ich Marissa jetzt sprechen?“
Emilia schaute aus dem Fenster in den Garten zu ihrer Enkelin hinüber. Diese war jetzt aufgestanden und humpelte auf einem Bein Teo hinterher. Als sie zum Haus hinübersah, winkte Emilia ihr zu und bedeutete ihr, zu kommen. Gleichzeitig nickte sie in den Hörer.
„Sie ist im Garten, aber sie kommt“, sagte sie ihrer Tochter und schob die Frage nach, wie es ihr ginge.
Die Antwort der Tochter fiel kurz und knapp aus: „Es geht, weil es gehen muss.“
Emilia spürte körperlich wie der Tonfall der Tochter ihr die Luft nahm. Ihre Knie fühlten sich mit einem Mal an wie Gummi und ließen sie auf den Stuhl neben dem Telefontischchen sinken. Dann stand Marissa neben ihr und ersparte ihr eine Antwort. Wortlos gab sie ihr den Hörer weiter. Kraftlos blieb sie sitzen während Marissa unruhig der Stimme in der Leitung zuhörte, Worte sagte, die nichts sagten, nur spüren ließen, dass da etwas Schweres zwischen der Frau in der Ferne und ihr hier auf der Insel lag, was zu massiv war, um durch die Kabel des Fernnetzes zu gelangen. Und da war eine unsichere Bemühung, darüber hinwegzureden, leicht zu scheinen um nicht an das zu stoßen, was das Gerüst aus Angst und Bedrängnis mühsam Aufrecht erhielt.
„Mam“, sagte Marissa schließlich, „mir geht es gut hier. Wirklich. Und dass ich nicht Bescheid gesagt habe, tut mir Leid. Es war einfach eine spontane Entscheidung.“
Emilia hörte die Antwort ihrer Tochter nicht, nahm nur einen Tonfall von Ferne war, der nach Enttäuschung klang. Nach Resignation.
„Tschüß, Mam. Und Danke für die Glückwünsche.“ Marissa legte den Hörer auf die Gabel des altmodischen Telefons, das noch eine Wählscheibe besaß und mit einem Kabel verbunden war. Ihr Gesicht war rot geworden während des Gesprächs und ihr Atem ging flach. Emilia sah ihr wortlos in die Augen, erhob sich und ging zu ihrer Sauce auf dem Herd zurück, die inzwischen dick geworden war. Während sie Wasser nachgoss, stellte sie den Topf wieder auf die Herdplatte und rührte erneut die sämige Flüssigkeit.
„Ich wollte sie nicht sprechen.“ Die Stimme ihrer Enkelin klang hinter ihrem Rücken leise und matt. Emilia drehte sich nicht um.
„Ich weiß, aber sie ist deine Mutter und macht sich Gedanken.“ Die Worte klangen schal und abgenutzt, doch ihr fielen keine anderen ein. Marissa stieß schnaubend Luft durch die Nase. „Darauf kann ich manchmal echt verzichten.“
„Du bist hart, Issa. Das passt nicht zu dir.“ Emilia schaltete die Herdplatte aus. Nahm den Topf mit der Sauce und goss diese über das vorbereitete Auflaufgericht aus Nudeln und Gemüse, streute Paniermehl darüber und setzte kleine Butterflöckchen hinauf. Dann schob das Gericht in den Ofen.
„Hm, Nudelauflauf. Lecker…“ lenkte Marissa ab und Emilia ließ es dabei bewenden.
Als sie später zusammen am Esstisch saßen, schob sie ihrer Enkelin ein kleines Päckchen zu. "Zum Geburtstag. Ich weiß, dass du es magst. Jetzt soll es dir gehören.“
Marissa spürte wie ihr Puls schneller wurde als sie das Geschenk in die Hand nahm. Durch das dünne Blumenpapier spürte sie eine Form, die ihr wunderbar vertraut vorkam. Sie zögerte damit, das Papier zu lösen obwohl sie es eigentlich nicht erwarten konnte. Sie wusste was es war. Sie wusste, dass es ein Kästchen ohne Schlüssel war. Holzverziert mit Rosenranken.
„Oma, bist du sicher?“ Marissa sah fragend zu Emilia hinüber, die sich über die staunende Freude der Enkelin amüsierte. „Ja – natürlich. Ich glaube, es hat irgendwie schon immer dir gehört.“
Marissa stand so schnell es ihr weher Fuß erlaubte auf und fiel der Großmutter warm um den Hals.
*
Eigentlich hatte sie diese Nacht wieder in ihrem kleinen Zimmer mit den schrägen Wänden und dem Blick in den Himmel verbringen wollen, doch ihre Beine führten sie ganz von alleine zum großen, weichen Bett, in die wohlige Nähe von Zuneigung und Geborgenheit, die dieses Zimmer atmete. Hier schien das Glücksschwingen, das das ganze Haus ausstrahlte, seinen Ursprung zu haben. Hier war die Quelle. Marissa wollte so nah wie möglich da heran und, wenn möglich, in sie hineintauchen – so tief es ging.
Emilia nahm es als selbstverständlich hin ihre Enkelin neben sich liegen zu finden. Sie genoss die leise Annäherung mit innerer Freude. Wie selten war es geworden, dass es Berührungen gab, Umarmungen, Sympathiebekundungen. Zeichen der Liebe und Zuneigung. Seit Julius‘ Tod gab es kaum etwas was vergleichbar gewesen wäre.
Nach dem Abendessen hatten sie nicht mehr viel geredet. Beide waren erschöpft von den Gefühlswellen, die den ganzen Tag über immer wieder auf und ab wallten. Emilia steckte noch die kalte Stimme ihrer Tochter im Innern und Marissa schien das Telefonat mit ihrer Mutter gleichfalls wie einen Kälteschock empfunden zu haben. Keine von beiden erwähnte etwas dergleichen, aber jede spürte es bei der anderen.
Als es dunkel wurde, saßen sie in Decken gehüllt auf der Terrasse, ließen ein Windlicht im Abend funkeln, suchten den Himmel ab nach Sternensplittern und schnupperten an dem Rest Sonnenwärme vom Tag.
Ihr Schweigen sank immer mehr in den Schlaf und sie führten nur noch ein Gespräch mit ihren Gedanken. Schließlich lehnte Marissa den Kopf an die Schulter der Großmutter und atmete leise aus. „Das war ein schöner Tag.“
Emilia zog sie näher zu sich.
„Ja“, sagte sie ebenso leise. „Das war er.“
*
In der Nacht begegnete Marissa den Tränen. Sie sah sie ganz deutlich vor sich stehen. So als hätten sie Gestalt angenommen. Sie waren da und streckten ihre Arme nach ihr aus, kamen Schritt für Schritt näher. Marissa fühlte sich wie erstarrt, konnte sich nicht vom Fleck rühren, wollten davonlaufen, konnte nicht. Eine beklemmende Lähmung legte sich über ihren Körper, sie versuchte zu rufen, aber kein Wort kam aus ihrem Mund. Sie fühlte ein Brennen, das ihren Hals verglühte und dann sah sie sich in einem Spiegel und dahinter ein Gesicht. Sie wollte sich umdrehen, es berühren, ihm nah sein. Aber da war eine Wand voller Unsichtbarkeit, die alles um sie herum mit sich nah.
Sie musste da hindurch, musste atmen, musste sich selber an die Hand nehmen. Mit aller Kraft spannte sie ihre Muskeln an und sprang…
Früh am Morgen wachte sie auf, fühlte ihr Haar nass im Nacken kleben, spürte die Feuchtigkeit, die ihr Pyjamaoberteil durchdrungen hatte und ihre Haut, die von kaltem Schweiß bedeckt war. Ihr Kopf fühlte sich schwer und dumpf an und ihre Kehle brannte wie Feuer. Mühsam versuchte sie ein wenig Speichel zu schlucken, doch das verursachte ihr sogleich Schmerzen und Hustenreiz. Kurzatmig richtete sie sich im Bett auf, sah, dass die Großmutter neben ihr noch schlief.
Leise schälte sich Marissa aus dem Federbett, saß dann mühsam aufgerichtet am Bettrand mit einem Schwindel in und um sich, der es ihr erschwerte aufzustehen. Eine Übelkeit tief in ihr, schlug immer größere Wellen, ließ sie würgen und mit den Kräften, die noch in ihr steckten, schaffte sie es in letzter Sekunde ins Bad. Gerade noch rechtzeitig bevor ihr Mageninhalt in krampfartigem Erbrechen nach oben schoss, bis sie sich völlig erschöpft vor der Toilettenschüssel zusammenkrümmte. Es dauerte lange bevor sie es schaffte, sich mühsam aufzurichten und den galligen Geschmack aus der Mund zu spülen.
Als sie den Blick hob, sah sie im Spiegel über dem Waschbecken ein bleiches, graues Gesicht mit Schatten unter den Augen. Die Haare hingen wirr und klebrig um den Kopf. Marissa starrte das Bild an. Wieder ein Spiegelbild. Diesmal real. Doch genauso fremd wie im Traum. Sie fing an zu zittern und ließ sich auf den weichen Badvorleger sinken. Zu kraftlos für Tränen. Zu kraftlos für Gedanken, die hinter ihrer Stirn Machtkämpfe ausfochten um von ihr wahrgenommen zu werden. Marissa hielt sich die Ohren zu, schloss die Augen. Gelehnt an die Kacheln der Badewanne hockte sie da mit angezogenen Knien auf dem Badezimmerboden und zitterte, dass ihr die Zähne aufeinander schlugen.
Als die Großmutter kurze Zeit später ihre Enkelin fand, war diese kaum ansprechbar. Apathisch und fieberheiß. Emilia war es kaum möglich, Marissa aus diesem Zustand zu holen und sie wieder ins Bett zu bringen. Irgendwie schaffte sie es dann, ihr die nassen, beschmutzen Sachen auszuziehen und ihr Gesicht und Oberkörper vorsichtig mit einem Waschlappen zu säubern. Zog ihr ein frisches Hemd über, während Marissa sie mit gläsernen Augen ansah. „Oma, es tut mir so Leid“, sagte sie tonlos und gab sich einen Ruck um sich mit Hilfe der Großmutter aufzurichten. Aneinander gestützt schafften sie den Weg ins Schlafzimmer, wo Marissa schwer ins Bett sank und einschlief.
Emilia stand minutenlang bewegungslos da. Blickte auf die Enkelin hinunter, sah ihr rotes Gesicht, das mühsame Ein- und Ausatmen, das unruhige Zucken der Glieder. Selber fühlte sie sich unendlich müde. Sie spürte, dass ihre Kräfte, körperlich und seelisch, nicht ausreichten um diesem Gefühls-Auf-und-Ab Herr zu werden. Schließlich war sie eine alte Frau, was ihr gerade jetzt besonders bewusst wurde. Nur noch ein paar Monate und sie würde ihren 80.Geburtstag feiern. Ob sie ihn wirklich feiern wollte, wusste sie allerdings nicht. Der Trubel, der damit zusammenhing war ihr schon im Vorfeld zu viel.
Sie dachte an Julius, an den letzten „großen“ Geburtstag, den sie zusammen gefeiert hatten. Schön war es gewesen, schön miteinander zu feiern. Zu zweit.
Es lächelte tief in ihr als sie daran dachte. Aber da war auch ein wenig Wehmut dabei. Zu zweit, dachte sie, haben wir so vieles geschafft. Zu zweit war alles so viel leichter, auch wenn es mal gerade alles anderes als leicht gewesen war. „Mit dir war es immer gut.“ Sie blickte auf das Bild des Mannes, der so viele Jahre mit ihr gewesen war, nahm es in die Hand und küsste die lachenden Lippen durch das kalte Glas des Bilderrahmens. Streichelte ihm über die wirren Haare und sah ihn dann vorwurfsvoll an. „Jetzt hätte ich dich sehr gebraucht.“ Er strahlte sie weiterhin schelmisch an, sodass ihr Herz sich weitete und sie das Bild an sich drückte. Und als ob ihr der geliebte Mann noch von weit her Kraft und Zuversicht schickte, fühlte sie sich mit einem Mal getröstet und gestützt. Du bist stark, Lia. Du schaffst es alleine.
Es war seine Stimme, die in ihrem Inneren klang und ihr Ruhe gab. Behutsam stellte sie Julius zurück an seinem Platz neben dem Bett, sodass er den Blick auf die kranke Enkelin richtete.
Dann ging sie leise aus dem Zimmer und stieg die Treppe hinunter. Es war immer noch früher Morgen. Gerade kurz nach sieben und draußen auf dem Gras hingen noch Tautropfen der Nacht. Die Sonne hatte sich noch hinter dem Hausdach versteckt aber es würde nicht mehr lange dauern, bis sie um die Ecke bog und ihre Finger nach den Glitzerperlen ausstreckte um sie aufzusaugen.
Kater Teo räkelte sich müde in seinem Korb und schaute nur flüchtig auf als Emilia ihm Milch und Futter hinstellte. „Schlecht geschlafen“, fragte diese ihn und beugte sich zu ihm um ihn hinter den Ohren zu kraulen, was er regungslos hinnahm. „Na, du bist ja wirklich nicht gut beieinander.“ Und leider nicht der einzige, fügte sie still bei sich hinzu.
Nach einer Tasse starkem Kaffee, griff sie zum Telefon und rief Dr. Schmidtmann an. Sie wusste, dass er früh auf war und hatte wirklich Glück, ihn gleich zu erreichen. „Ich komme so schnell ich kann“, versprach er.
Während sich Kater Teo letztlich doch gnädig über sein Frühstück hermachte, aß Emilia selber ohne wirklichen Appetit eine Scheibe Brot und trank lustlos schluckweise den Rest bitteren Kaffee. Dieser war zu stark geraten und die Milch konnte ihn kaum abzumildern. Schließlich schob sie den Becher beiseite, wobei sie mit diesem an das Schmuckkästchen stieß, das die Nacht auf dem Küchentisch verbracht hatte. Es wirkte sehr verloren in dieser Umgebung von Tellern und Tassen, Kaffeegeruch und Brotkrümeln.
Emilia nahm es behutsam in die Hand, drehte es hin und her, strich über die feine Verzierung. „Du bist genau wie Issa“, sagte sie zu dem Schmuckstück.
„ Fein und zart, aber auch robust und in dein Innerstes lässt du niemanden blicken.“
Sie hob es auf und stieg dann wieder die Treppe hinauf um nach der Enkelin zu sehen. Diese atmete schwer in den Kissen, warf sich unruhig hin und her. Als Emilia ihr die Hand auf die Stirn legte, zuckte sie zusammen. Julius beobachtete die beiden und Emilia gab ihm außer der Enkelin noch das Schmuckkästchen in Obhut.
*
Kurze Zeit später quietschen vor dem Haus Fahrradbremsen und Dr. Schmidtmann kam mit langen Schritten ins Haus. Er untersuchte die immer noch fieberschlafende Marissa und ließ sich dann von Emilia Kaffee einschenken. „Der ist richtig gut“, meinte er anerkennend. „Mal richtig grundschwarz.“
„Na, für meinen Blutdruck ist er wohl eher nicht so gut“, lächelte Emilia angestrengt, „wo mein Herz eh so aufgeregt ist.“
Der Arzt legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm. „Das ist verständlich, aber nicht nötig. Ich weiß zwar noch nicht, was diesen Fieberschub bei deiner Enkelin ausgelöst hat aber sie ist jung und kräftig. Sie wird sich bald erholen. Ich lasse dir von der Apotheke etwas herschicken, das gibst du ihr bitte dreimal am Tag. Sobald das Fieber gesunken und sie ansprechbar ist, sehen wir weiter. Ich würde gerne mit ihr in Ruhe in meiner Praxis sprechen, sobald es möglich ist. – Und du, solltest dich ausruhen. Kaffee ist wohl tatsächlich gerade nicht so empfehlenswert. Ich lasse dir noch ein pflanzliches Beruhigungsmittel da. Nimm es, bitte…“ Er sah sie dringlich an. Emilia nickte dankbar.
Er stand auf. „Ich muss leider weiter. In der Praxis warten schon ein paar kränkelnde Urlauber.“ Dann war er aus der Tür und verschwunden.
Zwei Stunden später fuhr das Pferdegespann mit Knut Niederbrück auf dem Bock vor. Dieser kletterte mit seinen kurzen Beinen behende hinunter und brachte Emilia sofort dazu in sich hineinzulachen als er betont breitbeinig und mit ungelenkem Diener die Lieferung der Apotheke überreichte. „Habe die Ehre, Madam“, krächzte sein kehliger Bass.
„Knut, du hast mir gerade noch gefehlt.“
„Ich weiß. Deshalb bin ich hier! – Was macht die kranke Deern?“
„Sie schläft.“ Dankend nahm sie das Medikament aus der Schachtel. „Ich weiß gar nicht, wie ich ihr das einflössen soll.“ Sie drehte die Tropfen unschlüssig hin und her. „Aber komm erstmal rein. Du hast eine Stärkung verdient.“
Knut grinste. „Das will ich meinen.“
Er trank seinen Belohnungsschluck, brachte Emilia wiederum zum Lachen und blieb noch eine Weile zur Unterhaltung da. Schließlich musste er sich wieder auf den Weg machen, salutierte mit komischem Ernst und war wieder auf und davon.
Emilia winkte ihm lächelnd nach. Die Begegnung hatte ihr gut getan, mehr noch als das Beruhigungsmittel des Arztes. Knut war schon so lange ein guter Freund. Mit Julius hatte er sich regelmäßig zum Schachspielen getroffen und war mit ihm manchmal stundenlang im Watt unterwegs gewesen. So unterschiedlich die beiden waren, äußerlich und von ihrer Herkunft, so ähnlich waren sie sich in vielen Denkweisen und Handlungen. Emilia schüttelte darüber mehr als einmal verwundert den Kopf. Aber sie sah diese Männerfreundschaft immer als Bereicherung. Nicht nur für Julius, sondern auch für sich selber, da dadurch eine willkommene Lebendigkeit ins Haus geweht wurde. Nach Julius‘ Tod hatte sie befürchtet, dass sich Knut kaum noch bei ihr sehen lassen würde. Doch das Gegenteil war der Fall. So oft er Zeit hatte, ließ er sein Pferdegespann den Weg durch die Dünen zu ihr finden und unterhielt sie mit seinem friesischen Humor. Dafür war sie vor allem in der ersten schweren Zeit dankbar, wo sie sich plötzlich in allem allein wiederfand. Das Haus war so leer und groß, das Bett so kalt, der Garten so einsam. Der Sessel neben dem Kamin eingefallen und die Kniedecke so hilflos.
Emilia war sich nicht sicher gewesen ob sie es schaffen würde, hier alleine weiter zu leben. So weit weg von der Umgebung zu Menschen. Das nächste Haus war über einen Kilometer entfernt gelegen. Zur Ortschaft benötigte sie mit dem Fahrrad etwa fünfzehn Minuten. Diese Abgelegenheit hatte sie und Julius so angezogen, die Ruhe und Ungestörtheit. Natürlich war ihnen immer bewusst gewesen, dass damit auch große Nachteile verbunden waren, zumal sie schon in fortgeschrittenem Alter hierhergezogen waren und immer klar vor Augen hatten, dass einer von ihnen irgendwann allein zurückbleiben würde. Dennoch war es für sie eine sichere Entscheidung gewesen, dieses Haus zu besitzen. Und Emilia war es sehr bald klar geworden, dass sie hierbleiben würde. Hierbleiben musste. Dies war ihr Ziel, ihre Heimat. Hier war sie glücklich. Glücklich mit ihm, der immer noch bei ihr war. Über sie wachte. Wie heute als sie sich so schwach in sich fühlte. Sie konnte hier nicht weg. Sie gehörte hierher.
*
Wie seltsam sich das anfühlte. Zu schlafen aber doch wach zu sein. Alles wahrzunehmen, was um einen geschah und doch nicht dabei zu sein. Die Hand auszustrecken und nichts zu berühren, zu rufen und nicht gehört zu werden. Und die Augen öffnen zu wollen ohne es zu können. Ein Gewicht drückte schwer auf ihren Körper, eine Hülle lag wie ein Kokon um sie herum, der Geräusche von außen dämpfte und ihren Blick trübte.
Sie sehnte sich danach, leicht zu sein, davonzufliegen von sich und ihren Gefühlsabgründen. Nicht mehr denken, nicht mehr fühlen. Einfach schweben, schweben, schweben. Sie atmete schwer und gierig alle Luft ein, die sie bekommen konnte, mehr und mehr bis sie voll war davon und nicht mehr atmen musste, ließ sich sinken in das Nichts und fing an Flügel zu bekommen. Sie schwirrte aus sich heraus, aus dem Zimmer, durch das Fenster in den Garten, über das Haus hinweg zum Meer. Sah von oben herab auf das Wellengeschäume, fühlte den Wind und schmeckte die Gischt. Wenn sie jetzt losließ, würde sie hineintauchen in die Wassertiefe und die See würde sie davontragen in die Freiheit.
Etwas zog sie davon fort, etwas rief sie zu sich mit dringlichem Klang. Rief einen Namen, den sie kannte. Wusste, er hatte etwas mit ihr zu tun. Ihr Ich, ihr Sein, ihr Selbst rief sie laut.
„Issa! Hörst du mich?“ Emilia beugte sich über ihre Enkelin, strich ihr die Haare aus dem Gesicht. „Issa, wach auf!“ Sie bat mit ihrer Stimme und ihren Händen, die sie ihr warm auf den Brustkorb legte und dort innehielt bis sie spürte, wie sich dort Lebensenergie sammelte, Marissa Atmung ruhiger wurde. Und schließlich waren da ein tiefes Luftholen und ein Seufzer von ganz weit unten mit dem Marissa ihre Augen öffnete und direkt dem Blick der Großmutter begegnete.
„Na, du“, meinte diese sanft. „Da bist du ja.“ Marissas Kopf schmerzte als sie zu nicken vorsuchte. Sie blinzelte aus verklebten Augenlidern und sagte leise: „Ich war immer da.“ Bevor sie wieder einschlief, ließ sie sich Tropfen einflössen, trank einen Schluck Wasser und entglitt in einen Schlaf, der sie traumlos davon trug.
Emilia bemerkte erleichtert die gelösteren Gesichtszüge der Enkelin auf dem Kissen. Sie war mit einem Mal unendlich müde und legte sich erschöpft auf die andere Seite des großen Bettes nieder um ein wenig auszuruhen.
Unbemerkt schlich sich eine Weile später Kater Teo die Treppe hinauf, sprang zu den Schlafenden ins Bett und kuschelte sich zwischen die Beiden.
*
Das Fieber sank, die Kopfschmerzen verschwanden und der Hals wurde wieder frei. Marissa erholte sich schnell. Nach ein paar Tagen war sie bereits in der Lage, nach unten zu gehen und sich zur Großmutter auf die Bank im Garten zu setzen. Ihr Gesicht, das so blass gewesen war, saugte sofort die Sonnenstrahlen auf und blühte rosig darunter hervor. Ihre Augen blickten klar in das üppige Grün des Gartens und hingen an den Farben der Blumen in den Beeten. Da sie es gar nicht mehr erwarten konnte, stimmt Emilia schließlich zu, zusammen mit ihr an den Strand zu gehen. Der Knöchel schmerzte kaum noch und Marissa traute sich, ihn wieder zu belasten. Sie fühlte sich in sich nur so merkwürdig schwach und durchlässig. Dr. Schmidtmann hatte Emilia beruhigt, dass sich alles wieder zurechtrücken würde. Es brauche einfach Zeit. Und ja, er würde Marissa wirklich gerne in der Praxis sehen.
Emilia hatte ihrer Enkelin dieses Anliegen weitergegeben, worauf diese genickt hatte ohne ein weiteres Wort dazuzusagen. Nach wie vor blieb Marissa verschlossen und ließ nicht erahnen, was sie fühlte und dachte. Wahrscheinlich brauchte auch das ihre Zeit. Emilia hatte Zeit. Zeit im Überfluss. Sie konnte warten.
Das Meer atmete zu ihnen hin mit überschäumender Lebenskraft. Die Wellen schossen mit der Flut in urgewaltiger Kraft zu ihnen ans Land. Griffen gierig nach ihnen, wenn sie sich zu nahe heranwagten. Emilia wich zurück. Marissa ging darauf zu. Ließ das Wasser an sich lecken und ziehen bis sie beinahe das Gleichgewicht verlor. Emilia wollte sie halten aber sie ahnte, dass sich Marissa ihr entziehen würde. Sie wollte das Wasserelement hautnah erleben. Wie schon immer zog es sie magisch an. So als sei es ein Stück von ihr selbst. Als sei sie daraus hervorgegangen. Sie stand mit geschlossenen Augen inmitten der Brandung, glückselig versunken.
Emilia beobachtete sie mit verwunderter Ergriffenheit. Dieses Wesen da im Wasser schien in einer völlig anderen Welt zu leben als die Marissa an Land. Als wäre sie eine andere Person. Entrückt, gestrandet. Und ganz Daheim.
Später tranken sie Tee auf der Bank im Garten. „Morgen fahre ich mit dem Fahrrad in den Ort. Ich muss mal wieder sehen, wie es da so ist. Und einiges erledigen. Ich würde mich freuen, wenn du mitkommst. Opas Fahrrad dürfte noch fahrtüchtig sein.“ Emilia sagte es ohne viel Hoffnung auf Resonanz. Sie sah aus den Augenwinkeln wie Marissa fest ihren Teebecher in den Händen hielt und scheinbar gar nicht gehört hatte, was die Großmutter sagte. Eine Zeitlang war nur die Sommerstille zu hören. Emilia schwebte mit ihr über den Rasen und ließ alles sein, wie es sein wollte.
Als sie dann die Stimme der Enkelin vernahm, sah sie überrascht auf. „Gut“, sagte diese. „Dann kann ich ja gleich zu Dr. Schmidtmann gehen.“
Emilia versuchte ihre glückliche Erleichterung zu verbergen und meinte leichthin: „Gute Idee. Und hinterher essen wir noch ein schönes großes Eis.“
*
Im Wartezimmer saßen ihr zwei ältere Frauen gegenüber, die sich in tiefstem Friesenplatt überhielten, sodass Marissa kein Wort verstand. Fasziniert lauschte sie eine Weile dem breiten Wortgefälle, ließ es dann wir ein Rauschen an sich vorüberziehen und lenkte ihre Gedanken zurück zu sich.
Ihr Aufbruch vor zehn Tagen lag lange zurück. Länger als die Tage an sich. Die Großstadt, das Studium und ihr Leben dort, waren schon so weit entrückt, dass sie kaum noch etwas in sich davon erkannte. Sie erinnerte sich noch, dass sie sich irgendwann von ihrer Zimmernachbarin im Studentenwohnheim verabschiedet hatte, die die Semesterferien in Leipzig bei ihrem Freund verbringen wollte.
Sie selber hatte keine konkreten Pläne gehabt. Lernen. Aber nicht zu viel. München im August geniessen, wo es so angenehm leer war und nur den Münchner gehörte. Freunde treffen. Verreisen eher nicht. Wohin hätte sie sollen, können, wollen. Bei der Vorstellung zu ihrer Mutter zu fahren, zog sich alles in ihrem Innern zusammen. Ihr Vater hatte sie längst schon eingeladen, zu ihm nach Berlin zu kommen. Doch da war auch diese Eltje, die sie nicht kannte und nicht kennenlernen wollte. Sie hatte sie auf einem Foto gesehen, das ihr Vater geschickt hatte. Eine blonde, schmale Frau mit langen Haaren und so blauen Augen, die durch das Bild in einer Intensität auf den Betrachter blickten als könnten sie ihn durchschauen. Marissa war unwohl geworden bei ihrem Anblick. Doch ihr Vater auf dem Bild schaute die Frau mit warmem Ausdruck an, sodass sie glauben mochte, die beiden seien glücklich.
Ein paar Tage ließ sie sich durch die freie Zeit treiben. Schlief lange, frühstückte spät - gerne auf ihrem winzigen Balkon, wenn das Wetter es zuließ. Las einen dicken, herrlich romantischen Liebesroman, räumte endlich ein paar Ecken in ihrem Zimmer auf, die sie lange erfolgreich in wohlmeinendem Dunkel gelassen hatte. Traf ein paar wenige Studienkollegen an der Isar oder im Englischen Garten, im Uni-Café. Viele waren nicht mehr da, verreist zu den Eltern, unterwegs mit Freund oder Freundin. Untergetaucht in den Urlaub.
Schließlich stand sie eines Tages auf und da war nur ein Nichts. Sie fühlte ein Vakuum um sich, das sie schonungslos bedrängte, die Luft hörbar machte und das Herz stolpern ließ. In der Nacht jagte sie ein panisches Gefühl angstgefüllt an das Fenster, raus auf dem Balkon.
Früh am nächsten Morgen packte sie eilig ein paar Sachen in ihren Rucksack, schaute im Internet nach den Abfahrtszeiten der Züge und war schon eine Stunde später auf dem Weg zum Bahnhof. Am Automaten zog sie sich die Fahrkarte und rannte gehetzt zum bereits warteten ICE Richtung Hamburg und Bremen. Sie hatte Glück und ergatterte einen freien Platz am Fenster. Bis zur Abfahrt blieben nur noch ein paar Minuten, die sie in angespannter Haltung verbrachte mit der unbegründeten Sorge, irgendetwas könnte sie noch davon zurückhalten. Als der Zug dann leise aus dem Bahnhof glitt und aus dem Gleisgewirr hinausfand, schließlich mehr und mehr an Fahrt gewann und die Landschaft zu einem zerronnen Bild verschwamm, entspannte sie sich, sank an das Sitzpolster und dämmerte davon. Von der Fahrt bekam sie kaum etwas mit, öffnete kurz die Augen als die Fahrscheine kontrolliert wurden. Gegen Mittag meldete sich ihr Magen unmissverständlich zu Wort. Im Bistro besorgte sie sich ein Sandwich und Wasser. Dann schlief sie wieder ihren Halbschlaf bis hin nach Bremen.
Der zugige Bahnhof empfing sie mit dem Gefühl, hierbleiben zu sollen. Sich nicht davonzuschleichen. Nicht an der Mutter vorbei zu huschen wie ein Dieb. Marissa blickte unsicher in die Gesichter der Menschen auf dem Bahnsteig. Doch niemand erkannte sie, niemand hielt sie auf und rief: Bleib hier. Trotzdem schaute sie sich immer wieder um als sie die Treppe hinunter stieg, den Gang entlang lief und schließlich durch die Bahnhofshalle hinaus auf den Vorplatz trat. Vorsichtig blieb sie dort stehen, ließ den Blick schweifen. Immer noch mit der Furcht, jemanden zu entdecken, der sie erkannte. Doch es wirbelten dort nur Menschen durcheinander, die die junge Frau im Bahnhofseingang nicht beachteten. Marissa atmete einen tiefen Zug Bremer Luft, sah zum Überseemuseum hinüber, wo sie als Kind immer wieder spannende Ausstellungen besucht hatte mit den Eltern, Großeltern – mit der Schwester. Wann war das gewesen? Sie hatte keine Zeit, sich lange mit den Gedanken daran aufzuhalten. Sie musste den Bus nach Bensersiel finden, der in wenigen Minuten abfahren würde. Er stand schon abfahrbereit da als sie ihn erreichte und war glücklicherweise nicht sehr voll. Sie setzte sich ganz hinten auf einen Fensterplatz und versank, sobald sich der Bus in Bewegung setzte, in eine Art Dämmerzustand.
Erst als sie endlich am Kai stand, die Fähre zur Insel vor sich sah, den frischen Seewind an ihren Haaren ziehen spürte, fühlte sie sich wacher. Die Zeit an Bord verbrachte sie ganz oben an Deck, obwohl der Wind da besonders zog und zerrte. Marissa blickte nach vorne über das Wasser, spähte zur Insel hin, die langsam immer näher kam und sie anzog wie ein Magnet. Sie kostete das Anlegemanöver bis zum Schluss aus und ging dann als letzte von Bord.
*
Dr. Schmidtmann kam ihr mit ausgestreckter Hand entgegen und schüttelte die ihre kraftvoll. Seine Augen suchten in ihrem Gesicht nach einer Reaktion als er sie herzlich begrüßte: „Schön, dass du gekommen bist.“
Marissa nickte nur leicht, mied den direkten Blickkontakt. Der Arzt ließ sich davon nicht irritieren und sprach weiter. „Du hast dich scheinbar erholt. Ich würde aber gerne noch ein wenig mit dir sprechen, hören wie es dir geht.“
Seine Stimme klang freundlich und ehrlich. Marissa spürte wie sich in ihr etwas löste. „Danke. Mir geht es gut.“
„Ich kenne dich ja gar nicht. Erzähl mir, was du so machst. Ich glaube, du studierst?“ Er ermutigte sie geduldig zur Offenheit. Lehnte sich in seinem Sessel zurück und grinste sie an. „Eine künftige Kollegin vielleicht?“
„Nicht Humanmedizin. Veterinärmedizin – 3.Semester.“
„Also eine Tierfreundin. Schön, spannend. Wie kam es dazu?“ Dr. Schmidtmann fragte nach, wollte immer mehr wissen. Und mit einem Mal hörte sich Marissa reden. Irgendwie öffnete sich ein Ventil in ihr, das Worte herausließ, die sich selbst nachliefen, immer schneller wurden, sich gegenseitig überholten bis sie ganz atemlos waren und drohten sich zu verzetteln. Die Begeisterung riss sie mit sich, schickte eine warmglühende Farbe auf ihr Gesicht und Bewegung in ihren Körper. Der Arzt sah und hörte das Gesagte und hörte und spürte noch viel mehr. „Du bist ja die geborene Rednerin“, warf er ein als Marissa schließlich langsamer wurde und die Worte nur noch vereinzelt hervorquollen. „Und scheinbar mit dem Tiermedizinvirus infiziert. Du wirst sicher eine wundervolle Tierärztin.“ Das sagte er schlicht und überzeugend, sodass es Marissa heiß im Gesicht brannte. „Leider habe ich jetzt nicht mehr Zeit, aber wir können gerne einen weiteren Termin ausmachen, damit ich noch mehr höre. Wie lange wirst du noch hier sein?“
Darüber hatte sich Marissa bisher keine Gedanken gemacht. Sie wollte nur an das Jetzt denken, das Hiersein genießen, mit allen Symptomen, die sich bemerkbar machten. Wollte das Meer inhalieren, die Luft trinken und den Sand schmecken. Die Insel erkunden, mit der Großmutter zusammen sein, reden und schlafen, Teo kraulen, Sonne tanken und frei sein.
„So lange es geht“, sagte sie jetzt und ging dann aus der Praxis mit einem Gefühl etwas gefunden zu haben.
Beim Eis essen mit der Großmutter war sie gelöst und gut gelaunt, lächelte manchmal still vor sich hin, redete dann wieder munter drauflos und löffelte genussvoll die kalte Süße voller Schokoladen-Himbeer-Vanille-Sahne-Seligkeit.
Emilia sah ihr belustig dabei zu: „Ich hoffe nur, dass ich dich nicht als nächstes von einem verdorbenen Magen kurieren muss.“
„Ach, nein, Oma. Jetzt ist es genug mit dem Kranksein. Ich möchte noch viel unternehmen…“ Marissa leckte genießerisch am Schokoladeneis auf ihrem Löffel, „…und“, setzte sie hinzu, „ansonsten gibt es ja Dr. Schmidtmann.“
„Der hat es dir wohl angetan“, mutmaßte Emilia.
„Ja, er ist sehr nett. Ich werde nochmal zu ihm in der Sprechstunde gehen. Er möchte noch einiges wissen.“ Sie tauchte ihren Löffel tief in die Eismasse. Emilia sah sie von der Seite an, wollte nicht denken, was sie dachte. Sie würde wachsam sein. Sehen und lauschen.
*
Eine beschwingte Energie durchfloss mit einem Mal die Tage und belebte den Rhythmus des Hauses. Kater Teo schaute mitunter irritiert der schnellen Marissa hinterher, die mit gesundem Knöchel und heilem Körper durch Räume und Garten lief, über den Dünenweg zum Strand eilte und erst Stunden später sonnendurchwärmt und wassergetaucht wieder erschien. Oft schwang sie sich auf das alte Fahrrad ihres Großvaters und erkundete damit alle Winkel der Insel, die sie ausfindig machen konnte. Erzählte dann abends glühend von den Eindrücken. Den stillen und den ungewöhnlichen. Von Beobachtungen des alltäglichen Lebens auf der Insel. Und manchmal erwähnte sie auch den Arzt, zu dem sie immer wieder in die Praxis ging. Emilia konnte sich nicht klar darüber werden, was sie davon halten sollte. Als sie Marissa fragte, was bei den Terminen so vor sich ging, sagte diese nur: „Wir reden. Ich rede.“
Augenscheinlich tat ihr dieses Reden gut, dennoch bestand Emilia eines Tages darauf, mitzukommen. Marissa fühlte sich sichtbar unbehaglich dabei und wollte keines Falls mit ihr zusammen ins Sprechzimmer gehen.
Timo Schmidtmann war überrascht statt Marissa, Emilia eintreten zu sehen. „Geht es dir nicht gut“, fragte er. „Geht es Marissa nicht gut?“
„Uns geht es beiden gut“, beruhigte Emilia. „Ich möchte nur etwas wissen.“ Die Art, in der sie das sagte, machte den Arzt beklommen, doch er atmete dagegen an. „Marissa ist doch wieder gesund, warum soll sie dann so oft herkommen. Sie sagt, ihr redet. Wie kann ich das verstehen?“
Timo Schmidtmann fühlte sich irgendwie ertappt. Die Frage hatte in ihm das angesprochen, was er sich selber fragte. Die Frage nach der Berechtigung für diese Gespräche. Er war Allgemeinmediziner, kein Psychotherapeut. Er war in erster Linie für die körperlichen Beschwerden seiner Patienten zuständig, für Psyche und Seele waren andere da. Obwohl das eine vom anderen manchmal nicht so einfach zu trennen war. Recht erklären konnte er sich aber nicht, was ihn dazu gebracht hatte, Marissa diese Gesprächstermine vorzuschlagen. Er hatte wohl instinktiv geahnt, dass es für sie wichtig war, sich einiges von der Seele zu reden. Merkte an ihrer fortschreitenden Lockerheit, dass es ihr gut tat. Und merkte auch, dass es ihm gut tat. Dass er sich auf diese Termine freute. Vielleicht zu sehr. Er wusste um die Gefahr, die persönliche Gespräche für beiden Seiten in sich trug, von Gefühlen, die unwillkürlich auftauchen. Soviel hatte er von Psychologie im Studium mitbekommen. Das war aber auch das reizvolle daran und die Entdeckung einer neuen Welt in der Persönlichkeit des anderen. Und damit auch in sich selbst.
Emilia wartete auf eine Antwort. „Ich verstehe auf was deine Frage zielt“, sagte er schließlich. „Und ich muss sagen, ich bin dir dankbar. Wir reden, das ist richtig. Das heißt, meist ist es Marissa, die auf meine Fragen und Anregungen eingeht und dabei Dinge anspricht, die sie bewegen. Ich habe das Gefühl, dass es ihr gut tut, ihr ein Bedürfnis ist. Und doch – natürlich ist es von meiner Seite eine Kompetenzüberschreitung. Ich weiß, dass sie bei einem Therapeuten besser beraten wäre und möchte ihr für die Zukunft auch empfehlen, sich an einen qualifizierten Kollegen oder Kollegin zu wenden. Ich spüre da etwas in deiner Enkelin, dass sich klären muss. Und wahrscheinlich braucht sie dabei Unterstützung. Ich wollte ihr mit meinem Angebot zeigen, dass es möglich ist, dass sie Hilfe haben kann und sie annehmen sollte, wenn sie sich ihr darbietet. Mehr sollte es nicht sein.“
Timo Schmidtmann blickte Emilia offen an. Diese nickte. „Ich weiß, dass du es gut meinst. Und ich denke auch, dass sie Hilfe braucht. Sie ist ein empfindsames Wesen, das schon viel durchlebt hat. In ihrer und somit meiner Familie ist viel Leid und Unglück gewesen. Viele liebe Menschen sind vorzeitig von uns gegangen. In der weit zurückliegenden Vergangenheit aber auch in der jüngsten.“ Emilia hielt inne, schluckte an einem Kloß in ihrem Hals und an einem Brennen hinter den Augen.
„Ich weiß, dein Mann…“
Emilia schüttelte den Kopf. „Nicht nur. Julius ist friedlich eingeschlafen. Meine Trauer um ihn ist ruhig. Nein. Ich hatte noch eine Enkeltochter. Sandrina. Marissas Schwester. Sie ist letztes Jahr gestorben…“ Ihr Hals verschloss sich und die Stimme verstummte tonlos. Sie atmete schwer in sich hinein, sah den mitfühlenden Blick des Arztes. „Ich fürchte, Marissa hat das noch lange nicht verwunden. Sie ist sehr bedürftig nach Zuwendung. Bitte gib Acht.“
„Danke, Emilia. Danke für deine offenen Worte. Und sei gewiss, dass ich achtsam bin und mit euch fühle. Ich weiß nicht, wie eure Familie mit diesem Schmerz umgeht, ob ihr darüber sprecht… aber das ist wichtig, redet miteinander. Rede mit Marissa. Sie braucht das.“ Er blickte sie nachdrücklich an. „Sie hat Vertrauen zu dir und liebt dich, sonst wäre sie nicht zu dir gekommen. Nutze das für euer beider Wohl, für das Wohl eurer Familie. Manchmal ist es leichter mit einem Fremden darüber zu sprechen doch es ist auch hilfreich sich den Nahestehenden zu öffnen. Ihr braucht euch alle. Sonst seid ihr allein und einsam. Geht aufeinander zu, dann wird vieles leichter.“
Emilia nickte nachdenklich, stand auf und trat zu dem Mediziner, der hinter dem Schreibtisch aufgestanden war. „Laß es dir gefallen“, sagte sie als sie mit den Händen seinen Kopf umfasste und zu sich auf ihre Höhe hinunterzog. Ihre Lippen berührten leicht seine Stirn. „Du hast mir sehr geholfen.“
Timo Schmidtmann verzog sein Gesicht zu diesem unwiderstehlichen jungenhaften Grinsen. „Mensch, Emilia – wenn ich nicht zu jung für dich wäre, müsste ich mich wahrlich in Acht nehmen.“ Er griff ihre Hand und hauchte einen Kuss darauf. „Ihr seid schon war besonderes, du und deine Enkelin.“
*
Auf dem Nachhauseweg waren beide sehr schweigsam. Marissa hatte ihre Großmutter kaum angesehen nachdem diese aus dem Sprechzimmer gekommen war und sie selber für ein paar Minuten hineinging. Keine von beiden sagte der anderen, was der Arzt mit ihr gesprochen hatte. Es war wie eine stille Übereinkunft, der Anderen Raum für Gedanken zu lassen. Ordnung in sich zu finden und Klarheit darüber, wie mit dem Erfahrenen umzugehen sei.
Sie fuhren langsam mit den Rädern nebenineinander her, ließen die Inselvegetation an sich vorübergleiten wie in einem Zeitlupenfilm, jede in sich versunken, fern von hier. Getragen von Empfindungen voller Widersprüche. Mit einem Mal jedoch beschleunigte Marissa das Tempo, sodass Emilia Mühe hatte hinterherzukommen. Immer schneller und schneller wurde sie, bis sie Emilia weit hinter sich gelassen hatte und diese Marissa nur noch als Bewegung am Ende des Weges erkennen konnte. „Fahr nur“, sprach Emilia vor sich hin in den Fahrtwind, der ihr die Augen tränen ließ. „Es ist gut.“
Marissa hatte keine Ahnung, was sie zu dem impulsiven Davonbrausen getrieben hatte. Wie von selber waren ihre Beine immer heftiger in die Pedale getreten, immer schneller und schneller, sodass sie das Gefühl hatte, sie müsse gleich davonfliegen. Weg von hier, weg von sich selber, weg von diesem Gedankengewimmel in ihrem Kopf, das sich nicht entwirren wollte, ihr nicht klar erscheinen ließ, was das alles zu bedeuten hatte. Dieses Gespräch vorhin in der Praxis. Dieses Ziehen in ihrem Inneren und das klopfende Stolpern in der Herzgegend. Sie musste es ganz schnell hinter sich lassen. Alles vergessen, vom Wind verwehen, vom Wasser wegspülen, von der Sonne verbrennen lassen. Aus ihr heraus löste sich ein Schrei gegen die dumpfe Enttäuschung, gegen den Schmerz, gegen die Erinnerung. Die an das Heute und die an das Gestern.
Sie fuhr stehend eine Wegsenkung hinunter, lehnte sich über den Lenker und schrie sich frei. Mit quietschenden Bremsen fuhr sie den Weg zum Haus der Großmutter hin, ließ das Fahrrad achtlos am Zaun stehen und rannte hinüber zu den Dünen, weiter hin zum Meer, das sie mit lauter Brandung empfing. Sie stoppte sich erst als das Wasser ihr schon bis zu den Knien reichte und sie keine Luft mehr hatte, gegen das Tosen des Meeres anzubrüllen.
*
Emilia dachte noch über die Worte des Arztes nach. Reden. Reden war heilsam. Natürlich wusste sie das, aber so wie in ihrer Familie von jeher nicht viel gesprochen worden war, war auch sie nicht unbedingt diejenige, die viel über das sprach, was sie bewegte. Eher war sie diejenige, die anderen zuhörte, anderen mit Rat zur Seite stand oder einfach nur da war, wenn sie gebraucht wurde. Schon in der Schulzeit war sie die beste Freundin bei Herzschmerz gewesen und in den schweren Krieg- und Nachkriegsjahren diejenige, die anderen Mut und Zuversicht vermittelte. Half mit Worten und Taten und stellte sich selber ganz hinten in die Reihe der Bedürftigen. Dabei drängte sie sich anderen nie auf, wartete bis diese zu ihr kamen und die Lasten vor ihr abluden. Säcke voll mit Tränen, Kummer und Leid. Zu viele manchmal, um sich dann noch den sorgsam verschnürten Seelenpakete der eigenen Familie zu widmen. Von ihren ganz persönlichen ganz zu schweigen.
In den Jahren des Wiederaufbaus fand sie ihr kleines Glück, baute mit Julius ein Haus, sah ihre Tochter Juliane aufwachsen. Es ging ihnen gut. Wie schnell war es zur wunderbaren Normalität geworden, sicher und geborgen zu sein. Ein Dach über dem Kopf zu haben, ausreichend jeden Tag zu essen und Kleidung, die nicht zusammengesucht, geflickt, aus alten Vorhängen und Decken zusammengeschneidert war, sodass sie wie Säcke am Leib hinunterhingen. Wie schnell hatte man sich in den Frieden des Tages geflüchtet um nicht mehr die Albträume der Vergangenheit zu sehen. Hatte sie verdrängt um neu anzufangen, wieder zu leben.
Und die Dankbarkeit für dieses neue Leben war unendlich. Die Freude, dass die neue Generation aufwachsen konnte ohne die Gräuel des Krieges, ohne Hungersnot und bitterer Kälte. Kinder waren ein Zeichen für eine neue Zeitrechnung. Ihnen würde es gut gehen. Ihnen ging es gut. Etwas anderes konnte gar nicht möglich sein.
Ein Traum, diese heile Welt. Äußerlich gesundete das Land, die Menschen erlebten Wohlstand und Wohlergehen. Doch war wirklich alles gut? Was war mit der Seele derer, die so viel erlitten hatten, dass es wohl nie in Worte gefasst werden konnte. Die unfassbaren, unendlichen Leidensgeschichten, die jede Familie in irgendeiner Form erlebt hatte. Niemand war ungeschoren davon gekommen. Niemand wirklich heil. Zuviel war in Schutt und Asche gesunken, zu viel gestorben und verloren.
Geredet wurde darüber kaum. Niemand wollte daran rühren, den Schmerz wiederaufleben lassen. Besser man bedeckte alles mit dem Bann der Vergessenheit. Ließ es ruhen, hüllte es mit Schweigen ein.
Emilia hatte auch viel geschwiegen. Die Gegenwart war so viel wichtiger, forderte so viel Aufmerksamkeit. Es gab kaum Zeit für Gedanken und Erinnerungen an die dunkle Epoche. Mitunter im Traum jagten Bilder durch ihr Gedächtnis und es gab Situationen, die ihr das Herz stocken ließen und den Atem. Das Geräusch eines mit Blaulicht dahinsausenden Krankenwagens oder der Probealarm der örtlichen Feuerwehr am Samstagmittag. Darauf reagierte ihr Körper mit Fluchtreflexen und Angstschweiß. Und auch das jährliche Feuerwerk an Silvester war für sie lange Jahre unerträglich. Wenn es soweit war, verzog sie sich in den abgeschlossensten Raum des Hauses und harrte auf das Ende der Knallerei. Die kleine Tochter kuschelte sich verschreckt an ihre Seite. Und selbst als bei Emilia die Symptome im Laufe der Zeit abflauten, blieb bei Juliane die Schreckhaftigkeit wenn es unversehens irgendwo ein lautes Geräusch gab, nach Rauch roch oder eine Sirene jaulte.
Lange hatte Emilia das auf die normale Ängstlichkeit eines Mädchens zurückgeführt, doch je älter sie wurde, erkannte sie Verhaltensweisen in der Tochter, die sie mehr und mehr an sie selber erinnerten. Sie selber als Kriegskind. Sollte es möglich sein, dass Juliane, die nie einen Fliegeralarm miterlebt hatte, sich nie in den Bombenschutzkeller hatte flüchten müssen, nie das Dröhnen der Tiefflieger gehört hatte, etwas davon in sich trug. Ein Erbe von all dem Grauen, das sie, ihre Mutter, fern von ihr zu glauben meinte.
Und die merkwürdigen Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen. Waren auch das Symptome eines ungewollten Erbes?
Und wieso fand die Tochter kein privates Glück? Sie tat sich schwer mit Freundschaften, Beziehungen funktionierten nicht, sie war eine Einzelgängerin mitunter sehr unnahbar, wortkarg, in-sich-gesenkt.
Ein Erbe vielleicht auch das – entsprungen aus der ostpreußischen Linie der Familie, in der nie viel gesprochen wurde, in der jeder seine Gedanken im Kopf mit sich herum trug, still. Ohne Bedürfnis sich nach außen hin mitzuteilen.
Das lag nicht in ihrer Natur, das war nicht üblich. Und niemand schien etwas zu vermissen. Durch ihren Vater war Emilia mit dieser Wortkargheit sehr vertraut, hatte diese immer als gegeben hingenommen und ohne groß zu hinterfragen mit- und weitergelebt. Durch Julius hatte sie erfahren können, dass es durchaus mehr gab als Schweigsamkeit. Doch die Kunst ein Gespräch zu führen, sich mitzuteilen, wurde ihr dennoch nie wirklich lebbar.
Emilia wurde es immer klarer, wie wichtig dies gewesen wäre. Wie wichtig, zu erzählen, zu fragen, zuzuhören. Nicht mit Fremden, sondern denen, die so nah waren und doch so weit weg. Sie hatte es nicht gesehen. Wollte einfach nur leben ohne Probleme und Not. Und das war ja auch so gewesen. Äußerlich zumindest. Sie hätte viel darum gegeben, das jetzt noch nachzuholen. In die Vergangenheit zu reisen, sich mit Julius und der Tochter an den Tisch zu setzten und auszusprechen, was so wichtig war. Dafür war es jetzt zu spät. Doch scheinbar hatte die Fügung ihr eine Chance zugespielt, dennoch ein wenig von dem Versäumten nachzuholen, etwas gutzumachen. Es konnte kein Zufall sein, dass Marissa hier war und Ungesagtes so ausdrückte, wie es ihr möglich war. Abseits der Wörter. Aber doch unmissverständlich durch ihre körperlichen Zeichen.
Emilia wusste nicht ob sie es können würde, aber sie wusste, es mussten Worte zum Sprechen gebracht werden. Sie würde einen Weg finden müssen, um das auszudrücken, was scheinbar gehört werden wollte.
*
Am nächsten Tag regnete es. Der erste Regen seit Wochen. Die Natur brauchte ihn dringend, hatte aber Mühe die vielen Mengen Wasser so schnell aufzunehmen. Rasch bildeten sich Pfützen und kleine Lachen, die auf dem ausgetrockneten Boden liegen blieben. Von den Bäumen und Sträuchern tropften dünne Wasserfäden hinunter und die Blüten und Blätter der Blumen neigten sich tief unter der ungewohnten Schwere. Trotzdem schien ein Aufatmen durch das matte Grün zu gehen, das sich vollsaugte für eine neue Frische.
Emilia, die wie immer früh aufgestanden war, schaute von der offenen Terrassentür auf den frisch gesprengten Garten. Mitunter wehte ein Windstoß Regentropfen zu ihr hin und benetzte ihr Gesicht. Das tat gut. Es kühlte ein wenig ihre Unruhe, die sie nachts nicht recht hatte schlafen lassen. Zuviel war ihr noch im Kopf herumgegeistert. Marissa hatte sich ohne Erklärung wieder in das Zimmer mit den Dachschrägen verzogen, die Tür geschlossen und wortlos zu verstehen gegeben, dass sie nicht gestört werden wollte. Gestern war nicht der Zeitpunkt gewesen, das Schweigen, das zwischen ihnen herrschte, aufzulösen. Ihr selber war nicht nach Reden zumute gewesen, doch sie würde den heutigen Tag dazu benutzen, der sie nach innen zwingen würde. In jeder Hinsicht.
Noch bevor Marissa hinunterkam, stellte sich Emilia an den Herd und kochte deren Lieblingsnachspeise. Die Früchte dazu, rote Johannisbeeren, Brombeeren und ein paar Himbeeren, die für sie nach Kindheit schmeckten, hatte sie gestern noch von den eigenen Sträuchern im Garten gepflückt. Es dauerte nicht lange bis die rote, sämige Masse im Topf hochblubberte und schließlich dickflüssig in der großen, gläsernen Schüssel auskühlte.
Kater Teo sah begehrlich auf das Treiben der alten Frau und maunzte nachdrücklich. Aber sie schüttelte den Kopf: „…das ist nicht für dich.“ Sie schob ihm ersatzweise frischgeschnittene Fleischstücke zu, über die er sich voller Hingabe stürzte. Emilia lächelte. „Kleiner Fresssack.“
Als es auf der Treppe knarrte, drehte sie sich überrascht um. „Du bist schon auf?“ Sie sah die Enkelin fragend an. „Es ist doch noch früh.“
Marissa schlurfte in den alten Pantoffeln des Großvaters zur Küchenbank, setzte sich mit angezogenen Beinen darauf. Ihre Hände vergrub sie in den langen Ärmeln ihres Pyjamas. „Der Regen hat so laut auf’s Fenster geprasselt.“ Sie gähnte. „Und ich konnte eh nicht gut schlafen.“
„Ich auch nicht“, antwortete Emilia. „Hier – magst du den Topf auslecken. Ganz frisch gekocht.“ Sie stellte ihr den Kochtopf auf den Tisch, in dem noch Spuren der Nachspeise vorhanden waren. Marissa steckte ihren Finger hinein. „Rote Grütze. Wie lecker – und noch warm. Zum Frühstück hatte ich die noch nie.“ Mit Wonne löffelte sie die Beerengrütze in sich hinein. „Hm – die kannst nur du so lecker kochen.“
Emilia lächelte und sah zufrieden, wie sich Marissas Lippen in kürzester Zeit rotgefärbten und auf deren Gesicht gleichzeitig ein freudiges Grinsen ausbreitete. „Tut mir Leid, dass ich gestern so abgedampft bin“, kam es dann von den roten Lippen der Enkelin, „ich musste einfach…“
„Schon gut, Issa. Ich verstehe das. Irgendwie ist so viel passiert seit du hier bist. Und überhaupt...“ Emilia machte eine unbestimmte Handbewegung, die alles sagte und nichts. „…ich würde dir nachher gerne etwas zeigen und auch erzählen, wenn du willst. Heute ist, denke ich, eh nicht der Tag für Außenaktivitäten.“
„Nein, wohl nicht. Nicht mal Teo wagt sich vor die Tür.“ Der Kater war nach seinem Mahl leise durch die Küche geschlichen und neben Marissa auf die Bank gesprungen, augenblicklich schnurrte er zufrieden als Marissa ihm leicht am Hals kraulte. „Du hast es gut“, flüsterte sie ihm ins Ohr.
*
In die Wohnstube war es immer ein wenig dunkel, da die kleinen, milchigen Fenster nicht viel Licht hereinließen und durch das heutige Regengrau, erschien der Raum nur aus einer Ansammlung dunkler Schatten und Umrisse zu bestehen, die sonst wohl Möbelstücke, Kissen, Decken, Bücher und Bilder waren. Emilia knipste die alte Stehlampe neben dem Sofa an, doch ihre Glühbirnen reichten nicht aus, die dunkle Umgebung etwas zu erhellen. Als sie den Leuchter an der Decke einschaltete wurden die Konturen der Gegenstände endlich klarer und eindeutiger. „Wir könnten beinahe Feuer machen. Irgendwie ist es heute recht ungemütlich“, meinte Emilia und war drauf und dran, sich am Kamin zu schaffen zu machen. Aber Marissa schüttelte den Kopf. „Nein, lass nur. Hier auf dem Sofa ist es gemütlich. Wir haben ja Decken.“ Sie beobachtete wie die Großmutter scheinbar planlos hin und her lief, so als wüsste sie nicht, was sie eigentlich wollte. Als ob sie etwas hinauszögerte, was ihr schwerfiel. Marissa überkam eine flatternde Unruhe im Bauch. Was wollte sie ihr zeigen, was erzählen? Und wollte sie, Marissa, überhaupt etwas gezeigt bekommen, etwas hören? Mit einem Mal hatte sie den Impuls aufzuspringen und davonzulaufen. Das Verhalten der Großmutter irritierte sie und machte sie unsicher.
„Was ist, Oma? Was suchst du?“ Mit der ausgesprochenen Frage übertönte sie das Gefühl in sich, gab sich Halt durch den Klang im Raum. Scheinbar schien Emilia sich dadurch auch wieder zu fassen. Atemlos ließ sie sich neben der Enkelin auf das Sofa sinken. „Ach, Issa. Ich suche den Anfang.“
„Den Anfang?“ Marissa sah sie verständnislos von der Seite an. „Welchen Anfang?“
„Den Anfang zu der Geschichte. Deiner, meiner, die deiner Mutter, deines Großonkels. Unserer Geschichte.“ Erschöpft lehnte sie sich zurück an das Rückenpolster des Sofas. „Es ist nicht leicht…“
„Aber ich kenne doch unsere Geschichte“, meinte Marissa, „ich kenne euch alle. Uns.“ Noch während sie das sagte, merkte sie in sich viele unzählbare Fragezeichen auftauchen. War es wirklich so? Kannte sie die Familie? Und vor allem, kannte sie sich?
„Möglich“, nickte Emilia. „Du kennst uns so, wie du uns jetzt siehst. Du weißt, dass wir eine Familie sind. Du kennst unsere Namen und Gesichter und du hast durch die eine oder andere Erzählung erfahren, was jeder früher getan und erlebt hat. Doch du und auch ich, wir alle, wissen eigentlich nichts von dem wirklichen Ich des anderen, von seinen Gefühlen, von seinem Seelenleben. Darüber wurde nie viel gesprochen. Doch das hätten wir tun sollen. Schon längst. Es gab und gibt so vieles, was ausgesprochen gehört. Weißt du, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so wichtig ist, Gefühle zu äußern, zu zeigen, zu benennen. Doch gestern nach meinem Gespräch mit Timo Schmidtmann ist es mir überaus klar geworden. Schon allein deshalb, weil ich mir sehr wünsche, dass es dir gut geht. Dass es auch deiner Mutter gut geht. Uns allen. Ich mache mir Sorgen. Mir tut es so sehr weh zu sehen, wie sich deine Mutter quält und du... “ Emilia hielt atemlos inne, ihr blieben die Worte im Hals stecken, der voll war mit Herzklopfen. Sie nahm Marissas Hand zwischen ihre beiden Hände, verharrte mit ihr in schweigender Unbeweglichkeit. Um sie herum schwirrte die Luft voller unausgesprochener Worte und Empfindungen, sausten durch den Raum in immer schnellerem Tempo bis sie sich selbst eingeholt hatten und vor den beiden auf dem Sofa haltmachen. Ein leiser wortloser Laut hing da vor ihnen, entwichen aus dem Mund der Enkelin. Vom Kaminsims aus sahen stumme Gesichter der Vergangenheit zu ihnen herüber. Eine Zeitlang beobachteten sie die Nachfahren, die da eng beieinander saßen und ließen ihnen den Raum, den sie brauchten um sich und einander zu finden in einer Ruhe der Geborgenheit. Doch dann wurden sie beweglich in ihren schmalen Bilderrahmen, die sie einzwängten und beengten, sie zum Stillhalten brachten. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Einige von ihnen waren schon über etliche Jahrzehnte in ihren engen Behältnissen gefangen und sehnten sich nach Luft und Freiheit, nach Aufmerksamkeit und Beachtung.
Emilia sah es ihnen an, wie sie am liebsten laut gerufen hätten: „Holt uns hier raus! Wir sind auch noch da. Wir gehören dazu!“
„Ist gut“, beruhigte sie die Ahnen im Stillen, „ihr kommt schon zu eurem Recht. Habt noch ein wenig Geduld!“
Marissa hob ihren Kopf und richtete sich auf. „Mit wem sprichst du denn da?“ fragte sie verwundert ihre Großmutter und schaute sich suchend um.
„Oh, habe ich laut gesprochen?“ Emilia lachte verhalten. „Sieh dort auf dem Kaminsims. Unsere Verwandten. Alte und junge. Alles Ahnen der Familie.“
Sie stand auf und trat zu den alten Herrschaften, die auf den Bildern fast durchwegs noch jung und gutaussehend waren. Manche schauten sehr streng, hatten sich für die Fotografie extra steif und gerade in Pose gestellt. Einige lächelten vorsichtig, wirkten aber auch sehr unbeweglich vor der Linse des Fotografen. Irgendwie ähnelten sie sich alle in ihrer Haltung und dem Ausdruck.
Auffallend war eine bemerkenswert hübsche junge Frau mit schwarzen, strengzurückgenommen Haaren, gerader Nase und hohen Wangenknochen. Ihre Augen blitzen vergnügt und ungeniert in diejenigen ihres gegenüber als ob sie sich nur mit Mühe das Lachen verkneifen konnte. Marissa sah sie sich lange an, nahm die Fotografie dann vorsichtig vom Sims. „Sie war bestimmt nett und lustig. Ich hätte sie gemocht!“
„Ja, sicher“, nickte Emilia. „Das ist meine Mutter, deine Urgroßmutter. Sie hieß Mathilda und war als junges Mädchen sehr lebenslustig. Aber das Foto hast du doch schon mal gesehen und die anderen auch, nicht wahr?“
Marissa zuckte mit den Schultern. „Nur mal so, nicht wirklich.“
„Na ja, was interessiert ein junges Ding wie du auch die Vergangenheit.“ Emilia nahm das Foto ihrer Mutter sanft in die Hände und strich den Staub vom Rahmen. „Ich habe mich früher auch nicht viel darum gekümmert, aber alle diese Personen gehören zu uns. Sie sind ein Teil unserer Identität und haben uns viel von sich in unser Leben mitgegeben. Gutes und weniges Gutes. Schönes und Hässliches. Geschichten und Erinnerungen.“
„Ja, ich weiß.“ Marissa blickte von einem Bild zum nächsten, sah allen Verwandten in die Augen, suchte nach Gemeinsamkeiten und Erkennen. Dabei mied sie ein Foto, versuchte ihm auszuweichen, darüber hinwegzugleiten mit raschen Blick. Doch es haftete in ihren Augenwinkeln und wollte genauso wie die anderen ihre Aufmerksamkeit.
Emilia spürte, wie schwer es ihrer Enkelin fiel, dieses Foto anzusehen. Doch sie würde es irgendwann tun müssen. Also warum nicht gleich. Sie nahm es vom Sims, wo es zwischen den Schwarzweißfotografien als einzige Farbaufnahme wie ein bunter Vogel herumflatterte.
Es zeigte zwei Mädchen von etwa 10 und 12 Jahren. Eine blond, eine etwas dunkelhaariger, die eine etwas größer als die andere, die dafür das weichere, sanftere Gesicht hatte. Sie lächelte wie eine Märchenfee über den Bildrand hinaus, schien gar nichts wahrzunehmen, was um sie war und schwebte scheinbar traumverloren vor sich hin. Ihre langen hellen Engelhaare fielen ihr in weichen Wellen auf die Schulter und kringelten sich anmutig an den Spitzen. Das größere Mädchen neben ihr stand aufrecht da, von der Haltung her ungeduldig, wann sie wieder davonrennen könne. Ihre Haare waren kürzer und wilder als die ihrer Schwester und schienen wahllos drauflos zuwachsen. Ihre Augen blickten unverwandt in die Kamera, geradeaus und direkt. Fordernd.
Dennoch sahen sich beide Mädchen sehr ähnlich. Irgendwie hatte man den Eindruck, dass sich beide bemühten, sich so gut es eben ging, von der anderen zu unterscheiden und abzusetzen. Es war als lebten sie beide in unterschiedlichen Welten, auch wenn sie zweifelsohne aus derselben Quelle entsprungen waren.
„Ihr beide“, sagte Emilia leise. „Issa und Ina…“ Sie hielt das Bild vorsichtig der Enkelin hin, die erst eine abweisende Bewegung machte, doch schließlich nahm sie es entgegen. Hielt es lange wortlos mit angehaltenem Atem und zugeschnürter Kehle. Emilia sah die verkrampften Hände, die das Bild hielten, und den einsamen Tränentropfen, der auf das Glas fiel und schließlich langsam daran hinunterrann. Sie ließ den Schwestern Zeit für sich, wartete ob eine von ihnen sprechen wollte. Doch sie blieben still. Alle. Die beiden auf dem Foto. Die eine alleine hier auf dem Sofa. Sie würden miteinander reden, das spürte sie. Nur nicht jetzt. Nicht hier. Es war gut für den Augenblick, genug für die Enkelin, die nach einer Weile still mit dem Bild in der Hand aufstand und es zurückstellte zu den Ahnen. Ihr Gesicht war ruhig als sie sich zur Großmutter umwandte und ihr leicht entgegenlächelte.
Erleichtert lächelte Emilia zurück. Sie war sich sicher, dass jetzt der richtige Moment war. „Ich würde dir gerne etwas geben“, sagte sie hin zu Marissa, die ihre Großmutter dann neugierig beobachtete, wie diese zum Schrank mit den alten Schätzen ging und dort die Schublade ganz unten aufzog. Sie musste sich tief bücken, was ihr merkbar schwerfiel, aber sie lehnte Marissas Hilfe ab. „Nein – es geht schon. Ich will es dir selber geben.“ Endlich erhob sie sich mühsam. In der Hand hielt sie eine Schachtel mit goldenen Emblemen verziert, die diese als ehemalige Pralinenschachtel enttarnten. Emilia schüttelte gleich den Kopf als sie merkte, dass Marissa etwas Süßes erwartete. „Nichts zum Naschen“, lachte sie. „Etwas für das Erinnern und für das Ich. – Komm, setz dich.“ Sie klopfte auf die Polster neben sich auf dem Sofa, auf das sie sich schwer atmen hatte fallen lassen. „Ich zeig dir jetzt etwas.“ Sie nahm den Deckel von der Schachtel und einen Packen zusammengebundener Briefumschläge heraus. Diese hielte sie sekundenlang fest, bevor sie sie zur Seite legte. „Nein – erst das hier“, meinte sie und griff nach einem dicken, stark abgegriffenen Buch. „Die Aufzeichnungen meiner Mutter“, sagte sie mehr zu sich als zu ihrer Enkelin. „Während des Krieges hat sie darin alles festgehalten, was sie erlebt und bewegt hat. Geschichten von uns allen, unserer Evakuierung… Da drinnen stehen ein paar Dinge, die so niemand weiß. Aber auch Daten und Fakten von Zeiten, die ich nicht gerne erinnere…“ Sie hielt die Luft an bevor sie weitersprach: „…ich möchte, dass du es liest. Vielleicht kann es dir helfen, einiges besser zu verstehen.“
Auch Marissa hielt jetzt die Luft an. “Bist du sicher? Das ist doch sehr persönlich. Du kannst es mir doch auch erzählen.“
Emilia schüttelte den Kopf. „Nein. Erst habe ich es vorgehabt. Aber ich kann das nicht. Ich war noch nie eine große Erzählerin. Nein – lies es nur. Ich möchte es. Und diese hier“, sie zeigte auf den Packen Briefe, „die haben dann noch Zeit bis später.“
Marissa hielt das Buch unsicher in der Hand, fuhr mit den Fingerspitzen leicht über den fleckigen über die Jahre mitgenommenen Einband, versuchte dem nachzuspüren, was darin enthalten war.
Sie schaute zu der alten Frau hinüber, die in die Küche gegangen war um das Mittagessen vorzubereiten und blickte dann wieder auf das Buch. Was hatten dieses und die graugewordene Frau gemeinsam? Für sie war die Großmutter immer Oma gewesen. Natürlich kannte sie ihren Vornamen, wusste, dass Emilia einmal jung gewesen war, ein Kind - aber irgendwie schien es unmöglich die Vorstellung mit der Oma in Verbindung zu bringen. Als wären sie zwei verschiedene Personen. Möglich, dass es tatsächlich so war. Eine junge und eine alte Emilia. Und doch gehörten sie zusammen, die eine konnte nicht ohne die andere existieren. Wie seltsam, dass eine Person so viel sein konnte. Sich äußerlich und innerlich wandeln und dennoch immer dieselbe blieb. Ein Mysterium von unendlicher Weite. Alles war eins und gehörte zusammen. Werden und Vergehen. Blühen und Verwelken. Freude und Trauer. Licht und Dunkel. Tag und Nacht. Vergangenheit und Gegenwart. Ich und Du. Träumen und Wachen. Liebe und Schatten. Ebbe und Flut…
Sie, Marissa, war auch mehr als nur eine Person. Das spürte sie in diesen Tagen nur zu deutlich. Manchmal war es für sie mehr als schwierig damit zu Recht zu kommen, sich auf den Anteil ihres Charakters einzulassen, der gerade in den Vordergrund drängte, beachtet werden wollte, obwohl sie selber diesen in dem Moment nicht gerne begegnen wollte. Aber scheinbar hatten alle ihre Ich-Anteile ein Eigenleben, wollten gelebt und gespürt werden. Vielleicht war es am einfachsten, das hinzunehmen, sich nicht dagegen zu sträuben. Schließlich war letztlich ja alles sie.
Der Gedanke beruhigte sie auf eigentümliche Weise. Befreite sie von einem Druck in ihrem Inneren. Sie lehnte sich tiefer in die Polster des Sofas und spürte wie sich ihre Verspannung löste, die Muskeln locker wurden und ihr Kopf frei. Sie hörte auf das starke Prasseln des Regens, der von draußen gewaltig gegen die Fenster klopfte. Es klang fast wie das Rauschen des Meeres. Und das ewige Kommen und Gehen der Wellen. Das Geräusch lullte sie ein und sie sank in einen Zustand zwischen Schlafen und Wachen. Angenehm eingehüllt von Wärme und Ruhe. Sie lag mit geschlossenen Augen da und sah hinter ihren Lidern Licht und Schatten in wechselnder Folge hin und her schweben.
Die Stimme der Großmutter, die sie zum Essen rief, holte sie aus ihrem Schwebezustand. Als sie sich aufsetzte, merkte sie, dass ihre Hände die ganze Zeit das Geschichtenbuch gehalten hatten. Der Umschlag war warm und weich geworden durch die intensive Berührung. Behutsam legte sie es beiseite, wickelte sich aus der Decke, in die sie sich eingehüllt hatte und stand auf.
Lesen würde sie später darin und Bekanntschaft mit der unbekannten Emilia schließen. Und all den anderen.
*
Nach dem Mittagessen, das für Marissa mit einer mächtigen Portion Roter Grütze mit Vanillesauce endete, zog sich Emilia für einen ausgiebigen Mittagschlaf zurück in ihr Zimmer. Marissa war nicht müde. Gerne wäre sie hinausgegangen aber er regnete immer noch recht stark. Versuchsweise öffnete sie die Hintertür und blickte über die Terrasse hin in den Garten, der sich unter der Regenmenge duckte. Bäume und Sträucher waren hinter einem großen Tropfenvorhang versteckt. Irgendwie schienen sich die Pflanzen aneinander zu lehnen um sich gegenseitig Schutz zu bieten. Die Luft roch würzig und frisch und es tat gut, davon einen tiefen Atemzug zu nehmen. Am Meer würde es sicher richtig spannend sein. Marissa stellte sich die graue See mit hohen Wellentürmen vor, die sich gegenseitig überschwappten. Sie spürte beinahe die Nässe von Regen und Meeresgischt auf dem Gesicht und war drauf und dran, sich dahin aufzumachen. „Was meinst du Teo“, fragte sie den Kater, der neugierig seine Schnauze durch die offene Tür gesteckte. In dem Moment wehte eine Böe Regen zu ihnen herüber, sodass beide von der Tropfendusche getroffen, zurückwichen. Der Kater maunzte empört, zog den Schwanz ein und verschwand in Richtung Korb, wo er sofort das Wasser von sich leckte. Marissa lachte. „Na – ist wohl doch keine so gute Idee.“ Sie schloss ergeben die Tür und blickte unschlüssig um sich. „Und nun?“ Die Frage galt eher ihr selber als dem Kater und eigentlich wusste sie die Antwort. Es zog sie auf das Sofa – hin zu dem schmutzig-grünen Buch, das dort lag und darauf wartete, gelesen zu werden. Jetzt war die Gelegenheit. Aber sie zögerte. Irgendwie war da eine Scheu in ihr, die Seiten aufzuschlagen und das zu lesen, was ihre Ur-Großmutter vor vielen Jahren ihnen anvertraut hatte.
Aber natürlich war sie neugierig. Und die Großmutter wollte ihr damit etwas sagen, ihr helfen zu verstehen, wie alles gekommen war, wie es jetzt war und was daraus noch entstehen konnte. Vielleicht, das war die Hoffnung, die sich in ihr regte, würde es ihr helfen, den Weg zu finden, der sie zu sich selber führte. Zu der Marissa, die sie wirklich war.
Um ihrer Aufregung Herr zu werden, setzte sie Wasser auf und füllte sich aus der Teedose mit dem japanischen Muster grünen Tee in die kleine Teekanne, die sie immer im Gebrauch hatte, wenn sie hier zu Besuch war. Während sie das Wasser abkühlen ließ, stellte sie schon die passende Tasse zur Kanne auf den Tisch neben dem Sofa, goss dann den Tee auf. Zwei Minuten später ging sie mit der Kanne in der Hand in die Wohnstube, schenkte sich Tee ein und ließ sich dann einwickelt in die warme Decke in der Sofaecke nieder.
Das Geschichtenbuch lag neben ihr und blickte sie auffordern an. Als sie es aufnahm, vergewisserte sie sich mit einem Blick zu den Ahnen auf dem Kaminsims, das es in Ordnung war. Es konnte Einbildung sein, aber sie hatte den Eindruck, Urgroßmutter Mathilda lächelte ihr zu.
*