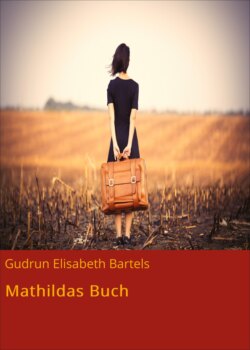Читать книгу Mathildas Buch - Gudrun Elisabeth Bartels - Страница 9
Emilia
ОглавлениеBeim Abendessen war Marissa schweigsam. Nachdenklich saß sie auf ihrem Stuhl und schien kaum wahrzunehmen, was sie aß. Emilia beobachtete ihre Enkelin forschend, suchte ihren Blick, der ihr vielleicht Aufschluss darüber geben konnte, was sie beschäftigte. Doch Marissa sah durch sie hindurch wie durch Glas. Emilia schmunzelte als sie ihr Tee nachschenkte, ohne dass es eine Reaktion hervorrief und sie auch dann nicht aufblickte als sie das letzte begehrte Stück Ei vom Teller nahm.
„Issa – wo bist du denn?“ Emilia winkte schließlich ausladend mit den Händen um auf sich aufmerksam zu machen. Ein Zucken ging durch den Körper der Enkelin und ihr Blick wurde langsam klar. „Oh. Ich bin da. Aber, na ja…“ Sie unterbrach sich. „Entschuldige Oma, ich habe an damals gedacht.“
Emilia nickte. „So sah es aus. Du warst ganz weit weg.“
„Es ist für mich so schwer vorstellbar, wie ihr habt leben können. Mit dieser ständigen Gefahr, mit dieser Angst.“
„Ja – das ist wohl unvorstellbar. Und ich weiß es eigentlich auch nicht, wie wir es geschafft haben. Wir mussten. Wir hatten keine andere Wahl. Das ist wohl die Erklärung.“
„Hattet ihr denn überhaupt noch so etwas wie ein ‚normales‘ Leben?“
„Einen Alltag, meinst du? Nun ja, so normal er damals eben war. Wir Kinder sind ja noch eine Weile zur Schule gegangen, die Erwachsenen zu ihrer Arbeit, so lange es irgendwie ging. Man hing an diesen alltäglichen Dingen, an der Normalität, wollte sie mit Macht festhalten. Ich bin auch oft noch zu meinen Großeltern rausgefahren. Mein Großvater holte mich ab und wir fuhren mit der Straßenbahn über die Bornholmer Straße bis Gesundbrunnen. Wenn ich über Nacht blieb, bin ich bei Alarm mit ihnen in den Keller gegangen. Ich weiß bis heute nicht, wie meine Mutter das hat zulassen können. Dass sie mich mit der Ungewissheit gehen ließ, dass vielleicht etwas Schlimmes passieren könnte, wir uns verlieren.
Aber wahrscheinlich war auch das ein Teil der gewollten Normalität. Dass die Großeltern ihre Enkel zu Besuch haben wollten und so tat man es. Ich fand das immer schön dort zu sein. Manchmal kam Nikolas mit, aber ich glaube, er hielt sich schon für sehr groß und wollte unsere Mutter nicht so viel allein lassen. Er war ihr Beschützer und wachte eifersüchtig über sie. Ach ja, Nikolas…“
Emilia verstummte von einem Moment zum anderen. Marissa merkte, dass es ihr schwerfiel weiterzusprechen. Da war so viel, was verborgen war, was empor wollte ans Licht. Vielleicht war es aber einfach zu viel. Zuviel für die Großmutter, die doch so alt geworden war und jetzt so ruhig und glücklich lebte. War es recht, sie darin zu stören? Marissa wurde unruhig. Was war da jetzt in Bewegung geraten, was brach da auf? Sie merkte an sich selber, wie ihr das alles nah ging. Ihr, die sie so viele Jahrzehnte entfernt von dem zur Welt gekommen war, was wohl nie zu begreifen sein würde . Wie mochte es da der Großmutter gehen, die ein Teil dessen gewesen war. Was geschah jetzt, wenn alles wieder so lebendig wurde. Sie wollte nicht, dass ihre Großmutter das Leid von früher wieder neu spürte. Das durfte nicht sein. Natürlich – sie selber hatte ihr das Buch gegeben, sie auf die Vergangenheit gestoßen. Doch es konnte nicht sein, dass es ihr so weh tat. Das konnte sie nicht ertragen.
Mit einer impulsiven Bewegung sprang Marissa auf und zu ihrer Großmutter, umschlang sie fest mit den Armen. „Liebste Oma“, wisperte sie so leise in ihr Ohr, dass es kaum zu hören war. Als sie sich von ihr löste, gab sie sich betont aufgekratzt. „Weißt du was, ich glaube, ich gehe doch noch zum Dünensingen. Ich will unbedingt Knut in Aktion erleben.“
Emilia lächelte verhalten. „Ja – geh nur, gute Idee!“
Nachdem Marissa wie der Wind aus der Tür gefegt war, blieb Emilia eine Weile bewegungslos am Tisch sitzen. Schließlich stand sie auf und räumte langsam das Geschirr und die Reste des Abendbrotes zusammen und brachte alles nach und nach in die Küche. Durch die Tür zum Garten wehte ein frischer Wind hinein, der schon nach Herbst roch und sie frösteln ließ. Langsam würde auch dieser lange, schöne Sommer zu Ende gehen. Wie plötzlich das zu spüren war. Und bald würde auch Marissa wieder gehen. Sie hatten nicht darüber gesprochen, aber es war ihnen beiden wohl bewusst, dass die Tage langsam zur Neige gingen. Und so musste es ja auch sein. Marissa musste zurück in ihr Leben. Und sie, Emilia, würde sich wieder in ihr Alleinsein finden. Sie konnte es nicht verhindern, dass ihr ein leichter Seufzer über die Lippen kam. Gleichzeitig spürte sie, wie auf’s Stichwort, eine warme, feuchte Schnauze an ihren nackten Füßen. Kater Teo war plötzlich hereingehuscht, schmiegte sich mit aufgebäumten Rücken an ihre Beine und schnurrte nachdrücklich. Emilia beugte sich zu ihm hinunter, strich ihm über den Kopf. „Natürlich, ich hab dich! Das habe ich nicht vergessen!“ Das schien dem Tier als Bestätigung genug, sofort war es wieder durch die Tür in den Garten verschwunden. Draußen war es schon richtig dunkel. Der Blick in den Himmel zeigte ihr schwere Wolken, die nach dem schönen Tag die Reste von Sommerklarheit verhängten. Möglich, dass es nachts noch regnen würde. Sie fröstelte wieder und zog ihre Strickjacke fester um sich. Und sie spürte ihre Zehen unangenehm kalt und steif in ihren offenen Latschen. Ein paar Wollsocken lagen immer griffbereit in der Sofaecke. Auf der Suche danach, ging sie rüber in der Wohnstube. Da lag das Buch auf dem kleinen Beistelltisch. Aufgeschlagen, auffordernd. Sie nahm es hoch, erwog, darin das zu lesen, was sie so lange nicht mehr hatte lesen wollen. Es war ja schon vorbei. Sie musste es nicht aufwecken, was darin schlief. Sie wollte sich nicht aufwecken. War es doch schon genug damit, dass sie mit Marissa darüber sprach, sie fragen ließ, was sie fragen musste und sollte. Das war gut so. Aber mehr. Mehr musste sie nicht tun. Es hatte sie sehr überrascht, wie sehr doch mit einem Mal alles so überklar vor ihr erschienen war als sie Worte darunter legte – unter das, was eigentlich unaussprechlich war. Und dass da noch Schmerz war, der doch betäubt schien. Nein – das wollte sie nicht mehr. Nicht mehr Schmerz als der, der da war. Das Buch war nicht für sie bestimmt. Es gehörte einer anderen Generation. Die ihrer Enkelin und so viel mehr auch noch ihrer Tochter. Warum, fragte sie sich, habe ich es ihr nie gegeben? Warum nicht Juliane? Warum erst jetzt Marissa?
Weil Marissa noch so jung war, so sehr am Anfang ihres Lebens mit so vielen Möglichkeiten, die sie noch entdecken musste ohne dieses Schwere mit sich zu tragen. Vielleicht half es ihr, mit den Geschichten von damals eine andere Sicht auf ihr Leben zu bekommen. Würde das gehen? War das der Weg? Vielleicht tat sie ihr gar keinen Gefallen damit, Wunden zu vergrößern, statt sie zu lindern. Tat sie nicht damit etwas grundlegend Falsches. Wie konnte sie wissen, dass Marissas Lebensschmerz weniger würde, wenn sie in die Vergangenheit eintauchte, die alles andere als angenehm gewesen war. Konnte das überhaupt funktionieren. Würde sie nicht eher doppelt leiden dadurch. Wie sicher war es, dass es eine Verbindung gab zwischen dem Erleben der Enkelin und dem der Vorfahren. Und warum kümmerte sie sich nicht zu allererst darum, wie es ihrer Tochter ging. Ihrer so gewünschten, geliebten Juliane, die wahrhaftig so viele dunkle Wege durchschritten hatte und immer noch ging. Doch die sich auch so vor allem verschloss. Vor sich, vor der Welt, vor ihrer Mutter, ihrer Tochter. Und vor ihrem Herzen.
Emilia stand da in ihrer Wohnstube. Stand vor den Bildern der Familie. Vor allen, die gewesen waren und die noch hier waren. Die noch jungen, lebendigen. Aber wie wenige waren das doch, verglichen mit denen, die nur noch scheinbar lebendig aus den Rahmen zu ihr blickten. Sie sah von einem zu anderen, suchte in jedem Gesicht nach Spuren der Geschichte, nach Glück und Freude, Verlust und Leid. Manche blickten ausdrucklos, andere, wie ihre Mutter Mathilda, strahlten zu demjenigen herüber, der das festzuhalten versuchte, was in dem Moment in der Ferne noch so frisch gewesen war.
Nikolas. Ihr Bruder. Er stand da so steif. So steif, wie er nie gewesen war. Aber er mochte es nicht, fotografiert zu werden. Er stellte sich dann immer auf als hätte er einen Stock verschluckt, biß die Zähne zusammen und starrte unbeweglich geradeaus. Möglich, dass er sogar das Atmen einstellte. Auf Bildern blickte ein ganz anderer Nikolas heraus als der, der er war, wenn der Fotograf den Apparat wieder eingepackt hatte. Dann war er sofort wieder überaus lebendig, lustig und sehr, sehr gut aussehend. Emilia hatte ihn immer geliebt und liebte ihn noch. Vorsichtig nahm sie sein Bild vom Sims und sah dem Bruder in die unbeweglichen Augen. „Du bist und bleibst mein Held, Nick!“
Ihr Hochzeitsfoto daneben war schon sehr verblichen, doch noch immer spürte sie diesen Glücksaugenblick in sich als sie da vor dem Kirchenportal neben Julius stand. Den Strauß tiefdunkelroter Rosen an sich gedrückt, ihrer beider Augenpaare ineinander verschlungen, so fest wie die Hände. Das stumme Lächeln für die Ewigkeit mit Liebe versiegelt.
Julius. Noch immer schien es ihr wie ein Traum, dass er da gewesen war. Da für sie. Mit ihr. Ein Glück, das ihr begegnet war als sie nicht mehr daran glaubte, dass es so etwas wie Glück für sie noch geben konnte. Nach diesen vielen Jahren voller Leid, diesem Krieg, den Jahren danach, die, auch wenn sie Frieden hießen, nichts anders waren als der Rest von Überlebenden, die ihre Wunden vergessen wollten. Die sich in ein neues Leben stürzten ohne das, was gewesen war, begriffen zu haben, ohne es heil werden zu lassen. Niemand fragte nach den Seelenwunden, die geblieben waren. Was wusste man davon, was wusste man von Traumata. Von möglichen Therapien. Das Leben wollte gelebt werden, das Leben war wieder lebenswert. Wunden des Körpers heilten irgendwann. Und die Wunden der Seele? Worüber nicht gesprochen wurden, was man nicht sah, das gab es nicht, war nicht wichtig. Das Jetzt war wichtig! Nach vorne schauen, das war alles, was zählte. Zukunft leben!
Und die Zukunft war licht. Emilia übersprang mit ihren Gedanken die schwierigen Nachkriegsjahre bis hin zu dem Tag als alles für sie nur noch glänzte. Als sie Julius das erste Mal sah. Julius, diesen überaus attraktiven Mann, der hinter seinem Flügel saß und die Welt mit seiner Musik einhüllte. Und auch sie fühlte sich eingehüllt davon, ließ sich bereitwillig gefangen nehmen. Wie kitschig. Wie überaus wundervoll war das, was ihnen beiden widerfuhr. Wundervoll und doch so selbstverständlich. Niemals gab es eine Frage, ein Zweifel zwischen ihnen. Es war alles klar. Klar und einfach.
Niemals sonst in ihrem Leben war etwas so einfach gewesen. Und diese Einfachheit bewahrten sie sich ein halbes Jahrhundert lang. Von dem Tag ihrer ersten Begegnung bis zu dem Tag, an dem Julius neben ihr im Bett lag und nicht mehr atmete. Vom Tag vor dem Traualtar bis zu dem Tag, an dem sie ihre Goldhochzeit feierten. Dieses Leben war das Leben, was sie immer leben wollte. Dieses Leben genoss sie jeden Tag, jede Stunde, die es dauerte. Dieses Leben war ein Stück Himmelsglück, das sie trug und leitete bis hierher. Bis zu diesem Sein, das sie allein ließ ohne ihn, ihren Seelengefährten, aber sich niemals einsam fühlen ließ. Das Glück war noch immer da, wie ein ewiges Leuchten in ihr. Sollte es eines Tages verlöschen, würde das ihr letzter Erdentag sein.
Bis dahin wollte sie es immer wieder neu aufleuchten lassen und es denen weitergeben, die es bisher so wenig hatten aufflackern sehen.
Sie blickte in die Augen ihres Mannes, der sie durch den Bilderrahmen ansah. Blickte in die Augen eines älteren, weißhaarigen Mannes mit Schalk im Gesicht. Das Bild, das neben ihrem Bett stand und das sie jeden Abend in die Hand nahm. Und auch jetzt. Aus einem inneren Bedürfnis war sie nach oben gegangen, zu ihm. Setzte sich mit ihm auf seine Bettseite und sprach mit ihm, bat ihn um Hilfe für Marissa, Juliane und für sich. Bat um Eingebung und Zuspruch und fühlte seine Nähe wie eine wärmende Umarmung.
Hörte seine lachende Stimme: „Lia, du brauchst mich nicht. Du bist so stark. Du warst immer so viel stärker als ich. Du warst immer mein Halt. Nicht umgekehrt. Ich sehe, dass du alles gut machst. Ich sehe, dass alles gut wird. Ich sehe euch alle. Ich sehe euch im Glück.“
*
Dann war Marissa wieder da. Wirbelnd wie der Wind vom Meer und so ungestüm, wie sie sein sollte als junger Mensch. Voller Energie und Lebensfreude. So war es richtig. Nicht die Marissa, die in sich zusammengekauerte. Das Lachen in ihrem Gesicht war viel zu strahlend als das es wieder verdrängt werden durfte von etwas Dunklem. Emilia freute sich über den Anblick ihrer Enkelin, die rufend zu ihr nach oben gerannt kam.
„Oma, ich bin wieder da!“ Sie stand pustend vor ihr und sprudelte sofort über. „Es war sehr, sehr lustig! Knut ist wirklich ein Seebär wie aus dem Buch! Wie er singt und spielt! Und wie er mit den Kindern umgeht und Spaß macht. Wirklich toll.“
Emilia lachte über den Eifer der Enkelin. „Ja, ich weiß. Er ist ein echtes Original. Freut mich, dass es dir gefallen hat.“
„Er hat nach dir gefragt. Er hätte dich gern da gesehen“, plapperte Marissa weiter. „Ich glaube, er einen ganz großen Narren an dir gefressen.“
„Ach, was. Kind!“ Emilia lachte jetzt lauthals. Schaute zu Julius hinüber und meinte zu sehen, wie er ihr belustigt zuzwinkerte.
„Doch, doch.“ Marissa blieb hartnäckig. Ließ sich auf das Bett neben Emilia sinken und sah sie eindringlich an. „Geht’s dir gut? Warum bist du schon hier oben? Wolltest du schon schlafen gehen?“
Emilia schüttelte den Kopf. „Nein. Ich habe ein wenig mit deinem Großvater geredet. Das hat mir gut getan. Ich habe noch ein bisschen nachgedacht über früher, was war. Gut und weniger gut. Und daran, wie es noch wird. Bei dir, bei deiner Mutter…“
Über Marissas Gesicht huschte ein flüchtiger Schatten. „Ach, Oma. Ich bin gerade ganz glücklich, mach dir keine Gedanken.“
„Gedanken kommen halt einfach, da kann man manchmal nichts machen. Irgendwie haben sie ein Eigenleben, drängen sich immer genau dann auf, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann, nicht haben will. Ja – aber vielleicht sind sie genau dann richtig. Es hat doch wohl immer alles seinen tieferen Grund. Aber – egal …“ Emilia stoppte sich, gebot sich Einhalt bevor sie mit ihren Worten eine Richtung einschlug, die so gar nicht zu der unbeschwerten Stimmung der Enkelin passten und die sie ihr nicht nehmen wollte.
„Komm, gehen wir nochmal runter. Es ist noch ein Rest Rote Grütze da – hast du Appetit drauf?“
„Welch eine Frage“, Marissa grinste, stand auf, drückte der Großmutter einen warmen Kuss auf die Wange und war bereits in Richtung Küche unterwegs.
Später als sie schon im Bett lag, dachte sie an die Gedanken, die ihre Großmutter beschäftigen. Dachte an ihre Mutter. Obwohl sie es nicht wollte. Doch da war plötzlich deren Gesicht vor ihr und ihre Stimme, die immer irgendwie anklagend klang. Sofort zog sich in ihr etwas zusammen. Ein Druck legte sich auf ihre Brust und bedrängte sie. Sie schlang ihre Arme um sich selber, wie um sich Schutz zu geben. Dann atmete sie tief ein und aus, schloss fest die Augen und suchte Zuflucht im Schlaf.
*
Das Blinzeln der Sonne, die durch das Dachfenster hineinsah, kitzelte sie an der Nase und legte einen rotwarmen Schimmer auf ihr Gesicht, der so intensiv war, dass sie wach werden musste, ob sie wollte oder nicht. Es musste schon recht spät sein, sonst kletterte die Sonne nicht so weit nach oben. Und es war warm hier unterm Dach. Marissa befreite sich von ihrer Bettdecke, legte ihre nackten Beine darauf und blieb mit verschränkten Armen liegen, blickte in das Himmelsrechteck voller Blau. Sie wollte hier liegen bleiben, einfach da sein, nichts denken, nichts tun müssen. Sobald sie aufstand, würde etwas geschehen, das spürte sie. Sobald sie die Treppe hinunter ging, in die Küche, durch die Tür auf die Terrasse, sobald sie im Garten stand, würde etwas in Bewegung geraten, das sie meiden wollte, dem sie auswich seit sie hier her gekommen war. Seit sie München fluchtartig verlassen hatte. Aber sie hatte immer gewusst, dass sie nicht immer den Kopf einziehen konnte, sich verstecken. Irgendwann würde sie sich dem Draußen stellen müssen. Und dem Drinnen. Dem Selbst in ihr.
Der Schlaf, der sie gestern so schnell eingeholt hatte, war unruhig gewesen. Bilder hatten sich wieder gejagt, wie schon so oft. Gesichter, Orte und Zeiten waren durcheinandergepurzelt und ließen sie jetzt unruhig daliegen. Sie hatte die Traumszenen nicht fassen können, ihr Bemühen sie jetzt im Wachen zurückzurufen um sie begreifen zu können, war vergeblich. Je mehr sie nach ihnen griff, desto schneller lösten sie sich auf. Platzten wie flirrende Seifenblasen. Marissa stieß resigniert Luft durch die Nase aus, strampelte heftig die Bettdecke auf den Boden und warf mit einer ungestümen Geste ihr Kopfkissen gegen die Zimmertür.
Im Bad betrachtete sie ihr Spiegelbild als wäre es das erste Mal, sah sich in die Augen und blickte tief in die grüngraue Farbe ihrer Iris. Eigentlich hätte sie sich gerne eine Fratze gezogen, doch ihre Gesichtszüge blieben unbeweglich und starrten weiter die Frau im Spiegel an. Je länger sie schaute, desto mehr entstand ihr der Eindruck als ob es jemand anders wäre, der ihr da gegenüber stand. Und nicht nur eine Person, sondern mehrere. Mit ähnlichem Ausdruck, ähnlichen Augen aber doch ganz anderer Physionomie.
Marissa fröstelte es ein wenig, riss sich dann abrupt von den verschiedenen Frauen los, kämmte rasch ihre wirren Haare und stieg dann langsam und bedacht die Treppe nach unten.
„Ich fahre nach Bremen.“ Die Worte kamen aus ihr heraus sobald sie auf der Sonnenterrasse stand. Emilia blickte zu ihr von ihrem Platz auf der Bank und nickte. Sie schien nicht überrascht. „Ja“, sagte sie. „Ja – das tust du.“
„Heute“, fügte Marissa hinzu. Und Emilia nickte wieder.
Wenige Stunden später liefen sie schweigend nebeneinander auf dem Deich in Richtung Hafen. Kurz bevor sie gingen, war Marissa noch zum Strand gelaufen, hatte ihre Füßen im Sand versinken lassen bevor sie mit den Zehen ein letztes Mal ins Meerwasser spürte. Sie ließ sich ihre Lungen vollsaugen mit frischer, herber Seeluft, ließ den Wind ihr Gesicht durchwehen und die Sonne ihre Haut erwärmen. Mit allen Sinnen sog sie die Insel nochmal in sich auf. Sog die Empfindungen auf wie ein Schwamm und bewahrte sie in ihrem Inneren. Zeit für einen langen Abschied blieb ihr nicht. Und auf dem Deichweg oben neben der Großmutter irrte ihr Blick ohne wirklich zu sehen über Dünen, Sand, Gras, Wasser und Himmel. Am Anleger umarmte sie die alte Frau heftig, drückte sie an sich, spürte deren Herzschlag und ihren eigenen zusammen in Gleichklang unruhig pochen. Emilia legte ihre warmen Hände auf die Wangen der Enkelin, blickte ihr liebevoll in die Augen. „Mein liebes Mädelchen“, sagte sie nur.
„Oma“, Marissa wollte plötzlich so viel noch sagen. Jetzt sofort. Alles sagen. Alles fragen. Alles wissen. Jetzt und hier. Vor dem Schiff. Vor dem Abschied. Alles auf einmal. Schnell und dringlich. „Oma, ich….“ Das Hupen der Schiffssirene übertönte ihre Worte. Emilia drückte ihre Hand. „Geh, Issa.“ Sie schob die Enkelin zum Schiffsübergang, winkte ihr zu als diese sich nochmal umdrehte. „Geh nur - geh!“
Sie blieb stehen, bis das Fallreep abgezogen war, bis sie Marissa drüben an der Reling stehen sah, ohne zu winken. Sah zu, wie die Fähre zu ihrem Ablegemanöver ausholte, sich langsam wegdrehte von der Insel und dann ganz allmählich Fahrt aufnahm. Dann winkte sie zu der Gestalt hinüber, die mit einem Mal beide Arme nach oben riss und hin und her wehte wie eine lebende Fahne. Erst als die Fähre kaum noch zu sehen war, drehte sie sich um und ging langsam über den Deich zurück.
*