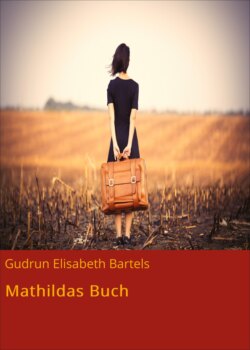Читать книгу Mathildas Buch - Gudrun Elisabeth Bartels - Страница 6
Emilia
ОглавлениеDie kleine Emilia war ein pummeliges Kind, unförmig und irgendwie zu kurz geraten. Anscheinend glaubte die Natur, diesen Mangel dadurch ausgleichen zu müssen, dass sie dem Körper des Mädchens dafür mehr Breite als Höhe zugestand.
Emilia fand das solange in Ordnung bis sie merkte, dass sie scheinbar von anderen Leuten als komisches Etwas wahrgenommen wurde, über das man lachte und Witze machte. „Da ist sie ja wieder unsere kleine Kugelmamsell“, hieß es da oder auch: „Achtung, die Schussbombe ist im Anmarsch!“
Anfangs hatte Emilia mitgelacht weil sie nicht verstand, dass man sich auf ihre Kosten lustig machte – bis sie mitbekam, wie ihre Mutter sich mit einer Nachbarin darüber mit mühsam unterdrückten Zorn ausließ. Sie hatte zwar ihre Stimme zurückgenommen, damit Emilia sie nicht hörte, aber Emilia hatte ein überdurchschnittlich gutes Gehör und überdies die Fähigkeit zu erspüren, wann es wichtig war, genau hinzuhören. Das sollte ihr oftmals zum Vorteil gereichen, aber es gab auch Situationen, wo sie sich wünschte, nicht alles so genau mitzubekommen. In denen sie es als Gnade empfunden hätte, wenn ihre Ohren taub gewesen wären oder zumindest weniger empfindsam.
Doch anfangs war sie sehr glücklich als ihr immer wieder gesagt wurde, welch feines, musikalisches Gehör sie hätte. Das Lob tat ihr gut und die Begeisterung, die ihre Singstimme bei ihren Zuhörern hervorrief, ließ sie innerlich erstrahlen. Es tat ihrer Seele gut bewundert zu werden, nachdem sie so viele Schmähungen aufgrund ihres Äußeren hatte erfahren müssen. Das war wie eine Wiedergutmachung für die bösen Worte vormals.
Wenn sie sang, war sie der glücklichste Mensch auf der Welt. Dann vergaß sie alles um sich herum, alle Ängste und Sorgen waren verschwunden und sie fühlte sich leicht und frei. Auch in den schlimmsten Zeiten, war es der Gesang, der ihr darüber hinweghalf und sie für eine kleine Weile in eine Welt entführte, wo alles gut war und schön. Und nicht nur ihr half es über die graue Wirklichkeit zu schweben, auch ihren Zuhörern konnte sie so etwas Freiheit vom Leid verschaffen. Dieses Wissen machte sie unendlich dankbar und demütig gegenüber dieser wunderbaren Gabe, die ihr durch die große Macht des Himmels zuteil geworden war.
Das erste Mal als sie ein Stück von diesem Glück erfuhr, war während einer Schulfeier, bei der sie für die in den Krieg ziehenden Soldaten ein Volkslied singen durfte. Im großen Saal der Schule waren Lehrer, Eltern und Schüler zusammengekommen. Alles war festlich geschmückt mit Fahnen, Girlanden und Blumen. Die Girlanden und Blumen gefielen Emilia sehr, doch die Fahnen mit diesem großen, schwarzen Kreuz darauf, machten ihr Angst. Doch daran dachte sie nicht als sie sich auf das Podium stellte und der Musiklehrer das sehr gebrauchte Klavier mit mächtigen Griffen bespielte. Ihr feines Gehör litt, wenn er daneben griff und die ohnehin verstimmten Tasten verwechselte. Aber er war alt und fast blind und konnte kaum noch seine Finger erkennen, geschweige denn weiße und schwarze Tasten unterscheiden. Aber er spielte mit Enthusiasmus und Herzblut, was sich auf die kleine Sängerin übertrug, die mit kräftiger Stimme ihr Lied sang. Von Nervosität war ihr nichts anzumerken als ihre Töne zu den Menschen im Saal flogen. Sie war schon ruhig als sie wenigen Stufen zur Bühne hinaufsieg und sich neben das Klavier stellte. Sie fühlte sich sehr sicher und wusste, dass alles gut gehen würde. Und sie wusste, dass sie hübsch aussah, trotz ihres Umfanges und der wenigen Körpergröße.
Ihre Mutter Mathilda hatte am Morgen ihre dichte Haarfülle zu einem festen Zopf geflochten, der ihr auf den Rücken fiel und sie trug das Kleid, das diese ihr zum sechsten Geburtstag genäht hatte. Dafür hatte die Mutter eines ihre alten Kleider geändert und für Emilia ein richtiges Prinzessinnenkleid geschneidert.
Es war knielang und am Saum und den halblangen Ärmeln mit weißer Spitze verziert, der dunkelblaue Stoff schimmerte samtig und fiel leicht am Körper herab, sodass das Kleid bei jedem Schritt duftig hin und herschwang. Das schönste aber war, fand Emilia, die Schärpe, die auf dem Rücken zusammenlief und dort wie eine kleine Schleppe hinunterfiel. Ihre gebrauchten Schuhe hatten Mutter und Tochter solange geputzt bis sie glänzten und fast wie neu aussahen. Dass sie an den Hacken bereits abgeschabt waren und sich die Sohle unterm rechten Fuß schon leicht zu lösen begann, fiel gar nicht auf.
Mathilda betrachtete bewundernd ihre Tochter wie sie da so herausgeputzt vor ihr stand und eine Welle von Herzensrührung floss aus ihr heraus hin zu der Tochter, die sie überschwänglich an sich drückte. „Du bist die schönste Prinzessin, die ich kenne und die mit der wundervollsten Stimme.“
Emilia wurde rot vor Freude und strahlte über das ganze Gesicht. Selbst ihr großer Bruder Nikolas, musste zugeben: „ Ja – sieht ganz gut aus.“ Dann puffte er der Schwester kumpelhaft in die Seite.
Als er später neben der Mutter im Publikum saß und zur Bühne blickte, wo Emilia auftrat, richtete er sich stolz geschwellt auf und auch Mathilda straffte unwillkürlich den Rücken als sie ihre Tochter nach vorne treten sah. Ihr Herz klopfte laut vor Aufregung und ihre Hände waren feucht. Als Emilia zu singen begann, stieg ihr Feuchtigkeit in die Augen hinauf. Die Stimme des Mädchens drang direkt in die Herzen der Zuhörer, die mit angehaltenem Atem dem Lied lauschten. Es war als legte sich ein Zauber über sie alle und trug sie weg von trüben Gedanken und Sorgen um die Zukunft. Die Zeit stand still, hielt inne und spürte den Klängen nach.
Es war einst eine kleine Biene, summ, summ, summ,
die flog den lieben langen Tag von Blum zu Blum.
Sie naschte hier, sie naschte dort,
flog weiter dann von Ort zu Ort
und summt ein Lied dabei, und summt ein Lied dabei.
Doch als der Abend leise nahte,
erschrak die kleine Biene sehr, wollt eilig um.
Doch ach, sie flog schon viel zu weit,
Sie konnte nicht mehr heimwärts heut:
Denn dunkel ward’s und kalt, denn dunkel ward’s und kalt.
Gar ängstlich flog sie auf ein großes Blumenblatt
Und weinte sich darauf so recht von Herzen satt.
„Was soll ich tun? Wo bleib ich heut?“
Kehrt ich doch um zur rechten Zeit,
Nun komm ich niemals heim, nun komm ich niemals heim.“
Das hörte sich die Blume voller Mitleid an,
Sie war sofort entschlosssen, eh sie sich besann.
„Komm rein zu mir, ich öffne dir,
Für diese Nacht bleibst du bei mir.
Drum weine nicht so sehr, drum weine nicht so sehr.“
Da trocknet sich das Bienchen seine Äugelein,
Bedankt sich bei der Blume und flog schnell hinein.
Und als am Morgen es erwacht,
Hat schon die Sonne hell gelacht.
Vorbei war da die Not, vorbei war da die Not.
„Leb wohl, du liebe Blume, hab viel tausend Dank.
Ich muss mich jetzt sputen, denn mein Tag ist lang.
Niemals vergeß‘ ich diese Nacht, Die ich bei dir hab zugebracht.
Leb wohl denn, lebe wohl, leb wohl denn, lebe wohl.“
Während der wenigen Minuten, in denen die Töne des schlichten Liedes durch den Raum schwebten, leuchtete für alle eine Sonne auf, die die dunklen Schatten des Krieges verdrängte. Viele weinten lautlose Tränen, andere lächelten voller glückseliger Freude. Andere saßen stumm gefangen von der Melodie ohne äußere Emotionen. Doch niemanden ließ sie unberührt. Mathilda konnte durch den Tränenvorhang, der ihre Augen umflimmerte ihre Tochter nur verschwommen wahrnehmen. Sie sah nur ein engelgleiches Wesen und hörte himmlische Töne und ihr Herz quoll über vor Liebe.
*
Die dunkle Zeit lag über allem wie ein dichter Umhang, niemand konnte hindurchschauen und erkennen, was sich da hinter verbarg. Die Ohnmacht, die damit verbunden war, war ein schwer zu erduldender Zustand. Dabei half es nur wenig zu wissen, dass alle das gleiche Los zu tragen hatten. Manche mehr, manche weniger, aber alle waren durch die Kriegssymptome schwer in Mitleidenschaft gezogen. Als Deutschland mit seinem Angriff auf Polen am 1.September 1939 den Krieg begann, war Emilia fünf Jahre alt und freute sich darauf, nächstes Jahr endlich in die Schule zu kommen. Am 4. Dezember wurde sie sechs Jahre alt und war somit endlich kein Kleinkind mehr.
Ihr Bruder Nikolas war schon neun Jahre alt und schaute manchmal recht von oben herab auf die kleine, sehr kleine Schwester. Doch in Momenten wie beim Fest in der Schule, war er sehr stolz, ihr Bruder zu sein. Emilia hegte grundsätzlich und uneingeschränkt liebevolle Gefühle für ihren Bruder. Er war ihr Vorbild, dem sie nacheiferte und es erfüllte sie mit tiefer Freude, wenn er sie wahrnahm oder, wie nach ihrem ersten Auftritt, sogar an sich zog und einen leichten Kuss auf die Wange drückte. Das waren Momente, die sich tief in ihr Gedächtnis brannten und von denen sie zehrte, wenn sie eine dunkle Phase durchlebte.
Dachte sie Jahre danach an die langen Jahre des Krieges, waren ihr neben den schlimmen Erlebnissen, die sie noch viel später immer wieder aufsuchten, auch die kleinen Glücksmomente präsent und damit das Wissen, dass sie und ihre Familie trotz allem, noch sehr viel weniger Leid erfahren hatten als so manche andere. Darauf baute sich in ihrem weiteren Leben letztlich ihre innere Haltung der Dankbarkeit und Gelassenheit auf. Doch zugefallen war ihr diese nicht von alleine und alles andere als leicht. Wie oft hatte sie mit dem Schicksal gehadert, sich ungerecht behandelt und gebeutelt gefühlt. Erst mit zunehmendem Alter wuchs die Aussöhnung und Anerkennung ihres Seins.
*
Wie merkwürdig sorgenfrei ihr Bruder und sie in den ersten Anfängen der Kriegsjahre waren. Es war eine seltsame Normalität, die sich einstellte und mit der die Kinder scheinbar viel leichter zu Recht kamen als die Erwachsenen. Ihre Fähigkeit, den Moment zu leben, war noch ungebrochen, sodass sie auch mitten im größten Unglück in der Lage waren, sich uneingeschränkt auf eine Sache zu konzentrieren, die ihr Interesse geweckt hatte. Da wurde dann kurzerhand das Umfeld ausgeblendet um das zu tun, was in diesem Augenblick mit einem Mal eine viel größere Aufmerksamkeit auf sich zog. Manchmal waren es die scheinbar kleinen Dinge, die sie ansprachen und festsogen. Nikolas hatte das Talent sich innerhalb kürzester Zeit in ein Buch zu versenken und völlig darin aufzugehen, auch wenn draußen Alarm war und über ihnen die Bomber dröhnten, sodass die Kellerwände und -decken zitterten. Emilia träumte sich in ihre Lieder und summte sie vor sich hin, manchmal halb in Trance. Anfangs hatten sich andere Kellerinsassen darüber beschwert, doch dann gewöhnten sie sich an die entrückten Melodien und wollten sie gar nicht mehr missen. Es half ihnen, sich aus der angstvollen Situation wegzudenken hin zu einer andere Ebene des Seins. Da konnte der Angriff schlimm sein aber die Stimme des Mädchens legte eine schützende Decke über sie alle, die mit ihr hier im Keller saßen. „Du bist unser Schutzengel, Lia. Wenn du da bist, kann uns nichts passieren.“ Die Worte, ausgesprochen von der alten Frau Meier, die unten im Erdgeschoss wohnte und sich oftmals über den Kinderlärm beschwert hatte, gab das wieder, was viele mit der Zeit glaubten. Um Emilia schien eine Aura der Unantastbarkeit zu liegen, die alle in ihrem Umfeld erfasste und sich wie ein Kokon der Sicherheit um sie spannte. So war die Stimmung im Keller dieses Hauses fast schon heiter zu nennen und nahezu unbeschwert, wenn ein nächtlicher Alarm alle aus den Betten jagte. Emilia gefiel es, als Engel bezeichnet zu werden, auch wenn sie nicht recht wusste, wie ein Engel aussah. Eigentlich hätte sie doch wohl Flügel haben müssen, wenn ihre Vorstellung von Engeln richtig war. Und weiß gekleidet mit langen blonden Haare und goldenem Heiligenschein. Eines Tages schlich sie sich ins Schlafzimmer der Eltern und stellte sich vor den großen Spiegel am Kleiderschrank. Dort drehte sie sich hin und her, konnte aber keine dieser Engel-Zeichen bei sich entdecken. Als ihre Mutter dazukam und sie fragte, was sie da mache, meinte sie: „Ich suche meine Flügel…“ Erst begriff die Mutter nicht, doch dann lachte sie leicht auf: „Du wirst keine finden. Und bitte, Lia, nimm es nicht so ernst, dass die Leute dich Engel nennen. Natürlich ist das schön, aber ich fände es viel schöner wenn du weiterhin nur meine Lia bist und nicht plötzlich davon fliegst.“ Sie strich ihr über das dicke, schwarze Haar. „Vergiss nicht, du bist ein Kind, ein menschliches Wesen. Ein ganz besonderes, soviel ist sicher, aber bleib auf der Erde, versprichst du mir das?“ Mathilda ging vor ihrer Tochter in die Knie. „Ich brauch dich hier.“
Emilia betrachtete sich eine Weile ernst im Spiegel. „Ist gut“, sagte sie dann. „Ich habe auch gar keine Lust, ein Engel zu sein. Und – ich will auch hierbleiben.“
„Das ist schön, meine Süße.“ Mathilda küsste sie innig auf die Stirn.
„Aber singen tue ich trotzdem.“ Emilia sagte es fest und eindringlich und wand sich aus der Umarmung der Mutter.
„Natürlich“, nickte diese, „…auf jeden Fall. Das sollst du auch.“ Sie sah der Tochter mit widerstrebenden Emotionen nach als diese aus dem Schlafzimmer lief. Irgendwie müde setzte sich Mathilda auf eines der Betten, auf die Seite, die sie schon seit einiger Zeit nicht mehr beziehen musste. Sie legte leicht die Hand auf die leere Matratze und streichelte sie, wie den Körper eines Menschen. Sanft und liebevoll. „Josef, du fehlst uns. Du fehlst mir.“ Sie flüsterte die Worte hin zu dem unsichtbaren Körper, ließ ihre Hand still auf seinem Herzen liegen. Länger schon hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Als Postbeamter war er zum Dienst in das besetzte Polen abkommandiert worden. Bisher war nur ein kurzer Brief gekommen, in dem stand, dass es ihm gut ging und er genug zu essen bekam, dass er an sie alle denke und sie fest umarme. Was hätte er auch schreiben sollen. Doch es war eine Botschaft, die guttat, die sie gerne wieder und wieder hören wollte. Für ihr Herz, für ihr Vertrauen, dass alles gut war und er bald wiederkommen würde. Zu ihr, zu den Kindern. Nach Hause. Sie erhob sich hastig vom Bett, zog die Hand von dem entfernten Herzen. Aus den Augenwinkeln sah sie sich im Spiegel vorbeigehen wie einen flüchtigen Schatten.
*
Der nächtliche Alarm einige Tage später war der schlimmste, den sie alle bisher erlebt hatten. Mathilda hatte die Kinder gerade erst ins Bett gebracht, sie waren kaum eingeschlafen als die Sirenen losheulten. Sie hatte Mühe die beiden aus der gerade betretenen Schlafwelt herauszuholen. Emilia musste schon sehr tief darin eingesunken sein, denn sie stand wie benommen neben ihrem Bett, zitterte und wusste kaum, wie sie ihre Sachen anziehen sollte. Nikolas war schneller, aber auch er schaute sehr verwirrt um sich. Auf dem Weg in den Keller, torkelte Emilia mit halbgeschlossenen Augen die Treppe hinunter und kroch wie apathisch auf ihre Pritsche ganz oben unter der Kellerdecke. Mathilda deckte sie so gut es ging zu, aber das Mädchen zitterte in einem fort. Vielleicht wurde sie krank. Die Mutter fühlte die Stirn des Kindes, die sich aber nicht heiß anfühlte. Wahrscheinlich hatte sie etwas geträumt, das sie durcheinander gebracht hatte. Sie flüsterte ihr beruhigende Worte zu und legte sich selber auf ihre Pritsche. Nikolas lag mit offenen Augen auf seinem Lager, sein Buch neben sich.
In dieser Nacht sang Emilia nicht.
Über ihnen tobte die Hölle. Stunden um Stunden dröhnten die Bomber, feuerten die Flakgeschütze. Die Menschen unter der Erde krochen immer mehr in sich zusammen, verzogen sich in ihr Innerstes in der Hoffnung, dort Sicherheit zu finden. Der Lärm der gewaltigen Donnerschläge drang mit jeder Minute näher zu ihnen heran, ergriff die Mauern und ließ die Erde um sie herum schwanken. Nebel von Kalkstaub rieselte auf sie nieder, machte die Luft rau und legte sich wie Schuttasche auf die Atemwege. Ein Keuchen ging durch den Raum, gemischt mit Schluchzen und halblaut gemurmelten Gebeten. „Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name….“
Und dann das Flehen einer Stimme: „Engel, sing doch, sing.“
Doch Emilia war stumm. Sie lag halb schlafend unter der niedrigen Kellerdecke und zitterte. Kein Ton kam über ihre Lippen.
Mathilda sah zu der Stimme hinüber und schüttelte nur den Kopf. In dem Moment krachte es über ihnen und die Welt ging unter. Der ganze Raum bebte und schwankte. Schlagartig erlöschte das Licht und es war finstere Nacht. Ein Schrei schnitt sich durch das donnernde Inferno. „Engel - Engel – sing…“ Es war kein menschlicher Laut mehr. Es klirrte wie ein Schwert, das durch Stahl drang. Hoch, grellend und schrill. Das war schlimmer als das Dröhnen der Bomben über ihnen. Und es schrie und schrie und schrie.
*
Wie lange dauerte es. Stunden, Tage. Eine Ewigkeit. Das Zeitgefühl ging verloren, alles was es gab war Dunkelheit, dröhnende Schläge, schmerzende Nervenkörper gefangener Menschen und blanke Angst.
Irgendwann wurde es plötzlich unerträglich heiß, die Luft wurde immer dicker, das Atmen beschwerlich.
Mathilda versuchte sich im Dunkeln zu ihren Kindern hinzutasten. Die wenigen Schritte bis zum Lager ihres Sohnes schienen unüberwindlich, doch schließlich fühlte sie den rauen Stoff des Sackleinens auf der Pritsche und ließ sich darauf sinken. „Nikolas, bist du da?“ Ihre Hand bewegte sich suchend nach dem Körper ihres Sohnes. „Ja, Mama. Ich bin hier. Mir geht es gut.“ Seine Hand fühlte sich kalt und feucht an als sie diese ergriff.
„Lia“, rief sie ins Dunkle, „was ist mit dir?“ Sie pochte mit den Handknöcheln von unten gegen die Holzbretter der oberen Pritsche. Emilias Stimme klang von ganz weit her zu ihr hin: „Mama, ich friere. Mir ist so kalt.“
Die Welt da oben brannte lichterloh, der Keller erstickte in dumpfen Hitzewellen und die Kinder zitterten von Kälteängsten geschüttelt. Mathilda richtete sich schwankend auf und griff nach ihrer Tochter, die bebend oben unter der Decke lag. „Komm zu mir mein Schatz“, lockte sie, „komm nach unten zu uns. Ich schaff es nicht zu dir rauf.“ Der Lärm der Bombenwelt schwappte in einer neuen Welle hinunter zu ihnen in die Dunkelheit. Ein markerschütternder Schrei lief durch die Wände. Mathilda wollte sich die Ohren zuhalten, doch ihre Hände fassten jetzt die ihrer Tochter, die sich langsam von oben zu ihr hinabließ. Sie zitterte derart, dass Mathilda sie kaum halten konnte als sie in ihre Arme glitt. „… es wird alles gut.“ Sie presste sie fest an sich und zog sie mit sich zu Nikolas auf die Pritsche. Engumschlungen hielten sie sich aneinander gedrückt. Das Zittern der Kinder war kaum noch vom Zittern der Kellerwände zu unterscheiden. Es war als geriete die Welt vollständig ins Wanken, erfasst von einem Erdenbeben, das die Menschheit aus den Angeln hob und in die endlose Weite des Universums hinein katapultierte.
*
Irgendwann war es still. Irgendwann war nichts mehr zu hören außer dem lauten angestrengten Atmen der Menschen. Die Kinder in Mathildas Armen waren letztlich erschöpft eingeschlafen. Nikolas‘ Kopf lag auf ihrem Schoss, Emilia hatte sich wie ein kleines Tier neben ihr zusammengekauert. Mathilda lehnte mit dem Kopf an dem Mauerwerk hinter ihr, spürte jede Vibration auf sich übergehen und war schließlich fast gänzlich unfähig, sich noch zu bewegen. Manchmal nickte sie unwillkürlich ein, doch erholsamen Schlaf fand sie nicht. Sie zuckte zusammen als die Sirene aus der anderen Welt zu ihr drang. Erst begriff sie nicht, was es bedeutete. Doch dann hörte sie das erlösende Wort zu sich dringen. „Entwarnung!“ Wer es ausgerufen hatte, war nicht auszumachen. Noch immer war es dunkel. Dennoch schien es plötzlich hell zu werden. Ein paar der Männer, die in der Nähe der Tür waren, machten sich an ihr zu schaffen. Irgendetwas erschwerte das Öffnen, doch dann floss ein leichter Strom dumpfer Luft in den Raum und gleich darauf ein schummriges Licht. Wie eine Ansammlung von Höhlenbewohnern bewegten sich die Menschen vorsichtig in Richtung der rettenden Helle. Einer nach dem anderen verschwand darin und suchte sich den Weg nach oben.
Mathilda ging als eine der letzten. Die Kinder waren steif und konnten sich kaum bewegen. Auch sie selber hatte Mühe sich aus ihrer unbequemen Lage zu lösen und auf die Füße zu kommen. Doch schließlich gingen sie gemeinsam Hand in Hand zur Treppe und erreichten das Licht des Tages.
Geblendet standen sie oben und sahen erst einmal nur sich lebend und befreit.
Als der Blick sich dann für die Umwelt klärte, war es ein verirrtes Schauen auf eine Wüste des Unterganges. Die Augen sahen eine zerstörte Welt, die nichts mit der zu tun hatte, die einmal gewesen war. Der Verstand erfasste davon nichts wirklich, es war nur ein dumpfes Wahrnehmen einer Realität, die niemand glauben wollte.
Doch das wichtigste war, dass sie lebten. Mathilda stand da mit ihren Kindern im Arm und ließ die Tränen einfach aus sich herausfließen. „Guter Gott, ich danke dir“, flüsterte sie heiser. Ihr Haus stand wie durch ein Wunder nahezu unversehrt da, wie ein einsames Denkmal erinnernd an ein Leben einer anderen Zeit. Viele Nachbarhäuser waren stark beschädigt, Löcher klafften wie Wunden in den Wänden.
Emilia war eine ganze Weile unbeweglich dagestanden, die ganze Zeit über hatte sie kein Wort gesprochen. Doch jetzt gurgelte ein Laut aus ihr hervor, der wie ein Würgen klang. „Elsas Haus. - Wo ist Elsas Haus?“ Sie zeigte mit zitternder Hand in eine Richtung, wo statt eines Gebäudes nur ein unübersehbar großer Haufen von Steinen, Schutt und Rauch gen Himmel ragte.
Mathilda blickte erschüttert darauf. Sah das alles und begriff nichts. Doch tief in ihrem Innern stieg eine heiße Welle der Erkenntnis auf. Die Erkenntnis von etwas Unwiederbringlichem. Sie fasste Emilia fest an der Hand und rief nach Nikolas, der mit neuerwachter Neugierde schon dabei war, diese völlig andere Welt zu erkunden. „Nick, bleib hier, wir schauen erstmal, wie es in unserer Wohnung aussieht. Und Lia, du auch… komm her.“ Emilia hatte unwillkürlich einige Schritte dahin getan, wo sie früher so oft hingelaufen war, um ihre Freundin Elsa zu besuchen. Sie wollte mit ihr reden, mit ihr spielen, ihr erzählen, was sie im Keller erlebt hatten. Und sie fragen, wie er ihr ging. Mit ihr lachen, Spaß haben. Die beiden Mädchen kannten sich schon lange, seit sie nebeneinander in derselben Straße aufgewachsen waren. Elsa war nur ein paar Monate älter als Emilia und sie waren zusammen an ihrem ersten Schultag Hand in Hand auf dem Schulhof gestanden und hatten ehrfurchtsvoll auf das alte, graue Gebäude geschaut, das etwas Strenges und Unnahbares ausstrahlte. In der Klasse saßen sie gleich nebeneinander und lächelten einander aufmunternd zu als die recht herb aussehende Lehrerin sie begrüßte. Emilia war froh und glücklich so eine Freundin zu haben, die sie so nahm, wie sie war. Klein und dicklich und anders als die anderen. Elsa selber war auch nicht sehr groß, hatte blonde, glatte Haare und eine niedliche Stubsnase, die irgendwie gen Himmel zeigte. Das sah lustig aus und man glaubte immer sie würde ständig lachen. Und sie hatten auch immer Spaß miteinander. Nie war es langweilig, wenn sie zusammen waren. Und jetzt? Emilia wollte zu gerne zu ihr rüber, doch da gab es kein Drüben mehr. Und - wo war Elsa?
*
In der Wohnung sah alles aus wie sonst. Merkwürdig wie normal alles wirkte, wo doch draußen alles anders war. Wie konnte es sein, dass mitten in dieser Verwüstung es noch so etwas wie eine Oase gab, wo alles friedlich und unbeschadet war. Irgendwie kam es Mathilda grotesk vor, mit einem Schlüssel die Wohnungstür aufzuschließen in dem Wissen, das nebenan kein Haus und keine Wohnungstür mehr existierten, die man hätte aufschließen können. Und dann empfing sie die heimelige Umgebung der vertrauten Wohnung mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr den Atem nahm. Mathilda schossen wieder Tränen in die Augen, aber sie wollte jetzt nicht weinen. Sie ließ die Kinder voranlaufen, die sofort in ihre Zimmer rannten um zu sehen, ob noch alles so war wie vorher. Nein - alles war nicht so wie vorher. Bei näherem Betrachten, wurde klar, dass auch ihre Behausung Blessuren davon getragen hatte. Die Fenster im Elternschlafzimmer waren zersprungen, auf dem Bett verteilten sich unzählige Scherben und Splitter, die Vorhänge hingen zerfetzt hinunter und flatterten im kühlen Morgenwind hin und her. In der Küche waren die Töpfe mit Blumen und Kräutern vom Fenstersims gefallen und zerbrochen, auch hier waren die Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Als Mathilda in die Wohnstube trat, sah sie als erstes die wunderschöne Kristallvase, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, am Boden liegen. Vorsorglich hatte sie die Vase auf das Polster des Sofas gelegt und dort für sicher befunden. Durch die Erschütterungen musste sie heruntergerollt sein, denn sie lag mitten im Raum auf dem Teppich. Lag da wie ein umgefallener Kegel. Mathilda ließ sich daneben auf die Knie sinken, berührte vorsichtig das glitzernde Glas, hob es empor. Es war heil und ganz. Ein Seufzer der Erleichterung entwich aus ihr. Behutsam stellte sie die Vase auf ihren alten Platz hoch auf die Anrichte neben das Schmuckkästchen, das dort stand und von oben herabschaute. Still. Beständig. Mit den Fingerspitzen fuhr Mathilda sacht über das feinverziertes Holzwerk und spürte die kleinen, spitzen Rosenstacheln in der Haut. Fühlte Vertrautheit und Nähe.
Die Kinder waren in ihren Zimmern verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Als Mathilda nach ihnen sah, lag Nikolas mit einem Buch versunken auf dem Bett. Emilia lag mitten im Zimmer auf ihrem Teppich, hatte ihre alte Puppe Lotta fest im Arm und schlief.
Mathilda atmete auf als sie nach kurzem Blick feststellte, dass beide Zimmer ohne Schäden geblieben waren. Sie nahm eine Wolldecke, breitete sie über Emilia und ging dann in die Küche. Dort setzte sie sich unglaublich müde auf die Küchenbank, legte nur für einen kurzen Moment den Kopf auf den Tisch und war sofort eingeschlafen.
*
Wie war der Mensch doch anpassungsfähig, dass er es schaffte, in noch so aussichtslos erscheinenden Situationen die Kraft aufzubringen, weiterzumachen. Das Leben zu leben, wie es gerade war. Zu atmen. Aufzustehen, weiterzugehen.
Sinn in dem wenigen zu finden, was sich ihm zum Leben bot. Wie anspruchslos war er letztlich doch. Wie genügsam. Da zeigte sich, mit wie wenig Dingen der Mensch doch in der Lage war zu existieren. Plötzlich war nur noch wichtig, dass man am Leben war und die Liebsten gesund und nah waren. Alles andere rückte in den Hintergrund.
Für Mathilda war das Wohlergehen ihrer Kinder das Hauptaugenmerk und das tägliche Überleben reduzierte sich auf die Versorgung der kleinen Familie. Die Dankbarkeit, die sich jedes Mal einstellte, wenn sie es geschafft hatte, dass die Kinder abends nahezu satt ins Bett gehen konnten, war überwältigend. Doch so schwierig es auch wurde, jeden Tag aufs Neue etwas Essbares zu besorgen, so war es doch auch eine große Beglückung, wenn es wieder gelungen war. Oft fügte es sich wie aus dem Nichts, dass ihnen immer wieder durch verzweigte Wege Lebensmittel zuflossen. Da war dann die Nachbarin, die Milch und Eier von Verwandten vom Land bekam und diese freizügig an die kleine Familie weitergab. Und die Pakete. Die Pakete von Josef, die wie ein rettendes Wunder von Zeit zu Zeit eintrafen und staunende Freude auslösten. Da kamen Schätze zu Tage, die mit Ehrfurcht ausgewickelt wurden: Butter, Kaffee, Schinken. Alles vom Vater eigenhändig eingepackt und mit aufmunternden Zeilen an Frau und Kinder verschickt.
Als das erste Paket eines Tages vor der Tür lag, blickte Mathilda verwirrt auf die bekannte Handschrift auf dem Papier. Strich ungläubig darüber und schluckte einen großen Klumpen im Hals hinunter, bevor sie das Paket aufnahm und dann für alle sichtbar auf den Küchentisch stellte. Dort ließ sie es stehen bis Emilia und Nikolas aus der Schule kamen, damit sie es alle gemeinsam auspacken konnten. Die Freude der Kinder als sie es sahen, übertraf noch die ihre und sie legte still berührt ihre Arme um die beiden.
Irgendwann löste sich das andächtige Betrachten und dann gab es kein Halten mehr. Die Kinder überholten sich gegenseitig beim Aufreißen und Auspacken, jubelten bei jedem neu entdeckten Wunder. Mathilda sah ihnen zu, lächelte in sich hinein und schickte in Gedanken einen Strom von liebender Dankbarkeit zu ihrem Mann, der aus dem fernen Polen die Verbindung zu ihnen durch diese Gabe greifbar und spürbar werden ließ. Das Wissen um diese innere Verbindung gab ihr Halt, wenn sie mitunter mit Verzweiflung und Mutlosigkeit kämpfte und sich vor dem nächsten Tag, der nächsten Nacht fürchtete.
Neben den Paketen waren es die Briefe, die nun recht regelmäßig zwischen den Eheleuten hin- und hergingen. Mathilda war es bald ein unbedingtes Bedürfnis, sich abends, wenn die Kinder schliefen, an den Küchentisch zu setzen und mit ihrer kleinen Schrift Seite um Seite zu bedecken, die immer mit den Worten: Mein lieber Josef begannen und ihm dann in allen denkbaren Einzelheiten zu beschreiben, wie es ihnen hier ging. Ihr war es eine Erleichterung, dem Papier und somit dem weit entfernten Lebensfreund das anzuvertrauen, was sie niemanden sonst zu sagen wagte. Sie verheimlichte ihm auch ihre Sorgen nicht, denn sie wusste, dass er auch zwischen den Zeilen würde lesen können, wenn etwas nicht stimmte. Und so war die Offenheit, mit der sie alles aus sich herausfließen ließ, zugleich ein Zeichen für die Seelenverwandtschaft und Vertrautheit zwischen ihnen, die er, Josef, allerdings eher mit Taten als mit Worten zurückgab – so wie es ihm vom Temperament eher stand.
Es konnte geschehen, dass Mathilda stundenlang am Tisch saß und schrieb ohne müde zu werden, mochte der Tag noch so anstrengend gewesen, die Nacht davor wieder durch etliche Alarme unterbrochen worden sein. Das Schreiben befreite sie von allem Druck und hinterließ in ihr eine Erleichterung als ob sie mit dem geliebten Mann tatsächlich geredet hätte, mit ihm die Sorgen und Nöte von Angesicht zu Angesicht besprochen. Meist schlief sie hinterher tief und fest – bis der nun allnächtliche Alarm sie herausriss und sie in großer Eile die Kinder weckte und mit ihnen in den Keller zog. Mittlerweile hatte sich auch das zu einer Art Routine entwickelt. Längst schon schliefen sie alle in ihren Kleidern und liefen dann wie in Trance automatisch die Treppen hinunter in den Schutzkeller, hin zu ihren Pritschen und mit Glück hin zu einem schlafähnlichen Zustand.
Nach dem furchtbaren Angriff vor einigen Wochen, schienen sich die Kinder eine Schutzhülle umgeworfen zu haben, die es ihnen erlaubte, in gnädigem Schlaf einzutauchen, auch wenn die Welt oben scheinbar wieder in den nächsten Untergang versank. Mathilda war dafür sehr dankbar, auch wenn es ihr selber oft nicht gelingen wollte, sich wie die Kinder in die Arme des Schlafgottes zu flüchten. Wenn es das schwache Licht gestattete, schrieb sie in ihr festgebundenes Buch mit den linierten Seiten, das ihr neben dem Briefeschreiben half mit den Erlebnissen umzugehen, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen. Das, was sie alle hier durchmachten, war eine Geschichte von fundamentaler Weite, die auch für kommende Generationen noch von großer Bedeutung sein würde, dass spürte sie und ahnte, dass es wichtig war das alles festzuhalten um denen, die nachkamen Zeugnis zu geben von dem Grauen, dem Leid, der Unvorstellbarkeit dieses Krieges.
Gleichzeitig war sie sich bewusst, dass es solange die Menschheit existierte, es immer Auseinandersetzungen und Krieg gegeben hatte und wahrscheinlich immer geben würde. Wahrscheinlich würde es immer jemanden geben, der meinte, Macht über andere ausüben zu müssen, sich Menschen und Länder jenseits der Grenzen des eigenen Landes einzuverleiben. Mathilda hatte nie verstanden, was solche Menschen dazu trieb, in dieser Art auf andere zu wirken. War das mit einer krankhafter Veranlagung zu erklären, der das Hirn eines Diktators zu derartigen Handlungen trieb, die für einen normalen Menschenverstand nicht greifbar waren. Oder war diese Erklärung zu einfach für eine Menschenspezies, die sich wie ein gefräßiges Untier durch alle Epochen und Nationen zog.
Möglich, dass es müßig war, eine Antwort darauf finden zu wollen, weil es keine gab. So grauenvoll die Erkenntnis war, schien es doch, als gehörten auch diese Individuen zum Teil der Menschheit, auch wenn sie selber kaum menschliche Züge trugen.
Früher hatte Mathilda immer an das Gute im Menschen geglaubt, darauf vertraut, dass letztlich jeder nur in Frieden sein Leben leben wollte, mit sich und seinen Mitmenschen in wohlwollendem Nebeneinander. Eine Illusion und eine große Erschütterung ihres Seinsempfinden, die sie persönlich traf als Nachbarn, die sie seit Kindestagen kannten, von einem Tag auf den anderen verschwanden, und keiner sagen konnte, warum und wohin. Die Inhaberin des Schreibwarenladens, in dem sie jahrelang stundenweise gearbeitet hatte und die immer nett und liebenswürdig mit ihr und der kleinen Emilia gewesen war, wurde mitten am Tag aus ihrem Laden gezerrt. Mathilda hatte sich nie darum gekümmert, welcher Religion sie angehörte. Zwar hatte sie geahnt, dass Frau Rosenbaum jüdischer Herkunft war, doch das war für sie nie von Belang gewesen. Für sie zählte einzig, dass sie nett und liebenswürdig war und für sie eine gute ältere Freundin. Der Schock war groß als sie vor dem kleinen Laden stand, dessen Scheiben vollständig eingeschlagen waren, die Wände beschmiert mit großen ausfallenden Buchstaben. „Judensau“! stand da rot und blutend geschrieben wie ein Schrei der Hölle.
Seitdem hatte sie Frau Rosenbaum nicht mehr gesehen.
*
So vieles ging verloren. Menschen, Städte, Existenzen, Leben. Ganze Welten stürzten zusammen. Äußerliche und innerliche. Wobei nicht auszumachen war, welches der größere Zusammensturz war. Eine Erschütterung unvorstellbaren Ausmaßes erfasste Körper und Seelen. Niemand blieb davon unbehelligt.
Auch Emilia musste in ihrem jungen Alter damit klarkommen, dass sich um sie herum Dinge ereigneten, die sie kaum benennen konnte. Die nächtlichen Bombenangriffe waren das eine. Das andere waren die Veränderungen in der Stadt. Straßen, die plötzlich nicht mehr da waren, Häuser, die sich verwandelt hatten in einen Berg von Steinen, Geröll, Rauch, Asche und Verwesung. Und das plötzliche Nicht-mehr-Sein von Menschen, die eben noch nebenan gewesen waren. Gelacht hatten, geweint, gestritten, geliebt und mit Augen und Mund zu ihr gesprochen hatten. Mit Herz und Gefühl, Leib und Seele. Die Freunde waren, Vertraute. So selbstverständlich da. So gewohnt seit immer, für ewig.
Elsa und sie hatten niemals so etwas wie Blutsbrüderschaft geschlossen, wie das Nikolas mit seinen Freunden getan hatte. Nicht, dass sie sich gefürchtet hätten, vor dem Ritz in die Haut, vor dem Blut, das daraus hervortropfte. Nicht, weil sie als Mädchen, so etwas nicht wagten. Nein – nur allein deswegen, weil sie spürten, dass es für sie beide nicht nötig war. Sie fühlten sich von einem Blute, von einer Seele, auch ohne äußeres Ritual. So jung sie waren, waren sie doch altvertraute Verwandte, die sich im Hier und Jetzt begegneten und schon begegnet waren in einem vorigen Sein.
Sie als Kinder hätten das alles so nie benennen können, doch eines Tages war ihnen das durch einen leicht dahingesagten Ausspruch, sehr klar geworden.
„Unsere Siamesischen Zwillinge. Einfach nicht zu trennen.“
Es war in den heißen Sommertagen gewesen, kurz vor dem Krieg, wo noch alle unbedarft und leicht die schöne Zeit genossen. Die beiden Nachbarfamilien waren zusammen an den Tegeler See gefahren, picknickten dort und tobten sich im kühlen Nass aus.
Emilia und Elsa rannten die ganze Zeit Hand in Hand über die Wiese, ließen sich auch im Wasser nicht los. Als sie tropfnass auf die Decken unter den schattigen Bäumen sanken, unter denen sich die Familien niedergelassen hatten, lachte ihnen Elsas Vater entgegen, umfing sie beide trotz der Nässe und nannte sie die siamesischen Zwillinge.
Erst blickten die beiden ihn ungläubig an, sahen sich in die Augen, lachten. Und erkannten sich urplötzlich in der anderen gespiegelt.
Siamesische Zwillinge kamen zusammengewachsen auf die Welt, konnten nicht oder nur sehr schwer getrennt werden, ohne dass nicht mindestens einer von ihnen Schaden davon trug oder starb und der andere kaum mehr lebensfähig war. Das hatten die beiden Mädchen erfahren als sie wissen wollten, was das bedeutete: siamesische Zwillinge.
Erst waren sie von dem Bild des Zusammengewachsen-Seins zurückgeschreckt, doch dann schien es ihnen eine wundervolle Vorstellung, so immer mit demjenigen zusammen sein zu können, den man am meisten mochte. Schließlich gefiel ihnen das so sehr, dass sie sich immer mehr in diese Symbiose hineindachten und -lebten. Dadurch wurde es anderen immer schwieriger, jede für sich zu sehen. Und für die beiden Mädchen wurde es mit der Zeit immer undenkbarer, etwas ohne die andere zu tun. Schlimm genug, dass sie sich zu den Mahlzeiten und abends trennen mussten, doch sie wussten ja, es gab ein Morgen.
Krieg. Was konnte er ihnen schon antun? Sie hatten keine Vorstellung, was dieses Wort genau in sich barg. Sie hörten von Soldaten, Gewehren, Bomben, vom „Feind“, wer auch immer das war. Sie hörten von Zerstören, Töten und getötet werden. Und dieses Wort: Tod. Tote Menschen kamen nicht wieder, existierten nicht mehr in dieser Welt, waren nicht mehr hier. Wo aber waren sie? Sie konnten doch nicht einfach so verschwunden sein. Irgendwo mussten sie sein.
Emilias Verstand fasste dieses Phänomen nicht. Und sie erfasste nicht, warum Elsa mit einem Mal nicht mehr da war. Sie erfasste nur jetzt in aller Deutlichkeit, was es hieß, von seinem Zwilling getrennt zu sein. Allein zu sein, ohne die andere Hälfte, die zu ihr gehörte. Sie fühlte sich als habe man ihr einen Teil von ihrem Körper abgetrennt und schlimmer noch von ihrer Seele.
An dem Tag als die Mutter sie zu sich auf den Schoss zog, sie fest an sich drückte und ihr leise sagte: „Elsa lebt nicht mehr“ – da hatte sie unbewusst mit einem Teil ihres Kindseins abgeschlossen. Von da an verlor sie ein Stück von ihrer Leichtigkeit.
*
Das war eine weitere Auswirkung des Krieges - alles ging irgendwie schneller. Das Wachsen, das Älter-Werden, das Sterben. Eine unbeschwerte Kindheit, die noch vor einigen Jahren möglich war, gab es nicht mehr. Selbst die ganz jungen Kinder wurden unweigerlich in den Sog des ungesunden Wandlungsprozesses gezogen, der alles rasend schnell veränderte. Nie war man sicher, was am nächsten Tag noch da war, wer noch da war. Der, den man eben noch gesprochen hatte, konnte im nächsten Moment verschwunden sein. Das Haus an der Ecke, an dem man verbeigegangen war, solange man denken konnte, war plötzlich zusammengesunken zu einem Haufen Steine, der nichts von dem zu erkennen gab, was gewesen war. Und das Wesen der einzelnen Menschen wandelte sich. Freundliche, liebenswerte Nachbarn, zeigten Gesichter, die nicht mehr die ihren sein konnten, sprachen Sätze, die wie ferngesteuert und einstudiert klangen, schlugen die Hacken zusammen, hoben die Arme wie aufgezogenen Puppen und skandierten Worte und Parolen voller Härte und Unbedingtheit.
Mathilda zog ihre Kinder in den nächsten, sicheren Hauseingang, wenn sie einen Aufmarsch der nationalsozialistischen Anhänger patrouillieren sah. Duckte sich mit ihnen in dunkle Ecken, hielt ihre Arme verschränkt und den Kopf gesenkt. Erst wenn die harten Klänge der Marschstiefel verklungen waren, atmete sie auf, nahm die Kinder an die Hand und hing weiter ihres Weges.
Emilia und Nikolas fragten nie, warum sie sich versteckten, aber sie spürten die unheilvollen Wellen, die von den Marschierenden ausging und die Angst der Mutter. Und wenn diese Angst hatte, musste es einen guten Grund geben. Einmal hatte sie die Kinder beiseite genommen und ihnen gesagt, dass dieser Mann, dieser Hitler, keine guten Dinge tat und dass sie alle niemals seine Anhänger sein würden. Er hatte den Krieg mit der Welt angefangen und er ließ Menschen aus dem eigenen Land verschwinden. Wohin wusste niemand so genau. Man sprach von Lagern, in denen sie zusammengetrieben wurden und aus denen sie nicht lebend wiederkamen.
Mathilda hatte sich dazu entschlossen, ihren Kinder so viel wie möglich und nötig zu sagen, damit sie verstanden, warum sie in manchen Situationen so und nicht anders reagieren konnte. Und die Kinder hatten verstanden. „Ist Frau Rosenbaum auch in so einem Lager?“ hatte Emilia gefragt. „Das ist möglich“, hatte Mathilda geantwortet, „aber genau weiß ich es nicht.“
„Und warum? Was hat sie getan?“ Nikolas wollte mehr wissen.
„Nichts“, sagte Mathilda, „sie hat nichts getan. Nur, dass sie Jüdin ist.“
Das hatten die Kinder nicht verstehen können. Wer konnte es schon. Doch sie selber mussten spüren, dass es scheinbar ein großes Verbrechen war, Jude zu sein. Als sie zu dritt eines Morgens durch Straßen gingen, die sie so gar nicht mehr kannten, kam ihnen ein Mann entgegen. Sie waren schon fast wieder an ihm vorbei, als er sich umdrehte. „Judenbrut“, schoss er wie einen giftigen Pfeil auf sie ab. Mathilda bemühte sich um Ruhe, zog die Kinder hinter sich her. Lief hastig weiter, das Herz wie wild klopfend.
„Was meint der Mann?“ fragte Emilia. Mathilda antwortete nicht, lief und zog die Kinder. „Mama! Nicht so schnell…“ Emilia keuchte. Da stoppte Mathilda, sah sich vorsichtig um. Der Mann war weg.
„Tut mir Leid, Lia.“ Sie lehnte sich an eine Hauswand.
„Warum hat er das gesagt?“ wollte Nikolas wissen. „Und warum war er so böse?“ „Er hat uns für Juden gehalten… wahrscheinlich weil Emilia und ich schwarze Haare haben.“ Mathilda fuhr ihrem Sohn über dessen helles Haar, das er von seinem Vater geerbt hatte. „Ein Judenhasser, wie so viele jetzt.“ Plötzlich wurde sie von einer Emotionswelle überschwemmt. Sie kämpfte mit den aufsteigenden Tränen in ihren Augen. Nikolas sah sie ernst und wissend an und legte mit einer sehr erwachsenen Geste seine Hand auf ihren Arm.
*