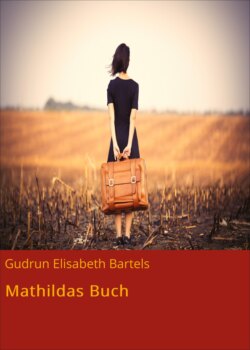Читать книгу Mathildas Buch - Gudrun Elisabeth Bartels - Страница 7
Marissa
ОглавлениеIm Zimmer war es kalt. Sie fror trotz der Decke, in die sie sich eingewickelt hatte, trotz des Tees, den sie während des Lesens getrunken hatte bis sie vergaß, sich nachzuschenken und der Rest in der Kanne abgekühlt war. Vielleicht fror sie auch wegen der Tränen der Urgroßmutter, wegen des ungewissen Schicksals der Großmutter und ihres Bruders, wegen des ganzen Leids, wegen des Krieges. Sie spürte die Kälte wie eine eisige Hand, die aus der Vergangenheit nach ihr griff und sie nicht losließ.
Das Buch mit den vollgeschriebenen Seiten lag aufgeschlagen auf ihrem Schoß, doch sie konnte nicht mehr weiterlesen. Die Wörter kamen ihr vor wie grausame kleine Monster, die ihre Buchstaben wie Pfeile von sich schossen und denjenigen mitten ins Herz trafen, der sie las. Vorsichtig als würde sie sich dabei verletzen können, klappte sie das Buch zu, schob es unter die Decke, ließ sich dann lang auf das Sofa sinken, hüllte sich fest ein und schlief erschöpft ein.
Ein oberflächlicher Schlaf umfing sie, schickte ihr unruhige Bilder von getriebenen Menschen und drohender Gefahr. Ließ sie durch Welten eilen, die ihr fremd waren und doch so viel von ihr hatten. Und so viele Gesichter blickten sie an, bekannte und unbekannte. Alle sahen sich irgendwie ähnlich. Waren wie ein Gesicht, das sich laufend veränderte. Mathilda-Emilia-Juliane-Sandrina-Marissa… MARISSA!
Die Namen wirbelten ihr durch den Kopf, vermischten sich zu einem großen Durcheinander, bis nur noch einer übrig blieb und nicht verschwand. „Issa!“
Marissa zuckte bei dem Laut heftig zusammen, eines ihrer Beine rutschte dabei vom Sofa, sodass sie beinahe selber hinunterfiel. Verwirrt blickte sie um sich und sah die Großmutter vor sich stehen. „Kind, du bist ja ganz durcheinander. du hast wie wild um dich geschlagen.“
Marissa versuchte sich zu sortieren, zog ihre Beine an sich, umschlang sie, hielt sie fest, hielt sich fest. Ihr Blick fiel auf das Buch, das bei ihren Bewegungen auf den Teppich gefallen war, die Seiten hatten sich geöffnet und blickten sie an.
Emilia folgte ihrem Blick. „Du hast darin gelesen.“ Sie bückte sich, hob das Buch auf, hastete rasch mit den Augen über die Zeilen, die sich ihr darboten und schloss den Deckel darüber. Sie behielt das Buch fest an sich gedrückt als sie sich neben die Enkelin auf das Sofa setzte.
Marissa nickte ohne die Großmutter anzusehen. Es gab keine Worte, die ihr passend erschienen, jetzt zu sagen. Auch die Großmutter schwieg. So saßen sie nebeneinander in der dämmrigen Stube und lauschten dem Regen, der nach wie vor unvermindert gegen die Fenster prasselte. Die alte Frau, das junge Mädchen, die Großmutter und die Enkelin, Emilia und Marissa. Zwei Frauen von einem Blut, von einer Familie. Getrennt durch Lebensjahre, verbunden durch eine Geschichte. Eine Geschichte, die die eine durchlitten hatte und die andere weiterführte. Die alte, die den Schmerz hinter sich gelassen hatte und die junge, die ihn gerade durchschritt. Ein sich wiederholender Kreislauf, der wie alles immer und immer wieder begann, scheinbar ohne zu enden. So wie jeder Tag begann, wurde und verging - so wie das Leben selbst.
*
Marissa fühlte sich oft wie ein Opfer, ein Sklave des Schicksals, das mit ihr machte, was es wollte. Und sie war unfähig, zu handeln, etwas zu tun um sich aus diesem unsichtbaren Gefängnis zu befreien. Sie verstand das nicht. Sie verstand sich nicht. Warum nahm sie diese Demütigung hin, unterwarf sich einem Gegner, den es vielleicht gar nicht gab. Ober der gar kein Fremder war, der vielmehr in ihr wohnte und sie von innen her bedrohte.
Jetzt, wo sie das Tor zur Vergangenheit ein Stück weit aufgestoßen hatte, schlich sie die Ahnung einer Erkenntnis ein, die ihr sagte, dass sie kein Opfer war, dass alles weit entfernt von ihr seinen Ursprung hatte und doch noch Einfluss auf sie und ihr Leben hatte. Sie hätte sich frei fühlen können, denn wieviel leichter und unbeschwerter war doch alles jetzt. Kein Vergleich zu dem, was die Menschen damals hatten durchmachen müssen. Damals, wo jeder Tag ein Kampf ums Überleben war. Wie ungleich leichter war das Dasein heute.
Als Marissa abends im Bett lag und aus dem Fenster in den Himmel blickte, der sich jetzt wieder frei von Wolken über ihr ausbreitete, fühlte sie sich hin- und hergerissen von Schuldgefühlen ihren Verwandten gegenüber und allen denjenigen, die durch Krieg, Hunger und Not tagtäglich bedroht waren – und ihrer eigenen wehen Geschichte, die ihr bis heute so schrecklich erschienen war. Ja – sie hatte schon viel durchlitten, das war die Wahrheit und es tat weh daran zu denken. Es würde wohl immer wehtun. Und wie sollten die Menschen, die den Krieg durchlebt hatten, dies alles je vergessen. Würde es nicht immer präsent sein, auch wenn es mit den Jahren möglicherweise in dunklen Nischen verschwand, die nicht so leicht zu betreten waren, doch die da waren und von deren Existenz man wusste. Marissa lief ein Schauer über den Rücken.
Lange lag sie wach, dachte an die kleine Emilia und ihren Bruder, dachte an ihre Urgroßmutter Mathilda, die sie nur als lachendes Bild kannte und dachte mit einem Mal auch an ihre Mutter. In der Herzgegend verspürte sie dabei ein Ziehen und ein Gefühl der Leere wie so oft, wenn sie an sie dachte. Mit einem Mal kamen ihr die Tränen. Das Verhältnis zwischen ihnen beiden war nie sehr eng gewesen. Immer schien da eine unsichtbare Mauer zu sein, die sie trennte. Eine Fremdheit, ein Unverständnis. Und ihr, Marissa, war das eigentlich immer recht egal gewesen. Sie hatte nie das wirkliche Bedürfnis gehabt, der Mutter nah zu sein. Und diese zog auch deutlich ihre jüngere Schwester Sandrina vor.
Doch das machte ihr nichts, denn sie hatte ihren Vater. Mit ihm war sie von klein auf eng verbunden, zu ihm fühlte sie sich hingezogen, mit ihm hatte sie Spaß. Er verstand sie. Auch ohne viele Worte. Er war ihr Held.
So war die Familie in zwei Hälften geteilt. Sandrina und die Mutter, Marissa und der Vater. Und alles war gut so.
Bis dann alles anders wurde. Bis alles plötzlich auseinander brach, ohne Vorwarnung. Einfach so.
Marissa schob der Erinnerung einen Riegel vor. Sie war nicht bereit, sich damit auseinander zu setzen. Jetzt nicht. Nicht hier im Dunklen, was alles nur noch schwärzer machte. Vielleicht sollte sie doch mit einem Therapeuten darüber reden, so wie Dr. Schmidtmann es empfohlen hatte. Mit ihm zu reden, hatte ihr gut getan, ihm hätte sie mit der Zeit alles erzählt, was sie bedrückte. Zu ihm hatte sie Vertrauen, fühlte sich emotional zu ihm hingezogen. Sie mochte sein jungenhaftes Lachen, seine Lockerheit. Sie dachte immer wieder an ihn, auch wenn sie noch seine deutlichen Worte in den Ohren hatten, die ihr sagten, dass er nicht der Richtige für ihre Probleme wäre. Aber sie hatte auch das Bedauern in seiner Stimme gehört als er betonte, dass es ihm Leid täte, wenn er möglicherweise Erwartungen geschürt hätte. Und ganz zum Schluss sagte er noch: „Ich mag dich sehr, Marissa.“
Da hatte ihr Herz schneller gepocht und gleichzeitig hatte sie ganz tief in sich einen feinen Stich verspürt. Immer wenn sie in Gedanken seine Stimme hörte, war auch er gleichzeitig da - dieser Stich.
*
Die Sonne. Sie war wieder da. Als Marissa am nächsten Morgen die Treppe hinunter ging, kam ihr das Licht von draußen schon entgegen. Die Großmutter saß auf der Terrasse am gedeckten Frühstückstisch und trank Kaffee. Marissa setzte sich zu ihr auf die Bank, kuschelte sich ganz nah an sie. „Gut geschlafen, meine Süße?“ fragte Emilia.
Marissa schüttelte den Kopf. „Ach, nein – nicht so gut. Ich musste so viel denken.“
„Denken. Ja, das musste ich auch. Meine Nacht war auch kurz.“ In der Tat sah Emilia sehr müde und grau aus.
„Ich würde dich gerne so viel fragen, Oma.“
„Das glaube ich. Dich hat das Lesen wohl sehr aufgewühlt, nicht wahr?“ Emilia zog die Enkelin nah zu sich. „Aber jetzt frühstücke erstmal, dann können wir über alles reden und vielleicht willst du dann noch weiterlesen.“ Sie stand auf. „Ich koche dir erstmal einen Tee.“
„Das kann ich doch machen…“ Marissa wollte aufspringen aber die Großmutter machte eine abwehrende Geste. „Nein – bleib sitzen. Bewegung tut mir gut.“
Sie hatte Hunger. Gestern hatte sie gar nicht mehr viel gegessen, ihr hatte es den Magen zugeschnürt, was sie gestern aus dem Buch erfahren hatte. Und auch jetzt war es schwer für sie, das Frühstück ausgiebig zu genießen, doch ihr Körper forderte Nahrung und so ließ sie sich verführen von dem, was die Großmutter wieder so liebevoll aufgetischt hatte. Kater Teo war aufgetaucht und schnurrte um ihre Beine, wollte aber keine längeren Streicheleinheiten. Irgendetwas lenkte ihn ab. Schon nach einem kurzen Augenblick wandte er sich ab und sauste geschwinde über den Rasen davon.
„Hey, was ist los?“ rief Marissa hinter ihm her, „Warum so eilig?“ Aber da war der Kater schon im Gebüsch verschwunden. „Ulkiges Tier“, murmelte sie vor sich hin, mit den Gedanken bereits ganz woanders.
Als sie der Großmutter half das Geschirr abzuräumen, hielt sie inne. „Gehen wir an den Strand? Ich möchte gern wieder ans Meer.“
„Ein Spaziergang wäre nicht schlecht. Doch wir müssen sehen, wie es nach dem gestrigen Regen am Strand aussieht. Ich ziehe auf jeden Fall meine Gummistiefel an.“
Alles war nass. Doch der Regen hatte die Luft gewaschen, die in den letzten Tagen sehr schwer gewesen war. Marissa atmete tief ein und auch Emilia genoss die salzhaltige Brise vom Meer. Es war Ebbe und sie konnten ins Watt hineinwandern. Marissa lief barfuß und ließ ihre Zehen voller Wonne im braunen Schlick versinken. Eine Weile wateten sie schweigend nebeneinander her den Blick auf die weite Ebene des wasserlosen Meeres gerichtet. Der Augenblick war so ruhevoll und friedlich, so erdverbunden stark. Zu schade eigentlich um ihn mit Worten zu stören. Doch in Marissa saßen die Fragen übereinander und wollten hinaus.
„Damals dort im Keller. Kannst du dich daran erinnern wie es war als diese schrecklichen Angriffe waren?“
Emilia antwortete nicht gleich, schien in sich nachzuforschen, was da war, ob sich etwas zeigte, was sie selber noch sehen wollte. „Wenig“, sagte sie dann nach einer Weile. „Da ist so ein Gefühl und ein Bild ohne wirkliche Konturen. Mehr so eine Ahnung und ja – doch Angst. Angst ist da…“
Marissa hörte wie die Stimme der Großmutter beim Aussprechen des Wortes beschlug. Vielleicht hätte sie nicht fragen sollen, aber sie musste es wissen und sie musste noch etwas wissen. „Oma?“ Sie waren eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen. „Darf ich noch was wissen?“ Sie blickte die Großmutter etwas unsicher von der Seite an. Aber diese nickte. „Du darfst alles wissen. Frag nur.“
„Also… wie genau war das als du… deine Freundin, diese Elsa verloren hast? Du warst doch sicher sehr traurig?“
Emilia blieb stehen, drehte sich hin zur Enkelin und ihrer Frage. „Ja. Ich war sehr, sehr traurig. Sie war mehr als eine Freundin. Sie war meine Seelenschwester. Ich habe danach im Leben nie wieder so jemanden gefunden wie sie. Später in Ostpreußen gab es noch ein Mädchen – Erika, mit der habe ich mich auch sehr angefreundet. Aber so wie mit Elsa war es nicht. Und auch später als Jugendliche und Erwachsene habe ich niemals eine zweite Elsa gefunden…“
Emilia hielt inne in der Bewegung, beim Sprechen. Sie griff nach Marissas Hand.
„Lass uns zurückgehen.“ Ihre Stimme klang mit einem Mal noch rauer als sonst. „Ich bin müde.“ Marissa sah die Großmutter besorgt von der Seite an, sagte aber nichts. Wortlos nahm sie ihren Arm und führte sie zurück. Sie fühlte sich mit einem Mal sehr viel gebrechlicher an als sonst, so viel älter, kleiner, verletzlicher. Marissa spürte eine unbestimmte Unruhe in sich aufsteigen, eine unerklärliche Besorgnis. Die Großmutter war nicht mehr jung. Im Dezember würde sie 80 Jahre alt werden. Normalerweise sah man ihr es nicht an. Doch heute schimmerte etwas durch ihre Haut, das sie plötzlich um einiges älter erscheinen ließ. Schon am Frühstückstisch war es Marissa sehr bewusst geworden, wie viel gelebtes Leben die Großmutter schon hinter sich hatte. Und jetzt in diesem Moment im Watt, mit dem sonnendurchwärmten Meerwind im Rücken und dem Wissen von so viel Unvorstellbarem, sah sie, wie klein diese war, wie klein sie beide. Wie winzig. Mit einer impulsiven Bewegung schlang sie ihre Arme um die alte Frau, hielt sie fest, ganz fest, wollte sie nicht mehr loslassen. Und die Großmutter schlang ebenso die Arme um das junge Mädchen, wortlos und bewegt.
Sie sprachen lange nicht, gingen langsam über den Strand zurück, den Bohlenweg hinauf zu den Dünen. Erst als die schon vor der Haustür mit dem wunderbaren Türklopfer standen, ließen sich ihre Hände los, die sich den ganzen Weg über ineinander verschlungen hatten.
Den ganzen Tag über sprachen sie wenig, obwohl sowohl Marissa als auch Emilia spürten, dass der Gang der Erinnerung fortgesetzt werden musste, jetzt wo er begonnen hatte. Jetzt stehenzubleiben hieße wahrscheinlich, dass es lange dauern würde, bis wieder eine Gelegenheit kam, um das auszusprechen, was ausgesprochen werden wollte. Vielleicht war jetzt überhaupt die einzige Gelegenheit dazu.
Nach dem Mittagessen legte sich Emilia wie üblich eine Stunde hin, Marissa zog sich mit dem Geschichtenbuch in den Garten zurück. Sie zögerte aber es wieder aufzuschlagen. Irgendwie hatte sie das Bedürfnis, erst noch von der Großmutter zu hören, was sie noch wusste. Falls sie es ihr sagen wollte. So ließ sie das Buch erstmal beiseite, griff stattdessen endlich zu ihrem Lehrbuch, das sie ganz unten im Rucksack verstaut hatte als sie so überstürzt aus München geflüchtet war. Die Semesterferien würden bald vorbei sein und sie hatte die Zeit bisher nicht genutzt, um zu lernen, wie sie sich eigentlich vorgenommen hatte. Es war ja auch alles so anders gekommen, hatte sie so durcheinander gewirbelt, dass sie sich nicht mit der Anatomie und Physiologie von Kleintieren befassen konnte. Auch jetzt kostete sie es Überwindung, die Seiten des Lehrbuches aufzuschlagen. Doch dann war sie augenblicklich in der Welt der tierischen Körperlichkeit eingetaucht. Die Faszination, die davon ausging, hatte sie von Anfang an in ihren Bann gezogen. Es wurde ihr nie langweilig auf Entdeckungsreise zu gehen, um dieser auf die Spur zu kommen. Darüber konnte sie schnell die Zeit und alles um sich herum vergessen.
Heute gelang ihr das allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann bemerkte sie, wie ihre Gedanken abschweiften hin zu den Ereignissen von vor über siebzig Jahren. In eine Zeit, wo sie selber noch nicht da war, die sie nicht kannte aber sie magisch anzog obwohl sie eine furchterregende Ausstrahlung auf sie hatte. Aber sie hielt sie fest. Sie konnte solange davon nicht weg bis sie alles erfahren hatte, was sie erfahren musste.
Sie wollte gerade das Lehrbuch schließen um das Buch der Vergangenheit aufzunehmen als ihre Großmutter auf die Terrasse heraustrat. Scheinbar hatte sie ihre Mittagsruhe schon beendet. Mit langsamen Schritten kam sie die leichte Senkung zum Rasen hinunter. Neben dem Liegestuhl blieb sie stehen.
„Oma, hast du schon ausgeschlafen?“ Marissa blickte sie neugierig an, spürte, dass Emilia etwas auf der Seele brannte.
„Ja. Nein….Ich…“ Sie unterbrach sich, zeigte auf das Lehrbuch auf Marissas Schoss: „Stör ich dich beim Lernen?“
„Ach, nein. Ich kann mich nicht konzentrieren.“ Marissa schlug das Buch demonstrativ zu.
„Dann habe ich einen Vorschlag. Lass uns einen Ausflug ans andere Ende der Insel machen. Knut kutschiert uns, ich hab ihn schon angerufen. In der Meierei gibt es leckeren Kuchen. Von meinem ist ja nichts mehr übrig.“ Sie lachte etwas unsicher und fügte dann hinzu: „Und dann erzähle ich dir weiter, wenn du magst.“
„Gute Idee.“ Marissa sprang sofort auf. Das Lehrbuch ließ sie achtlos liegen. Das Geschichtenbuch nahm sie mit.
*
Die zwei Haflinger trabten mit gemächlichem Hufschlag voran, zogen den Wagen scheinbar mühelos und mit großer Lässigkeit hinter sich her. Eile kannten sie nicht, wie auf der ganzen Insel Zeit kaum eine Rolle spielte. Alles lief gemächlich und ruhig vor sich hin. Scheinbar liefen die Uhren hier langsamer, waren die Menschen gelassener und ausgeglichener als die Bewohner auf dem Festland. „Immer mit der Ruhe“ – das schien das Motto zu sein. Und so war es hier auch. Ruhig, friedlich und entspannt.
Marissa saß zufrieden zurückgelehnt auf dem Pferdewagen, schaute lächelnd über die weite Ebene hin zum Meer, zum Horizont und immer weiter.
Knut pfiff fröhlich vor sich hin. Ab und zu machte er die beiden Frauen auf etwas aufmerksam, was seiner Meinung nach sehenswert war. Ein Vogel, eine Erhebung, ein Tümpel, ein alter Kahn. Dann schwieg er wieder oder pfiff sein Lied. Emilia saß zwischen den beiden und ließ ihre Gedanken wandern, voraus den Weg entlang und schließlich zurück, zu dem was sie beschäftigte, was in ihrer Erinnerung schemenhaft lebte.
Irgendein innerer Drang hatte sie dazu gebracht, der Enkelin das Buch zu geben, mit ihr über die Vergangenheit zu sprechen. Es war ihr einfach stimmig erschienen und war in einem Moment der absoluten Sicherheit geschehen. Jetzt, wo dieser eine Moment vorbei war, war da der nüchterne Verstand, die Fragezeichen, die sich auftaten. Doch eigentlich waren sie hinfällig. Längst hatte sie etwas ins Rollen gebracht, was nicht mehr zu stoppen war. Und sehr wahrscheinlich sollte es so sein. Ja – ganz sicher.
Mit einem Mal war sie völlig entspannt und ruhig. Lehnte sich gelöst zurück und überließ sich dem Augenblick.
Bei der Meierei angekommen, ließ Knut sie absitzen, wobei er Emilia unterstützend die Hand reichte und auch Marissa behilflich sein wollte. Aber die lachte nur und sprang behende vom Sitz. Dass ihr noch empfindlicher Knöchel das mit einem kleinen Stich quittierte, störte sie nicht.
„Ich hole euch in zwei Stunden wieder ab“, versprach Knut, der es ablehnte sich kurz mit ihnen in die Meierei zu setzen. „ Hab noch zu tun“, meinte er brummelnd, „aber lasst es euch man gut gehen. Bis denn.“ Er winkte ihnen zu während er die Pferde zum Wenden antrieb. Marissa sah ihm grinsend nach, irgendetwas an dem alten Brummbär reizte sie immer zum Lachen. Auch Emilia schmunzelte. „Irgendwie war er heute seltsam“, meinte sie nachdenklich. „Sonst redet er mehr und pfeift nicht. Nun ja – komm wir gehen rein.“
*
Pflaumenkuchen mit Schlagsahne. Tee auf dem Stövchen. Brauner Kandis. Marissa fühlte sich so wohl, dass sie meinte vor Wohlbefinden gleich davon zu schweben. Die Großmutter saß ihr gegenüber, rührte in ihrer Kaffeetasse und lächelte ihr zu. Auch sie schien sich überaus wohl zu fühlen.
„Ich war lange nicht hier“, sagte sie und sah sich ausgiebig im Raum um. „Muss Jahre her sein. Wahrscheinlich noch mit Julius. Da sind wir öfter mit den Fahrrädern hierhergefahren, aber alleine tut man das eher nicht.“ Ein Hauch von Wehmut lag in ihren Worten aber ihr Lächeln war immer noch da. „Und mit euch Kindern waren wir ja auch oft hier. Erinnerst du dich?“
Marissa nickte, doch sie sagte nichts. Sie wollte die Bilder, die in ihr unwillkürlich aufstiegen, nicht sehen. Nichts von den beiden Mädchen mit Zöpfen und kurzen Kleidchen wissen, die sich um das letzte Stück Kuchen stritten. Um noch ein Eis bettelten. Bitte…bitte… BITTE…
Das war es nicht, weshalb sie hier zusammen mit der Großmutter saß. Sie wollte nicht über sich reden, sie wollte über Emilia sprechen, über Nikolas und die Zeit in dem von Bomben bedrohten Berlin. Über die Zeit der Evakuierung und was dann kam. Wollte persönlich von der Großmutter hören, was in ihr an Erinnerung noch da war, außer dem, was sicher noch in dem Geschichtenbuch stand und das sie weiterlesen würde. Bald, ganz bald. Es gab so viele Puzzleteile aufzudecken, zusammenzufügen. Wie würde das Bild aussehen, wenn alle Teile beisammen waren. Würde es jemals ein Ganzes ergeben oder würden wohlmöglich Lücken bleiben? Sie musste es herausfinden. Und die Zeit, die es dafür brauchte, musste sie zulassen. Wie lange es auch immer dauerte, sie würde es aushalten. Wie gering war ohnehin ihr Einsatz zu dem, was denjenigen ihrer Familie zugemutet worden war, die in einer Zeit lebten, die alles andere als friedlich und schön gewesen war. Und die trotzdem weitergemacht hatten, trotzdem noch Freude und Glück verspüren konnten. Die dann, wie jetzt Emilia, alt geworden waren und ohne Anklage auf das zurückblickten, was ihnen einen Großteil ihrer besten Jahre genommen hatte.
Das vergangene Leid war noch immer nachspürbar, wenn die Großmutter über die Kriegszeiten in Berlin sprach, über die Kellernächte, die Bomben und Trümmern in den Straßen. Über die Evakuierung nach Ostpreußen, die spätere Rückführung über Sachsen und den alltäglichen Überlebenskampf. Wie unvorstellbar war es doch für einen Menschen wie sie, die sie erst so viele Jahre später geboren worden war. Die nie hatte Hunger leiden müssen, nie erlebt hatte, wie sich wirkliche Angst anfühlte. Wie hätte sie nachfühlen können, wie es war, wenn die Sirenen durchdringend Alarm gaben, wenn man wusste, jetzt flogen Flugzeuge über die Stadt, die totbringendes Gepäck mit sich führten. Und wie sollte sie sich vorstellen, wie es war zu wissen, dass man nicht wegkonnte, ausgeliefert war, keine wirkliche Zuflucht zu haben. Einfach einer Macht gegenüber stand, die so viel stärker und größer war als der einzelne Mensch, der nur verlieren konnte, wie auch immer das alles ausgehen würde. Verloren hatte man immer. Auch wenn man überlebte.
Marissa aß mit einer Art schlechten Gewissens ihr zweites Stück Pflaumenkuchen, konnte es ihr denn noch schmecken? Sie blickte zu ihrer Großmutter hinüber, die wohl spürte, was sie dachte. „Genieße es, Kind. Es ist alles gut. Du sollst dir nicht den Appetit verderben lassen, auch wenn ich dir erzählt habe, wie wir damals manchmal hungern mussten. Doch das ist vorbei und du und ich können so viel essen wie wir wollen. Das wichtigste ist, es wert zu schätzen und nicht einfach achtlos damit umzugehen und es als allzu selbstverständlich hinzunehmen. Ich freue mich sehr, wenn es dir schmeckt.“
„Oma, du bist so großartig“. Marissa ließ ihre Kuchengabel sinken. „Wie kannst du so gelassen sein?“
„Warum sollte ich nicht? Was nützt es, in der Vergangenheit zu verharren. Was gewesen ist, ist gewesen. Jetzt ist jetzt. Alles andere ist unwichtig. Der Augenblick ist das, was wir haben. Und wenn der Augenblick Pflaumenkuchen ist, dann koste ihn aus.“
„Das tue ich nur zu gerne. Und ich denke, ich verstehe, was du meinst.“ Marissa lehnte sich zurück, trank einen Schluck Tee. „Doch, auch wenn etwas vorbei ist, wie der Krieg, wie das letzte Jahr, wie gestern. Dennoch ist es doch noch da, es tut uns doch noch etwas. Ich spüre das.“
„Das ist wohl so“, nickte Emilia, „und daher ist es mir auch wichtig, dass du erfährst, was war. Es lässt uns allen viel Wichtiges über uns erfahren, aber wenn wir die Zusammenhänge sehen und verstehen, dann müssen wir alles gehen lassen, damit wir frei unser Leben im Jetzt leben können. Es ist gut von dem zu wissen, was in der Familie geschehen ist, es gehört zu uns, zu dir. Doch du darfst darin nicht verhaften, bleib bei dir. Lebe jetzt. – Ich denke, es soll so sein, dass du erfährst, was früher gewesen ist, damit du deine Identität erkennst. Du bist großartig, Issa. Du weißt es nur nicht.“
Irgendwie hatte das Gespräch eine andere Richtung eingeschlagen als geplant. Statt über die Vergangenheit zu reden, waren mit einem Mal Dinge wichtig, die das Leben jetzt betraf. Und was konnte letztlich auch wichtiger sein. Marissa genoss es hier mit der Großmutter zu sitzen und einfach nur da zu sein. Und auch Emilia fühlte sich überaus wohl hier mit der Enkelin, die ihr so nah war. Schon immer hatte sie einen besonderen Draht zu ihr verspürt, doch lange Zeit hatte sie nicht gewusst, wie sie diesen nutzen konnte, sodass er für sie beide wirkungsvoll war. Jetzt endlich schien der Austausch zwischen ihnen zu funktionieren. Da war es nicht weiter von Bedeutung, dass der Auslöser in Ereignissen lag, die lang vorbei und alles andere als angenehm waren. Wichtig war die innere Verbundenheit, die sich mehr und mehr zwischen ihnen festigte. Emilia wurde es warm ums Herz und sie legte dankbar die Hand auf die der Enkelin. Erst schien es als wolle diese die Hand zurückziehen, schien nicht sicher zu sein, was die Geste zu bedeuten hatte. Doch sie ließ ihre unter der warmen, alten Hand liegen. Ihre Augen suchten im Gesicht der Großmutter. Zu sagen gab es dabei nichts. Es war alles zu verstehen.
*
Als Knut sie später abholte, standen die Beiden schon am Weg und blickten ihm entgegen. Sie strahlten eine Ruhe aus, die den alten Friesen beeindruckte. „Wo ward Ihr denn?“ fragte er, „Ihr seht aus als wärt ihr weit weggewesen.“
Emilia lächelte leicht. „Vielleicht waren wir das auch.“
„Oh, oh – denn will ich mal nicht weiterfragen“, Knut machte eine vage Handbewegung. Er spürte, dass es da nichts zu erfahren gab. Er half Emilia auf den Sitz neben Marissa, schnalzte mit der Peitsche und pfiff sich die Unterhaltung selber. Irgendwann fing er mit seinem tiefen Bass an zu singen. „Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord…“
Unwillkürlich musste Marissa lachen. „Was denn, Deern. Ist das nicht recht? Heut Abend ist Dünensingen, da muss ich mich einölen.“
„Doch, doch – das ist klasse.“ Marissa konnte sich aber nicht mehr halten und steigerte sich in einen wahren Lachanfall hinein bis die beiden anderen nicht umhin konnten, mitzulachen.
Derart frohgelaunt ging es über den Dünenweg. Kurz vor der Ortschaft schnappte Knut nach Luft: „Deern, das bringt mich bannig aus der Puste. Wie soll ich dann denn noch singen und Quetschkommode spielen?“
„Tut mir Leid“, Marissa saß das Lachen immer noch locker, „es kam so aus mir raus.“
„Ist schon recht, Lachen ist gesund“, der gutmütige Knut war alles andere als nachtragend. „Wie ist es, kommt ihr nachher? Ist doch immer ein Spaß.“
Emilia sah ihre Enkelin an: “Magst du gehen? Ich denke, mir ist es zu viel.“
„Mal sehen. Vielleicht.“ Marissa gab sich unschlüssig.
„Wenn, dann komm früh, sonst sind die besten Plätze weg. Ist immer voll da“, empfahl Knut. Marissa nickte, war sich aber nicht sicher, ob sie wirklich gehen würde. Irgendwie drängte es sie, im Buch weiterzulesen, das die ganze Zeit ungeöffnet in dem Beutel neben ihr gelegen hatte. Sie wollte alles wissen, wollte dem Nachspüren, was geschehen war, was ihre Großmutter, ihre Urgroßmutter, ihr Großonkel hatten erleben müssen. Wollte mehr von der Dankbarkeit spüren, die sie vorhin gefühlt hatte. Dankbarkeit für ihr Leben hier und jetzt jenseits der großen Katastrophe Krieg.
*