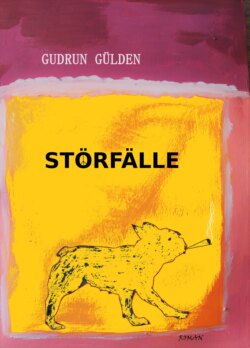Читать книгу STÖRFÄLLE - Gudrun Gülden - Страница 17
Aalhoden (Kleinbeken, Februar 1979)
ОглавлениеUnsere Welt verwahrloste ohne meine Mutter. Das Haus war eine Müllhalde, Papa hatte dreckige Klamotten an und ließ sich einen Bart wachsen. Als es kein sauberes Geschirr mehr gab, nahmen wir die Partyteller und Plastikgabeln aus dem Keller. Als die Gabeln verbraucht waren, aßen wir alles mit Plastikmessern, außer Suppe, die tranken wir aus dem Topf. Es fehlte nur noch das offene Feuer in der Mitte vom Raum.
Papa kam mittags nicht mehr nach Hause, er aß im Volksmuseum oder sonst wo, ich fragte ihn nicht. Ich vermisste Lissi die ganze Zeit. Obwohl sie es war, die alleine in ihrem blöden Innenarchitektenzimmer saß, hatte ich Angst, dass sie nicht mehr meine Freundin sein wollte. Weil ich so alleine war, hatte schon einige Male gedacht, dass ich gerne mit Kathrin was unternehmen würde, aber ich hatte Bedenken, dass sie das so auffassen würde, als wäre sie nur Ersatz für Lissi, was nun auch wieder nicht stimmte. Und Lissi könnte denken, mir wäre es egal, dass sie Hausarrest hätte. Und außerdem bin ich nicht so gut in solchen Dingen. Vor lauter Grübelei wurde ich fast trübsinnig.
Eine Weile nach dem Berlinkonzert fragte Kathrin mich, ob wir nach der Schule was zusammen machen könnten.
„Wir gehen zu mir“, sagte sie. „Meine Mutter ist nicht da.“
Ihre Mutter war eine große, hagere Frau mit einem herben Zug um den Mund, ich hatte sie einmal in der Schule gesehen, auf einem Elternabend. Sie hatte Wind gemacht, weil die Schülerinnen, die im Chor oder im Orchester der Schule waren, immer fünfzehn Punkte in Musik bekamen, egal, was sie sonst so anstellten. Kathrin war nämlich nicht im Chor oder im Orchester und war unmusikalisch, dabei war ihre Mutter Klavierlehrerin, das Talent hatte sich wohl nicht vererbt. Ihre Mutter hatte Mumm an dem Abend, leider keinen Erfolg.
Sie wohnten in einem Mehrfamilienhaus im Norden von Großbeken. Sozialbau, überall waren Sprüche auf die Wände gemalt. „Keine Macht für Niemand“ „ Babas Mutter ist eine F....“
Ich mochte es dort. Keine reichen Säcke, die sich hinter ihren Mercedes verkrochen, sondern junge Typen in Jogginganzügen, die an ihren Karren rumschraubten und tagsüber Bier tranken. Biertrinken tagsüber wirkte unterschiedlich je nach Hintergrund. Am Büdchen in Kleinbeken kam es mir normal vor, hier wirkte es verwegen.
„Nicht so doll hier“, murmelte Kathrin. „Ich bin die Einzige in unserer Klasse, die nicht in einem Einfamilienhaus wohnt.“
„Ich kenne das“, sagte ich. „Du kennst ja Lissis Haus. Dagegen wohnen wir wie in einer Schrebergartenhütte.“
„Euer Haus ist doch toll. Ich finde es viel schöner als Lissis Haus.“
Jetzt tat es mir leid, dass wir überhaupt ein Haus hatten und Kathrin und ihre Mutter nicht.
„Kann sein“, sagte ich. Aber wenn man ein Haus hat, gibt es immer was Wichtigeres für den Vater, als sich mit der Familie zu beschäftigen.“
Die Wohnung war schön eingerichtet, dänische Möbel und helle Wollteppiche. Im Wohnzimmer stand ein Klavier. Es war unordentlich und in den Ecken rollten sich Wollmäuse. An der Wand hingen Fotos, Kathrin beim Tennisspielen, ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer Eltern auf einem Segelboot, beide trugen schwarze Sonnenbrillen mit nach oben abstehenden Flügeln, sie lachten in die Kamera.
Kathrin lebte alleine mit ihrer Mutter.
„Was ist mit deinem Vater?“, fragte ich.
„Keine Ahnung“, sagte sie. Meine Courage nachzufragen, wie so was sein kann, hielt sich in Grenzen.
Kathrins Zimmer sah aus wie ein Flüchtlingslager. Es gab keinen Schrank, kein Regal, nur eine Matratze und einen Schreibtisch mit einem Plastikstuhl. Neben dem Schreibtisch türmten sich Zettelstapel und Schulbücher. Überall lagen Klamotten rum.
Ich stand unter Zugzwang, einen Kommentar über ihr Zimmer abzugeben. Ich hab' das nicht drauf mit unehrlichen Lobworten, ahnte jedoch, dass es an der Reihe war, so was zu sagen wie 'Schönes Zimmer', 'Wow, tolles Plakat' (oder schöner Stuhl oder interessantes Bett), keine Ahnung, aber das war schwierig bei Kathrins Zimmer.
Mir fielen nur Kommentare ein, wie sie Lissis Mutter bestimmt gesagt hätte und ich fürchtete, dass sich in mir eine moralische Instanz entwickelt hatte. Aktuell betankte unser Pädagogiklehrer unser Bewusstsein und wohl auch unser Unterbewusstsein mit Sigmund Freuds Lehren. Das Über-Ich als strafendes Eltern-Bild. Lissis Mutter, die den Finger hebt. Die Polizei im eigenen Kopf. Mir fiel nur Über-Ich-Scheiß zu Kathrins Zimmer ein. Vielleicht war ja doch was dran an Freuds Theorie mit dem „Ich“ und dem „Über-Ich“, obwohl ich jedes Mal sauer wurde, wenn ich darüber was hörte oder las. Als ich erfahren musste, dass Freud ein Stipendium für eine Untersuchung von Aalhoden bekommen hatte, fiel es mir schwer, nachvollziehen, wie er danach noch das Unbewusste entdecken konnte. Vielleicht, weil er selbst nicht verstand, warum er diese Untersuchungen über die Hoden des armen Aals überhaupt durchgeführt hatte. Wahrscheinlich konsumierte er deswegen ungeheure Mengen von Kokain, um das alles auszuhalten. Eigentlich war es mir egal, ob es irgendwo ordentlich war oder nicht. Jetzt fühlte ich mich wie Lissis Mutter, die dann so was wie mein Über-Ich war, was komisch war, weil sie nicht meine Mutter war.
Ich entschied mich schließlich für: „Das sieht so aus, als würdest du hier nicht richtig wohnen.“
„Tja“, antwortete sie. „Da ist was dran. Ich fühle mich hier wirklich nicht zuhause. Außerdem mag ich keine Möbel.“
„Klar“, sagte ich, ohne im Ansatz zu verstehen, worum es ging. Ich versuchte es mit: „Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen.“
Auflösendes Lachen. Uff.
„Ich such mich hier dumm und dämlich“, sagte sie. „Ich bekomm' das nicht hin. Ich hasse es, aufzuräumen und bekomme Zuckungen, wenn ich das Wort 'planen' höre. Parties finde ich klasse, aber wenn die dann anfangen mit ihren Hyperaktivitäten‚ wer macht Kartoffelsalat, wer besorgt Servietten, falle ich in eine Lähmung. Ich finde, das ist alles banaler Scheiß. Zweitrangig. Pflichtbewusstsein, Ordnungsliebe, Sauberkeit. Das hat doch an sich keinen Wert.“
„Aber es ist doch ganz praktisch“, meinte ich. „Ein Kühlschrank mit leckerem Essen. Oder überhaupt was zu essen.“
Dadurch, dass meine Mutter weg war, hatte sich meine Sichtweise verändert, aber deswegen hatte ich trotzdem keine zunehmende Motivation an mir feststellen können, die Haushaltsaufgaben zu erledigen.
„Klar“, sagte Kathrin. „Das sagt Paul auch immer. Irgendwann verhungere ich wahrscheinlich. Das gibt jedes Mal einen Riesenkrach mit Paul, weil er das nicht versteht.“
„Was versteht er nicht?“
„Das ich nicht gerne einkaufe oder aufräume. Mir reicht es gerade mal mit ihm.“
„Hast du Schluss gemacht?“
„Zum hundertsten Mal“, sagt sie. „Ich ersticke mit ihm. Bist du eigentlich mit jemand zusammen?“
„Shit, nee“, sagte ich. „Ich verliebe mich immer in die falschen Typen.“
„Aha!“, sagte sie. „In wen denn so?“.
Ich holte tief Luft.
„Brauchste mir nicht sagen, wenn du nicht willst“, sagte Kathrin und schaute mich neugierig an.
„Doch“, sagte ich. „Ich hab es nur noch nie jemand gesagt.“
Sie schwieg.
„Hoffnungslos“, sagte ich. „In Wichmann.“
„Der Geschichtsreferendar?“
„Yepp.“
„Der ist süß“, sagte Kathrin und ich nickte zerknirscht.
„Und?“, fragte sie.
„Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe“, sagte ich. „Was wenig hilfreich war.“
Ich erzählte ihr, was abgelaufen war. Ich hatte das Gefühl, dass sie ein Lachen unterdrückte.
„Hört sich gar nicht mal so ausweglos an“, sagte sie. „Warte mal ab.“
„Meinst du?“
„Im Moment geht das nicht, aber du bist in einem Jahr mit der Schule fertig.“
„Ein Jahr lebenslänglich“, sagte ich.
„Wollen wir am Freitag ins Shalanda?“, wechselte sie das Thema.
„Können wir machen“, antwortete ich.
„Wir nehmen Eveline mit, ok?“
Ich verdrehte innerlich die Augen. Eveline war nun gar nicht mein Fall, aber Kathrins beste Freundin.
Eveline war eine Familiennachzüglerin, ihre Schwestern waren fünfzehn und siebzehn Jahre älter. Die Tatsache, dass ihre Mutter mit vierzig Jahren noch Sex gehabt haben musste, war das Einzige, was ich interessant fand, mir allerdings nicht vorstellen wollte. Evelines Vater war Immobilienmakler und verdiente einen Haufen Schotter. Die Familie zog an gleichen Strang, was Knete betraf: Es musste zusammengehalten werden. Eveline wusste immer genau, was dieser oder jener Schokoriegel in welchem Geschäft kostete, wie sich die Milch- oder Butterpreise entwickelten und wo es billig abgelaufene, aber noch gute Waren gab.
Ihr Haus war von außen prächtig, innen war es grottenhässlich.
Evelines Mutter erinnerte mich an ein isoliertes Huhn, das gackernd durch die Gegend lief und planlos irgendwas suchte, aber nicht wusste, was das wohl sein könnte. Sie war ständig in Sorge. Um ihren Mann, der sechzig Zigaretten am Tag rauchte und ein Problem mit den Arterien hatte, um die älteren Töchter, die berechnend und listig waren und bestimmt Spitzenmaklerinnen werden würden, um Eveline, die zu viel Süßkram aß und sich nicht so anzog, wie es ihrer Meinung nach Mädchen in ihrem Alter machen sollten. Ich fand Eveline abgefahren schön. Sie sah aus wie aus einem Rubensbild in unsere Zeit gesprungen. Alles an ihr war rund, die Haut weiß mit roten Wangen. Ihr goldblondes Haar wellte sich schwer bis zur Hüfte. Sie hatte oft lange Kleider an.
„Klar“, sagte ich. Immerhin war es meine Schuld, dass Eveline nicht mehr neben Kathrin in der Schule saß.