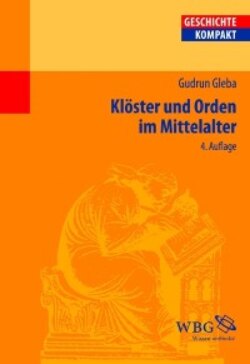Читать книгу Klöster und Orden im Mittelalter - Gudrun Gleba - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Die Gemeinden des Pachomius
ОглавлениеEine andere Form eremitischen Lebens, die sich fast zeitgleich ebenfalls in Ägypten entwickelte, waren Gemeinschaften, die sich zwar auch der weltflüchtigen Askese unterworfen hatten, aber im kontrollierenden Zugriff der Kirche blieben. Eine der Gründergestalten dieser streng lebenden Gemeinschaften war Pachomius (ca. 290 – 346 / 7). Wie Antonius kann man ihn als Zivilisationsflüchtling betrachten. Er verließ die städtische Umgebung und ging in die Wüste. Dort lebte er zwar abgeschieden, aber im Verband einer Gemeinschaft. Diese Lebensweise bezeichnet man als zönobitisch. Am Ort Tabennese wurde 320 / 25 eine solche gemeinschaftlich lebende Gemeinde gegründet. Die wachsende Anhängerschaft des Pachomius machte es jedoch bald erforderlich, Regeln des Zusammenlebens aufzustellen. In einer einzigen, durch die Zahl der Mitglieder unüberschaubaren Gemeinschaft ließ sich die Vorstellung von einem Leben in frommer Abgeschiedenheit nicht mehr verwirklichen. Angeblich waren es etwa zehntausend Menschen, die dem Aufruf des Pachomius zu weltflüchtigem, aber gemeinsamen Leben nachfolgten; sie mussten sich in zahlreiche Gruppen aufgliedern, die in dorfähnlichen Strukturen organisiert waren. Darunter waren auch zwei Frauengemeinschaften, die von Pachomius Schwester Maria geleitet wurden. Die Gründe, aus denen sich so viele Menschen den neuen Gemeinschaften anschlossen, sind vielfältig, aber noch lange nicht ausreichend erforscht. Neben echter religiöser Überzeugung und der allgemeinen und wenig befriedigenden Erklärung der Zivilisationsmüdigkeit könnten auch andere Motive eine Rolle gespielt haben: Die Flucht in die Wüste mochte vor Strafverfolgung bewahren, sei es, weil es unter bestimmten politischen Konditionen bereits ein kriminelles und verfolgungswürdiges Delikt war, überhaupt „Christ“ zu sein, sei es, dass man tatsächlich die Ahndung begangener strafbarer Handlungen befürchten musste; die Sicherheit, das Aufgehobensein in einer gleich gesinnten Gemeinschaft konnte vielleicht vor dem sozialen Abstieg aufgrund von Krankheit oder Arbeitslosigkeit bewahren.
Die Pachomiusregel, nach der Tausende in den ägyptischen Wüstengemeinschaften lebten, ist nur eine von vielen Regeln, die zönobitische Gemeinschaften in Nordafrika, Vorderasien und Südeuropa befolgten, bevor sie in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends von der klösterlichen Lebensregel des Benedikt von Nursia (ca. 480 – 547) überlagert und schließlich abgelöst wurden (vgl. Kap. III).
Die vielköpfigen Gemeinschaften des Pachomius waren streng organisiert: Bevor eine Person sich einer solchen Gemeinschaft anschließen durfte, musste sie eine Probezeit absolvieren und vor der endgültigen Aufnahme bestimmtes Grundwissen in der christlichen Glaubenslehre nachweisen, wie z. B. die Kenntnis der wichtigsten Gebete und einiger Passagen aus der Heiligen Schrift. Jeder Einzelne wurde in die Klostervorschriften eingewiesen und musste sich während des Aufnahmerituals auf die gemeinschaftliche Regel und zu Disziplin und Gehorsam verpflichten. Zu den zeremoniellen Abläufen und den äußeren Zeichen der Gemeinschaft, die den inneren Zusammenhalt gewährleisten sollten, zählten die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten, die für alle gleiche Kleidung und der regelmäßige Empfang der Sakramente.
Auch Pachomius wurde durch seine Vita zum Heiligen. Die Übersetzung seines vorbildhaften Lebenswandels vom Griechischen ins Lateinische durch den Bischof und Kirchenvater Hieronymus (345 – 420), die oben bereits genannte lateinische Fassung der Antonius-Vita und die um 400 entstandene „Geschichte der Mönche oder Über das Leben der hl. Väter“ des Tyrannius Rufinus bildeten einen Quellenkorpus, der nun auch den Westen und Norden des zerfallenden römischen Reiches mit den frühen Erscheinungsformen mönchischen Lebens vertraut machte.