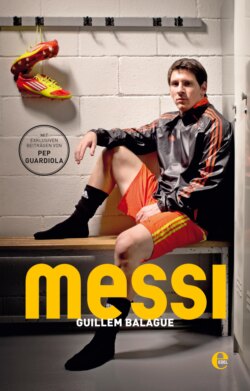Читать книгу Messi - Guillem Balague - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
»Pass den Ball, Leo!« Aber das hat er nie getan
ОглавлениеJeden Sonntag spielte Leo mit seinen Brüdern Rodrigo und Matías auf einer Betonplatte vor dem Haus seiner Großmutter Celia Rondos oder Toros , zu Deutsch »Neckball« oder »Schweinchen in der Mitte«. Oft spielten sie mit einem Tennisball Fußball, dann kamen seine beiden Cousins Maxi und Emanuel dazu. Viel später gesellte sich noch ein dritter Cousin namens Bruno als jüngster Sohn von Leos Tante Marcela und Onkel Claudio zur Familie.
Zwei große Steine dienten als Torpfosten. Das Spiel endete immer bei sechs Toren.
Leos Großmutter und ihre Töchter Celia und Marcela waren stets in der Küche beschäftigt und kochten Nudeln mit Sauce. Die Ehemänner Jorge und Claudio unterhielten sich auf dem Sofa in dem engen, kleinen Wohnzimmer angeregt mit Leos Großvater Antonio. Oder sie saßen auf den Stufen vor dem Haus und beobachteten die Jungen beim Fußballspielen. »Schau dir den Pass an … sieh mal, wie Emanuel dribbeln kann … Leo lässt sich einfach den Ball nicht abnehmen, obwohl er so klein ist …« So wurde gelobt und gefachsimpelt.
»Gut gemacht, Maxi«, rief Jorge, der bei den Newell’s Old Boys gespielt hatte, bevor er zum Militär musste.
»Essen ist fertig!« Die Kinder liefen ins Haus, obwohl sie eigentlich lieber weitergespielt hätten.
Erst Hände waschen, und dann sitzen alle am Tisch. Das bescheidene kleine Haus war an unzähligen Sonntagen Treffpunkt für die ganze Familie. Aber die Jungs wollten immer nur eins: Fußball spielen. Manchmal wurde für einen der Enkel am Abend das Sofa ausgezogen, weil er unbedingt bei der Oma übernachten wollte. Alle liebten Großmutter Celia, und das nicht nur, weil sie so gut Pasta kochen konnte. Celia konnte ihren Enkeln einfach nichts abschlagen.
Das Essen war immer schnell verputzt. Alles schmeckte köstlich. Den Geschmack von Dulce di Leche, einem feinen Milchdessert, noch auf der Zunge, liefen die fünf Jungen mit ihrem Ball zu einem Platz im Stadtteil Bajada. Immer verausgabten sie sich völlig. Sie spielten stundenlang und ohne Pause.
Manchmal forderten die älteren Jungen, Rodrigo (geboren 1980), Matías (1982) und Maxi (1984), die jüngeren, Leo (1987) und Emanuel (1988), heraus. Die Fußtritte, die die beiden Kleinen abbekamen, fielen häufig heftiger aus als in den Fußballspielen mit ihren gleichaltrigen Freunden. »Matías, sei doch vorsichtig, Mensch!«, ermahnte ihn Jorge oft genug.
Leo lief dann wie ein kopfloses Huhn hinter dem Ball her, und sobald er ihn hatte, weigerte er sich, ihn wieder abzugeben. »Dabei wurde sein Gesicht puterrot«, so sein Onkel Claudio. »Und wehe, wenn er und seine Mannschaft verloren! Dann gab es ein ziemliches Geheule. Nicht selten schlug er dann um sich und ließ sich einfach von niemandem beruhigen. Er musste so lange spielen, bis er gewonnen hatte.«
»Die Spiele endeten immer mit Streit und Tränen. Auch wenn wir gewonnen hatten. Dann ärgerte mich mein Bruder Matías, bis ich wütend wurde. Oft war ich rasend vor Wut und Anspannung.« So Leo im Interview mit dem argentinischen Sportmagazin El Gráfico.
Manchmal spielten sie auch gegen Jungen aus der Nachbarschaft. Das Messi/Cuccittini-Team gewann immer. Matías erinnert sich gerne daran: »Zuerst wollten sie nicht gegen uns spielen, weil Leo und auch Emanuel so klein waren. Sie gratulierten Leo aber immer zu seinem guten Spiel. Er war damals neun Jahre alt und spielte gegen 18- und 19-Jährige. Das schreckte ihn nicht.«
Wen wundert es, dass diese reiche Ansammlung junger Talente so manchen Profi hervorgebracht hat?
Als er elf war, wurde Rodrigo in die Jugendmannschaft von Newell’s aufgenommen, nachdem er, wie alle Messis, vorher für einen Verein namens Grandoli gespielt hatte. Sein schnelles und geschicktes Spiel machte ihn zum idealen Mittelstürmer, aber er war auch ein guter Torschütze. In Rosario war er bei Stadtturnieren immer erste Wahl. Leo berichtete im Corriere della Sera später vom traurigen Ende seiner Fußballlaufbahn: »Leider hatte er einen Autounfall, bei dem er sich das Schienbein und das Wadenbein brach. Damals bedeutete das das Ende einer Karriere.« Vielleicht hätte ihm aber auch der nötige Biss gefehlt, um Profi zu werden. Seine wirkliche Leidenschaft gehörte der Küche, wie sich später herausstellte. Er wollte Koch werden.
Matías war bei Newell’s Verteidiger gewesen, als er sich nach einem Jahr entschloss, nicht mehr weiterzuspielen. Seine Fußballleidenschaft holte ihn aber wieder ein. Er spielte zuletzt auf regionaler Ebene beim Club Atlético Empalme Central.
Maximiliano, 1,65 Meter groß und der älteste Sohn von Marcela und Claudio, spielte für die brasilianische Mannschaft Esporte Clube Vitória. Über verschiedene Stationen in mehreren Vereinen kam er nach Argentinien (San Lorenzo de Almagro), nach Paraguay (Libertad), nach Mexiko und nach Brasilien (Flamengo). In seiner ersten Trainingssaison mit einer paraguayischen Mannschaft erlitt Maxi eine Kopfverletzung. Aber er bewies Durchhaltevermögen und kehrte nach seiner Genesung wieder zum Fußball zurück. Am Tag der Frühgeburt seiner Tochter Valentina schoss er ein Tor für Flamengo. Am selben Abend gelang Leo in Spanien ein Hattrick für den FC Barcelona im Spiel gegen Valencia, und er widmete die drei Tore der kleinen Valentina.
Sein Cousin Emanuel – Leo und er waren unzertrennlich – fing bei Grandoli als Torwart an. Wie Leo wechselte er nach einem Jahr zu den Newell’s Old Boys, bevor er in Europa sein Glück versuchte. 2008 spielte er beim TSV 1860 München als Reservespieler im Mittelfeld, und bereits ein Jahr später stieg er in die erste Mannschaft auf. Danach führte ihn sein Weg nach Spanien, zu Girona, einem Verein der zweiten spanischen Liga. Heute kickt er mit seinen 1,77 Metern beim Club Olimpia in der ersten Liga von Paraguay. Sein Traum ist es, wieder mit Maxi und Leo für die Ñuls – wie die Argentinier die Newell’s Old Boys nennen – zu spielen.
Bruno wurde 1996 geboren und war daher zu jung, um beim Straßenfußball seiner Cousins mitzumachen. Er wurde aber später einer der Hoffnungsträger des Renato-Cesarini-Clubs von Rosario, aus dem auch Fernando Redondo und Santiago Solari, der Sohn des Clubgründers, hervorgingen. Bruno sieht Leo sehr ähnlich und spielt auch so wie er: Seine Lauftechnik, seine Spielzüge, sogar wie er die eigenen Tore feiert, erinnern sehr an Leo Messi. Im Februar 2012 postete Bruno bei Facebook: »Ein Leben ohne Fußball ist kein Leben.«
Da Leo Rosario schon mit 13 Jahren den Rücken gekehrt hatte, konnte er seine Cousins leider nicht oft treffen. Die gemeinsamen Fußballspiele gehörten der Vergangenheit an. Das Schicksal hatte die jungen Talente auseinandergebracht. Doch ein wenig eines fußballbegeisterten Kindes steckt noch heute in jedem von ihnen. Großmutter Celia war bei Leos Wechsel nach Spanien schon drei Jahre tot.
Was ist das Außergewöhnliche an Rosario? Fremde schauen sich zuerst den Paraná-Fluss an und das Monumento Nacional a la Bandera, das Denkmal mit der argentinischen Nationalflagge. Rosario will vor allem für seine Bewohner, die sich gern Rosarinos nennen, ein guter Ort sein. Der Widerstandskämpfer Che Guevara, der Sänger Fito Páez, der Cartoonist und Schriftsteller Roberto El Negro Fontanarrosa und Fußballgrößen wie Marcelo Bielsa und César Menotti sind alle in Rosario geboren. Und die Stadt will natürlich auch Heimat für ihre beiden großen Vereine sein: die Newell’s Old Boys und Rosario Central. Zwischen den beiden Clubs findet jährlich ein Stadt-Derby statt. »Es ist die leidenschaftlichste aller Begegnungen«, sagt jeder, der schon dabei war, auch wenn die Begeisterung der Fans manchmal in Gewalt umschlägt.
Rosario liegt 300 Kilometer von Buenos Aires entfernt. Die dreistündige Autobahnfahrt von der Hauptstadt dorthin führt über eine schnurgerade Straße. Rechts und links sieht man nichts außer Grün. Biegt man dann von der Autobahn nach Rosario ab, erkennt man gleich einige Blechhütten, die in Gelb und Blau, den Farben von Rosario Central, gestrichen wurden. Das soll jedem Besucher sagen, dass man sich im Gebiet der Canallas – der Halunken – befindet. Sie wurden so genannt, weil sie vor langer Zeit ein Angebot für ein Benefizturnier zugunsten einer Lepraklinik abgelehnt hatten, die Newell’s Old Boys jedoch nicht. Fortan trugen jene den Spitznamen Leprosos. »Rosario ist die Stadt der Leprosos«, liest man daher an anderen Häuserwänden, die jetzt in Rot und Schwarz, in den Farben der Newell’s Old Boys, leuchten. Die Fenster der Blechhütten in diesen Außenbezirken zeigen in Richtung Autobahn. Die Gegend ist ärmlich, wie leicht am Zustand der Häuser zu erkennen ist. Man sieht junge Leute, die auf ungepflasterten Straßen ohne Helm alte Motorräder fahren. Fährt man weiter durch die hier wunderschöne Landschaft, entdeckt man in der Ferne Fabriken und andere imposante Gebäude. Jeder Autofahrer gerät ins Schwärmen, wenn er die Landschaft an sich vorbeiziehen sieht. Keiner scheint hier auf Verkehrs- oder Hinweisschilder zu achten, die, wie die Rosarinos sagen, sowieso nur aufgestellt wurden, um den Verkehrsfluss zu behindern. Man kann sich also nie sicher sein, wer nun eigentlich die Vorfahrt für sich beansprucht. Wer als Erster an einer Kreuzung ankommt, der nimmt sie sich einfach.
Dann endlich erscheint die Skyline von Rosario mit ihren unterschiedlich hohen Wolkenkratzern. Bevor man jedoch im Zentrum ankommt, fährt man über eine Allee und sieht plötzlich eine riesig große, moderne Fabrik mit labyrinthisch angeordneten Röhren auf ihrer Fassade. Rosario ist eine der landwirtschaftlich produktivsten Regionen des Landes. In der Gegend werden Getreide und Sojabohnen angebaut.
Danach passiert man den Parque de la Independencia, den der Journalist Eduardo van der Kooy als Ort beschreibt, »an dem die Stadt ihren Charakter und ihre Persönlichkeit zeigt. Am Park führt der elegante Boulevard Oroño vorbei, der einer Postkarte von Paris entstammen könnte. Inmitten alter Laubbäume liegt das Newell’s-Stadion.«
Die Cafés in der Innenstadt haben hohe Decken, große einladende Fenster und kleine gemütliche Tische. Dort sitzen Männer, die nach hübschen Frauen Ausschau halten, während sich die Frauen, auch die älteren, nach jungen, gutaussehenden Männern umdrehen – die natürlich allesamt Fußballprofis sein könnten.
Den Frauen dort sagt man nach, dass der unwiderstehliche Mix aus den serbischen und italienischen Genen ihrer Vorfahren die typischen blonden Schönheiten mit olivfarbener Haut und hellen Augen hervorgebracht habe. Das gute Essen tue ein Übriges für die gesunde und vitale Ausstrahlung der Bewohner, so heißt es. Nur wenige sieht man mit Fußballtrikots auf den Straßen, weder mit Trikots von Newell’s noch von Central, noch von der Nationalmannschaft Argentiniens, obwohl es doch von Fußballplätzen nur so wimmelt. Fast jeder Jugendliche spielt hier Fußball, und das zumeist in mehr als einer Mannschaft. Nach einem Spiel düsen sie dann auf ihrem Motorrad direkt zum nächsten Spiel. Wer in Rosario nicht aktiv Fußball spielt, ist entweder Trainer, Organisator oder Schiedsrichter. Auch die Frauen.
»Die Stadt ist einfach etwas Besonderes, weil hier eine einzigartige Fußballbegeisterung herrscht«, sagt Gerardo »Tata« Martino, ehemaliger Manager der Newell’s Old Boys, der jetzt beim FC Barcelona tätig ist. »Die Stadt produziert Spieler am Fließband, es ist eine regelrechte Fußballerfabrik, die laufend Talente hervorbringt. Die Kinder und Jugendlichen werden hier mit Fußballbegeisterung regelrecht gemästet. Darum ist in Rosario auch die Fußballakademie so wichtig, die so viele Talente fördern konnte, wie etwa Jorge Valdano, Gabriel Batistuta und eine endlose weitere Liste, auf der Lionel Messi nur das Sahnehäubchen ist.«
Er hätte auch Mario Kempes, Abel Baldo, Roberto Sensini, Mauricio Pochettino und viele andere nennen können. Für die Qualifikationsphase der Weltmeisterschaft 2014 sind allein zehn Spieler aus Rosario im festen Kader des argentinischen Nationaltrainers Alejandro Sabella zu finden. Darunter Javier Mascherano, Éver Banega, Ángel di María, Ezequiel Lavezzi, Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco, Ezequiel Garay … und natürlich Leo.
Die Fußballerverehrung geht in Rosario so weit, dass die Iglesia Maradoniana gegründet wurde. Sie ist Diego Maradona gewidmet, den die Argentinier als den größten Spieler ihrer Geschichte ansehen und zu dessen Ehren sie jedes Jahr an seinem Geburtstag, dem 30. Oktober, eine Huldigung abhalten. 1993 hatte Maradona kurz bei den Newell’s Old Boys gespielt. Auch Leo war damals in seinem schwarzroten Trikot bei seiner Einführung dabei gewesen.
In Rosario ist Fußball Leben, und Leben ist dort Fußball. Das laut Guinness-Buch der Rekorde meistgefeierte Tor der Welt fiel am 19. Dezember 1971 bei brütender Hitze in einem Spiel zwischen Newell’s und Central. Es war im Halbfinale der landesweiten Meisterschaften und das einzige Mal, dass sich die beiden Teams aus Rosario in der Landeshauptstadt Buenos Aires gegenüberstanden. Beide Mannschaften fanden zuerst nicht richtig ins Spiel, es fiel einfach kein Tor, aber letztendlich zeigten sie dann doch, dass es ihnen um alles oder nichts ging. Dreizehn Minuten vor Spielende gab es ein Foul im Strafraum von Newell’s. Aldo Pedro Poy, der Stürmer von Rosario Central, stand auf einmal vor dem Tor. Noch bevor er den Ball köpfen konnte, rief er einem der Kameramänner etwas zu. Hatte er vielleicht so etwas wie eine Vorahnung? Man kann es nennen wie man will, er sagte auf jeden Fall: »Mach die Kamera klar, den Schuss verwandle ich.« Und genauso kam es auch. Poy rangelte mit seinem Manndecker, konnte ihn abschütteln, sprang dann mit ausgebreiteten Armen und gestrecktem Körper in die Luft und … Tor! Ein Flugkopfball. Was machte es schon, dass der Ball den Bauch des Verteidigers DiRienzo gestreift und den Torwart auf dem falschen Fuß erwischt hatte? Es war ein Tor, ein echtes, und nur das zählte. Der Erzrivale war im entscheidenden Halbfinale geschlagen worden. Central gewann am Ende im Finale. Das war der erste Meisterschaftssieg der Canallas in der Geschichte des Vereins. Noch legendärer als der Sieg blieb aber das Tor von Poy im kollektiven Gedächtnis. Die Organización Canalla, die sich extra aus Anlass dieses Tores gegründet hatte, traf sich dreißig Jahre lang immer am 19. Dezember auf dem Spielfeld im Central-Stadion: An diesem Tag wird der legendäre Spielzug von Poy wiederholt. Heute, so Poy, sei das größte Problem für ihn nicht der Flugkopfball, sondern danach wieder auf die Beine zu kommen.
Das ist Rosario. Das versteht man dort unter Fußballleidenschaft. Es ist die Wiege von Lionel Messi, der nicht aus dem Nichts kam, genausowenig wie Alfredo Di Stéfano oder Diego Maradona. Vielleicht sind es nicht nur ihre argentinischen Gene, die eine Rolle bei ihrer Karriere spielten, aber alle drei sind in einem Land geboren, in dem der Fußball einem jungen Mann nicht nur eine große Zukunft mit Ruhm und Geld verspricht, sondern wo er auch die Träume kleiner Jungen erfüllt, die sich nach Anerkennung in der Familie und in der Nachbarschaft sehnen.
Aber wie Gerardo Martino in der Zeitschrift Panenka schreibt, müssen die Rohdiamanten und Talente, die man in Rosario findet, erst noch geschliffen werden: »Hierfür war die Arbeit von Jorge Griffa ganz entscheidend. Griffa wusste, was gut war, nachdem er selbst nicht mehr spielte. Er hatte keinerlei Ambitionen, Manager eines Teams der Primera, der ersten Liga, zu werden, sondern er wollte Talente entdecken, und das tat er auch. Seit den 1970er-Jahren leistete er für die Newell’s Old Boys 20 Jahre lang vorbildliche Arbeit. Später war er Jugendtrainer bei Atlético Boca in Buenos Aires, aber er verfolgte auch dort immer noch dasselbe Ziel. Dafür engagierte er sogar Assistenten, etwa Marcelo Bielsa. Dieser fuhr durchs ganze Land und suchte nicht nur in Rosario und Umgebung nach verborgenen Rohdiamanten. Tausende Kilometer legte er in seinem kleinen Fiat 147 zurück, stets auf unermüdlicher Mission, die sich für die Leprosos so tausendfach auszahlen sollte. 1988 wurde Newell’s mit Trainer José Yudica Meister, ebenso 1991 und 1992 mit Marcelo Bielsa.« Griffa hatte auch Messis Talent in seiner letztlich nur kurzen Karriere bei Newell’s erkannt.
Überall in Rosario atmet man Fußballluft ein, aber komischerweise liegt Leo Messi hier nicht in der Luft. Es gibt im Straßenbild kaum Abbildungen von ihm und kaum eine Werbeanzeige, auf der sein Konterfei zu bewundern wäre. Jeder kann zwar eine Geschichte über »den Floh« erzählen, aber Rosario scheint nicht mit ihm prahlen zu wollen.
Leo dagegen bedeutet Rosario alles. Wenn man ihn nach seinen schönsten Erinnerungen fragt, sagt er sofort: »Mein Zuhause, in dem ich geboren, und die Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin.«
Die Familie Messi lebte jahrzehntelag in einem kleinen Haus an der Calle Lavalleja, in einem Vorort circa vier Kilometer südöstlich vom Stadtzentrum. Die Gegend wird La Bajada oder Las Heras genannt. Es ist ein Wohngebiet mit niedrigen Häusern, in denen die Haustüren nie abgeschlossen werden. Aus ihrem Innern erklingen Cumbia-Musik und lautes Lachen. Die Kinder spielen auf der Straße, denn es gibt kaum Verkehr. Die Zeit scheint in Bajada stillzustehen. Dort, in der engen Calle Estado de Israel, steht das Haus Nummer 525, das Jorge Messi mit eigenen Händen erbaut hat.
Sein Vater Eusebio war Maurer, und so erlernte auch Jorge dieses Handwerk. Die beiden Messis arbeiteten jedes Wochenende daran, legten Stein auf Stein für das Gebäude auf dem 300 Quadratmeter großen Grundstück, das die Familie erworben hatte. Zunächst war es einstöckig, so wie die anderen Häuser in der Straße auch, mit einem Sandkasten im Garten hinter dem Haus. Nebenan wohnte Cintia Arellano, die so alt war wie Leo und seine beste Freundin. Mittlerweile wurden die Straßen, die Kanalisation und die Laternen dort erneuert. Leos Wohnhaus hat jetzt ein zweites Stockwerk, einen Zaun (den einzigen in der Straße) und eine Sicherheitskamera, und die Tür bleibt nun fast immer verschlossen.
Im Haus lebten Jorge Messi und Celia Cuccittini mit ihren vier Kindern. Leo erinnert sich im Corriere della Sera: »Das Haus war klein. Es gab eine Küche, ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer. In einem schliefen meine Eltern, in dem anderen meine Brüder und ich.«
Das war Leos Zuhause. Es lag nicht weit entfernt von einem Gelände, auf dem er immer Fußball spielte. Neben dem Fußballacker gab es einen Kiosk, in dem Matías später jobbte, als Leo schon in Barcelona war. Nicht weit von dort wohnte auch Leos Großmutter Celia, und noch ein Stückchen weiter wohnten seine Cousins. Ganz in der Nähe lebten auch die Großeltern väterlicherseits, Rosa María und Eusebio Messi Baro. Eusebio öffnet noch mit 86 Jahren viele Jahre nach der Rente jeden Morgen seine kleine Bäckerei, die er sich in einem Raum des Hauses, in dem er und seine Frau nun seit 50 Jahren leben, eingerichtet hat.
Alles fing für Leo in dieser Nachbarschaft an. Der Zusammenhalt der Familie war für die Messis und Cuccittinis von großer Bedeutung. Leo liebt seine Eltern, seine Onkel und seine Brüder über alles. Aber am meisten liebt er seine Mutter, deren Gesichtszüge er sich auf den Rücken tätowieren ließ. »Das hat er gemacht, ohne jemandem etwas davon zu sagen«, berichtete sein Vater in Sique Rodríguez’ Buch Educados para ganar (Für den Erfolg geboren), in dem die Eltern der berühmtesten Absolventen der Akademie des FC Barcelona, La Masía, zu Wort kommen. »Eines Tages zeigte er uns dann das Tattoo. Wir sind vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen. Wir hatten keine Ahnung. Aber es war sein Körper, und darüber hatten wir nicht zu bestimmen.«
Rosario, La Bajada, das ist Messis Kindheit. Es ist seine Heimat. Und wenn er im Sommer oder an Weihnachten frei hat, dann kehrt er hierher zurück und besucht seine besten Freunde von damals. Jetzt, nachdem er ein großes Anwesen am Stadtrand gekauft hat, trifft man ihn nicht mehr so häufig in der alten Nachbarschaft, aber manchmal wurde er hier auch noch auf dem Fahrrad gesehen. Im Sommer 2013 konnte man ihn mit einem Einkaufswagen voller Muffins, Wein und Knabbergebäck im Supermarkt sehen. Er verbrachte gerade den Tag in der Nähe Rosarios in Gualeguaychú, einem verschlafenen Städtchen, wo die Leute ihn, obwohl er eine Kappe trug, sofort erkannten und ihn fotografieren wollten. Daran musste er sich überhaupt erst gewöhnen. Er hat hier keine Bodyguards bei sich.
Seine langjährige Freundin Antonella Roccuzzo stammt auch aus seiner Heimatstadt. Sie ist die Cousine seines guten Freundes Lucas Scaglia, der für Deportivo Cali in Kolumbien spielt. Er kennt sie, seit er fünf Jahre alt ist. Heute ist sie die Mutter seines Sohnes Thiago. Aber es hätte auch alles anders kommen können. Antonella und Leo waren noch kein Paar gewesen, als er noch irgendein Junge war, der sich um ihre Aufmerksamkeit bemühte, und sie ein kleines Mädchen, das kein Interesse an ihm hatte. Erst, als Leo schon in Barcelona war und in den Ferien zurückkehrte, fing die Romanze richtig an.
Roccuzzo, Scaglia, Messi – und der Mädchenname von Leos Mutter lautet Cuccittini. Es ist schwer zu übersehen: Die Familie hat italienische Vorfahren, die einst aus den Marken in Italien, aus Recanati und Ancona nach Rosario gekommen waren. In Lionels Adern fließt aber auch spanisches Blut. Rosario war ein Ziel für europäische Immigranten; hauptsächlich kamen Italiener und Spanier, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auch die Hälfte der Bevölkerung Rosarios stellten. Eine von Leos Urgroßmüttern, Rosa Matéu i Gese, kam aus Blancafort de Tragó de Noguera in den Pyrenäen, aus der Nähe von Lleida, und war schon als junges Mädchen mit ihren Eltern nach Argentinien emigriert. Bei der Überfahrt über den Atlantik lernte sie einen jungen Mann aus Bellcaire d’Urgell kennen, José Pérez Solé. Wenn man seine Heimat verlässt, dann sind Bindungen sehr wichtig. Sie sind der Rettungsanker in der Fremde. Rosa und José halfen sich beim Heimischwerden im neuen Leben und heirateten schließlich irgendwann in Argentinien. Später bekamen sie drei Kinder, eins davon war Rosa María, die Frau von Eusebio Messi, Jorges Vater.
Kürzlich hat der Corriere della Sera Leo in einem Interview an seinen Stammbaum erinnert:
– Deine Vorfahren kamen aus Recanati, so wie Giacomo Leopardi.
– Wer war das?
– Ein berühmter Dichter: Sempre caro mi fu quest’ermo colle / e questa siepe, che da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
– Ich habe noch nie von ihm gehört, tut mir leid.
– Vielleicht hast du schon mal von der Madonna di Loreto gehört?
– Nein, tut mir leid.
– Es ist ein berühmtes Gemälde von Caravaggio. Warst du nie neugierig darauf, woher deine Großeltern kommen?
– Nein. Ich glaube, mein Vater war schon mal dort. Er hat unsere Verwandten besucht. Vielleicht fahre ich irgendwann mal dorthin.
– Hast du wenigstens das »Immigranten-Hotel« in Buenos Aires gesehen, das heute ein Museum ist? Dort lebten die meisten italienischen Einwanderer zuerst.
– Nein, das kenne ich nicht.
Daraufhin zeigte ihm der Journalist einige alte Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen, die einst in der Pampa ihr Glück versuchen wollten: »Streng dreinblickende Frauen mit Kopftüchern und langen schwarzen Röcken. Dürre Kinder ohne Schuhe. Riesige Kasserollen fürs Essen. Die Männer tragen dunkle Jacken, weiße Hemden und Filzhüte, die Augen ins Ungewisse gerichtet. Mit einem Blick, der würdig wäre, in einem melancholischen Lied beschrieben zu werden.«
Leo schaute sich die Bilder mit verhaltener Neugierde an. Mehr jedoch nicht. Für ihn beginnt und endet alles in Rosario.
Die Familien Messi und Pérez hatten sich in Las Heras niedergelassen. In ihrer Nähe wohnten auch die Familien Cuccittini und Olivera. Das waren die Eltern von Celia, die auch aus Italien stammten. Jorge und Celia hatten sich schon als Nachbarskinder von 15 und 13 Jahren ineinander verliebt und nie gegen ihre Liebe angekämpft. Fünf Jahre später, als Jorge vom Militär zurückkam, heirateten sie.
Jahrelang arbeitete Celia in einer Firma, die Magnetspulen für die Industrie produzierte, und wie alle Migranten war Jorge dazu bereit, jeden Job anzunehmen, der ein Einkommen für die Familie versprach. Ob er ab sechs Uhr morgens in einer Fabrik Schrauben herstellte oder als Versicherungsmakler von Tür zu Tür ging, um die monatlichen Prämien zu kassieren, er tat es klaglos. Er wusste, dass er hart arbeiten musste, um seine Familie ernähren zu können. Nach vier Jahren bei den Newell’s Old Boys hatte er es nicht zum Profi-Fußballspieler geschafft. Von da an büffelte er von fünf bis neun Uhr abends, um Chemieingenieur zu werden. Das Studium dauerte insgesamt acht Jahre, aber er kannte seine Prioritäten genau.
Jorge fing 1980 bei Acindar an, einem der größten Pressstahl-Produzenten in Argentinien. In diesem Jahr wurde auch sein erster Sohn Rodrigo geboren. Um zur Fabrik zu gelangen, die in Villa Constitucíon lag, 50 Kilometer von Rosario entfernt, musste er den Bus nehmen. Er stieg in der Firma schnell auf und war bald schon Manager. So konnte er für das Wohl seiner dreiköpfigen, bald dann vierköpfigen Familie ohne Weiteres sorgen. 1982 wurde Matías geboren. »Mein Vater«, erklärte Matías später, »war ein Arbeitstier. Uns fehlte es an nichts, aber er blieb immer bescheiden, bis heute. Meine Eltern haben immer hart für ein besseres Leben geschuftet … und dadurch konnten meine Brüder und ich auch die besten Schulen besuchen.«
Zu Hause wurde gut gekocht, aber nichts verschwendet. Leo erzählt dem Corriere della Sera: »Wir aßen Argentinisch oder Italienisch, Spaghetti, Ravioli, Chorizo … mein Leibgericht sind Scaloppine Milanese, Schnitzel nach Mailänder Art. Meine Mutter bereitet sie am besten zu. Sie schmecken genial gut, diese Schnitzel, normal oder mit Tomatensauce und Käse. Wir lebten bescheiden, aber wir waren nicht arm. Es fehlte uns wirklich an nichts.«
Über die Herkunft argentinischer Fußballspieler herrscht ein weitverbreitetes Fehlurteil: Die meisten von ihnen stammen aus der sogenannten Mittelschicht, die man wohl in Europa mit Arbeitern und kleinen Angestellten gleichsetzen würde. Aber keinesfalls aus der Unterschicht; diese Leute sind nicht arm. Nur wenige Fußballer waren früher tatsächlich arm, bevor sie Stars wurden. Diego Maradona, der im Süden von Buenos Aires in den Slums von Fiorito geboren wurde, ist eine berühmte Ausnahme.
Kinder aus wirklich armen Familien schaffen es nur selten zu einem Probetraining, einerseits aus Mangel an Kontakten, andererseits weil sie nicht über die finanziellen Mittel verfügen, die Training, Ausrüstung und Schulgeld erfordern. Und wenn sich junge Fußballspieler nicht gut ernähren, halten sie das Training im Allgemeinen gar nicht durch. Ohne diese Voraussetzungen kann niemand zum Profi werden. Wer tatsächlich aus Armutsverhältnissen kommt und es dennoch auf eine Fußballakademie schafft, zeigt oft bald nicht mehr die notwendige Ausdauer und Disziplin, weil es ihm in der Kindheit an Familienrückhalt und festen Strukturen fehlte oder weil Drogen schon in der Herkunftsfamilie eine große Rolle spielten.
Argentinische Fußballspieler stammen also hauptsächlich aus Mittelschichtfamilien, die allerdings in den 1980er-Jahren durch die enorme Inflation im Land unter großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu leiden hatten. Der Peso verlor täglich an Wert. Argentiniens Zukunft sah düster aus.
Der Falklandkrieg von 1982, in dem es um die Rückgabe der von Großbritannien besetzten Inseln ging, sollte von dem Versagen der regierenden Militärjunta in Wirtschaftsangelegenheiten ablenken. Die Spannung im Land war spürbar, die Inflation stieg unaufhaltsam. Viele Argentinier starben in diesem Krieg, und mit ihnen die Hoffnung. Die militärische Niederlage heizte die Empörung der Bevölkerung nur noch an, bis das Regime schließlich gestürzt wurde. Im Dezember 1983 kehrte die Demokratie zurück.
Vier Jahre später, nach dem Aufstieg einer Gruppe junger Armeeoffiziere, die als die Carapintadas (»bemalte Gesichter«) bekannt wurden, befand sich das Land jedoch am Rande eines Bürgerkriegs. Oberst Aldo Rico war ihr Anführer. Die Armee wollte sich den demokratischen Spielregeln nicht mehr fügen und setzte den juristischen Schritten, die gegen das Militärregime und dessen Menschenrechtsverletzungen eingeleitet worden waren, ein Ende. Obwohl die Argentinier für ihre Demokratie auf die Straße gingen und es im ganzen Land, auch in Rosario, zu Streiks kam, gab Präsident Raul Alfonsín dem Druck der Militärs nach und erließ das Ley de Obediencia Debida (das Gesetz der Gehorsamspflicht), das die Militärs von Verbrechen wie Entführung, rechtswidriger Festnahme, Folter und Mord freisprach. Die argentinische Regierung konnte auf diese Art die Untaten der jüngsten Vergangenheit verschleiern.
Zwischen 1984 und 1985 waren bis zu 15 Bombenanschläge zu verzeichnen, die die betroffenen Städte in ein wahres Chaos stürzten. Auch in Villa Constitución, in der Nähe von Jorges Arbeitsplatz, ging eine Bombe hoch. Die Bomben waren der Wut der Argentinier geschuldet, die das Geschehene nicht vergessen und sich nicht der Erpressung der Militärs beugen wollten. In den Folgemonaten waren die Straßen des ganzen Landes voll von Demonstranten, die höhere Löhne und eine gerechte Wirtschaftspolitik forderten.
Am 24. Juni 1987, mitten in der politischen und wirtschaftlichen Krise des Landes und fast genau ein Jahr, nachdem Diego Maradona seine Mannschaft zum Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko geführt hatte, wurde Lionel Andrés Messi geboren.
Nicht ohne Aufregung. Die Ärzte befürchteten eine Zangengeburt. Jorge hatte Angst um sein Baby, aber am Ende kam es ganz normal zur Welt, nur etwas rot im Gesicht und mit abgeknicktem Ohr. »Nein, nein, das wird nicht so bleiben, warten Sie nur ab, morgen ist alles in Ordnung«, beruhigte der Gynäkologe Norberto Odetto die Eltern.
Der dritte Sohn der damals 27-jährigen Celia Cuccittini und des 29-jährigen Jorge kam im italienischen Krankenhaus von Rosario zur Welt. Er wog 3,6 Kilogramm und war 47 Zentimeter groß.
Leo. Leonel? So wollten die beiden ihr Kind nennen. Aber nicht Lionel Ritchie hatte die Eltern zu diesem Namen inspiriert, auch wenn man es sich so erzählt und der Popsänger sich zu der Zeit gerade auf dem Höhepunkt seines Ruhms befand.
Jorge ging also mit dem Entschluss zum Standesamt, das Baby Leonel zu nennen. Der Name hörte sich gut an, aber irgendwie noch nicht gut genug, befand er. Also fragte er nach der Liste mit weiteren Namen, um sie noch mal durchzugehen. Er wollte nicht, dass sein Sohn später Leo genannt werden würde. In einer Spalte stand Lionel, also derselbe Name auf Englisch. Das gefiel ihm besser, und er ließ ihn so eintragen. Zu Hause gab es deshalb mächtig Ärger (»Bei Gott, was hast du dir dabei gedacht, Jorge, so hatten wir es nicht vereinbart!«) und das Schicksal rächte sich auf seine Weise an Jorge, sollte doch bald alle Welt seinen Sohn Leo nennen.
Mit neun Monaten fing Leo an zu laufen und fegte einem Ball hinterher, sobald ihn seine Brüder irgendwo hatten liegen lassen. Schon ein paar Tage später wagte er sich auf die Straße. Die Haustür stand offen, wie das so üblich gewesen war.
Aber als der kleine Kerl nach draußen wackelte, fuhr gerade ein Fahrrad vorbei und warf ihn um.
Leo weinte natürlich, doch er schien nicht verletzt zu sein. In der Nacht wimmerte er im Schlaf. Sein Arm war geschwollen. Wie sich herausstellte, war doch alles schlimmer als gedacht. Ein Bruch im linken Unterarm war die Folge seines Sturzes. Das waren einerseits erste Anzeichen dafür, dass sein kindlicher Körper schwächelte. Aber sie standen auch für seine außergewöhnliche Schmerzresistenz.
Zum ersten Geburtstag bekam der kleine Leo sein erstes NOB-Trikot geschenkt. Alle Familienmitglieder waren Fans der Leprosos. Alle, außer Matías, dem Rebellen. Er war Fan von Central.
Zum vierten Geburtstag bekam Leo seinen ersten Ball, denn er spielte schon lange mit seinen beiden Brüdern Fußball auf der Straße. »Passt auf ihn auf!«, rief seine Mutter, wenn ihr Jüngster zum Kicken mit den älteren Jungs nach draußen ging. »Meine Mutter ließ mich draußen Fußball spielen, aber da ich jünger war als die anderen, stand sie immer dabei, um zu schauen, ob ich nicht weinte. Das hat mich sehr beeindruckt«, sagte Leo der kolumbianischen Zeitschrift Soho.
Die folgenden Anekdoten werden vielen bekannt vorkommen, die als Kind auch Fußballspieler werden wollten, besonders denen, die es später tatsächlich geschafft haben.
Ohne Ball im Bett konnte Leo abends nicht einschlafen. Er musste ihn spüren, üblicherweise am Fußende. Wenn ihm der Ball weggenommen wurde, war er todunglücklich. Ein Fußball gehörte zu seinem Leben wie Essen und Trinken, das musste sein. Wenn er für seine Mutter Einkäufe erledigte, nahm er ihn auch mit. Durfte er das nicht, blieb er zu Hause. War einmal kein Ball griffbereit, dann kickte er eben mit Papiertüten oder Sockenknäueln herum – oder was er sonst so fand. »Leo verließ das Haus ausschließlich mit Ball, er lebte mit dem Ball und schlief mit ihm ein. Er wollte immer nur eins – seinen Ball«, erinnert sich sein Bruder Rodrigo Messi in einem Video, das während der Gala des Balon d’Or 2012 gezeigt wurde. Jorge bestand jedoch darauf, dass Leo mit seinen Freunden auch etwas anderes unternahm. Natürlich fuhr er Fahrrad, spielte mit Nachbarkindern Murmeln oder an der PlayStation, oder sah fern. »Er war ein ganz normaler Junge – aber niemals fern von seinem Ball«, vertraute Jorge dem Kicker an.
Jorge, der selbst einmal ein vielversprechender Mittelfeldspieler bei NOB gewesen war, erzählte in Ramiro Martíns Buch: Messi: Un Genio en la Escuela del Fútbol (Messi: Ein Genie in der Fußballschule), dass Leo sie eines Tages alle überraschte.
»Wir spielten mit all meinen Söhnen rondo auf der Straße … Mein Sohn Rodrigo hatte gerade den Ball, und Leo lief in die Mitte, weil er ihm den Ball abnehmen wollte. Plötzlich warf er sich vor die Füße seines großen Bruders und schnappte sich den Ball. Wir sahen uns alle erstaunt an. Das hatten wir nicht erwartet. Niemand hatte ihm das beigebracht.«
Von dem Augenblick an beobachtete man Leos Fortschritte allgemein genauer. Der kleine Junge wurde beklatscht, was ihn glücklich machte, und das wiederum machte seine Eltern glücklich. Und wie alle Kinder wollte er immer noch mehr: mehr Ballspielen, mehr Beifall, mehr Spaß. Im El Gráfico erinnert sich Jorge: »Als er vier Jahre alt war, erkannten wir, dass er ganz besonderes Talent besaß. Er machte schon bei kleineren Spielen mit, und der Ball schien an seiner Fußspitze zu haften. Wir konnten es nicht fassen. Als er ein wenig älter war, spielte er mit seinen fünf und sieben Jahre älteren Brüdern und tänzelte förmlich mit dem Ball um sie herum. Das ist seine natürliche Gabe.«
Dieser stille kleine Junge, der seine Zeit entweder zu Hause oder bei seiner Tante Marcela verbrachte, »liebte nur den Fußball«, wie sich seine Nachbarin und Jugendfreundin Cintia Arellano erinnert. Bald schon erregte er Aufmerksamkeit in der engen Calle Estado de Israel. Cintia ist eineinhalb Monate älter als er und wohnte im Nachbarhaus. Die beiden gingen in den ersten Jahren zusammen zur Schule, und er saß im Klassenzimmer neben oder bei Klassenarbeiten hinter ihr. Mit Cintia sprach El Piqui, der Kleine, mehr als mit den anderen. Eines Tages hatte einmal ein Junge »Komm her, Kleiner« gerufen, und der Spitzname blieb haften. Cintia kam morgens bei ihm vorbei, um ihn zur Schule zu überreden. Sie »dolmetschte« oft, wenn er etwas sagen wollte. Sie war es auch, die ihm unter dem Lineal oder dem Radiergummi kleine Schummelzettel zusteckte. Am Nachmittag brachte sie ihm Süßigkeiten vorbei und ermahnte ihn immer wieder, dass er es einmal bereuen werde, wenn er jetzt nicht lernte. Er antwortete: »Ja, ich weiß, aber ich kann nicht.«
Cintia wusste auch, dass Leo Hormonspritzen bekam, die sein Wachstum befördern sollten. Sie hatte ein Gespräch zwischen Leos Mutter und ihrer Mutter mit angehört, in dem es um diese Spritzen ging, die Leo sich auf einem Klassenausflug abends selbst setzen sollte.
»Lionel war auffällig klein und lief immer barfuß mit einem Ball herum«, erinnert sich Ruben Manicabale, ein anderer Nachbar. »Oft waren wir wütend, weil er uns nervte, dann schnappten wir ihn und schubsten ihn um, aber er stand immer einfach auf und spielte weiter.«
Familie Quiroga, die Nachbarn von gegenüber, weiß noch, dass »die anderen Kinder nicht den ganzen Tag lang mit dem Ball spielten, nur er. Alle gingen irgendwann heim. Dann spielte er einfach allein weiter. Unsere Mutter schimpfte oft, weil es schon so spät war und er immer noch mit dem Ball draußen spielte.«
»Manchmal wurde er von einem Ball getroffen, fiel hin oder weinte, aber das ging schnell vorüber, und er stand immer wieder auf. Man konnte sehen, dass er anders war als andere Kinder: Er hatte besondere Fähigkeiten, er war schnell …«, erinnert sich Cintia.
Den Spitznamen »Der Floh« hatte Leo allerdings niemand aus der Nachbarschaft gegeben. Seine Familie bestätigt, dass ein Kommentator aus Mexiko erst Jahre später mit dieser Bezeichnung anfing. Es soll Enrique Bermúdez gewesen sein, einer der renommiertesten kastilischen Sprecher. Perro Bermúdez – so wurde er von allen genannt – war ein Rocker, Hippie und Sänger, bevor er der Erfinder von Hunderten Spitznamen wurde. Adolfo Ríos wurde zum Arquero de Christo (»Bogenschütze Christi«), Rafael Márquez zum Emperador de Zamorra (»Kaiser von Zamorra«) und David Beckham zu Zapatos Azules (»Der mit den blauen Schuhen«). Aber Bermúdez selbst hat nie von sich behauptet, den Namen »Der Floh« erfunden zu haben.
Leos herausragendes Talent war für alle offensichtlich. »Er ist ein von Gott gesandter Lichtstrahl. Wir wussten einfach, er würde es schaffen. Er wurde zum Fußballspielen geboren«, sagt Cintias Mutter Claudia, die manchmal auf den kleinen Leo aufgepasst hat.
»Er spielte mit einem Ball Größe fünf, der viel zu groß für ihn war, und doch hatte er ihn voll unter Kontrolle«, erinnert sich sein Bruder Matías. »Es war wunderbar, ihm zuzuschauen, und wer ihn zum ersten Mal sah, blieb fasziniert stehen.«
Der Ball, der ihm bis zum Knie reichte, schien dennoch an seinem linken Fuß zu haften. Er machte nur kleine Ballberührungen, bei denen er die Kontrolle über den Ball behalten konnte, leichte Berührungen mit dem Außenrist. Er hielt den Ball trotzdem immer am Boden, damit er nicht versehentlich von seinem Knie abprallen konnte. Er wollte auf keinen Fall, dass die älteren Jungen ihm den Ball abnahmen.
Leo hatte eine außergewöhnlich gute Koordination, war durch seine kleine Statur extrem wendig und von Natur aus schnell. Im Wettkampf gegen die Älteren bestand er am Ende glänzend.
Leo liebte den Zweikampf. Er liebte die Herausforderung. Er trat mutig gegen jeden Gegner an und hasste es zu verlieren. Hinter der stillen Fassade dieses Jungen steckte ein leidenschaftlicher Wettkämpfer, der durchaus jähzornig werden konnte. Wenn er mit einer Dose Murmeln nach Hause kam, die er beim Spiel gewonnen hatte, zählte er sie peinlich genau. Und wehe, es fehlte eine – dann wurde er fuchsteufelswild.
Seine Mutter Celia: Als er klein war, war er oft ungezogen. Wenn wir Karten spielten, hatte keiner Lust, mit ihm zu spielen, denn wir wussten, dass er früher oder später schummeln würde.
Jorge: Er konnte einfach nicht verlieren.
Celia: Wenn er nicht gewann, dann schmiss er alle Karten von sich. Er wollte auch nicht zur Schule gehen. Er sagte einfach: »Nein, ich gehe nicht.«
Leo in der Zeitschrift El Gráfico: Einmal hatte ich Streit mit einem Cousin bei ihm zu Hause. Meine Großmutter war auch dabei. Am Ende waren alle gegen mich und schmissen mich raus. Sie ließen mich nicht mehr hinein. Da warf ich vor Wut mit Steinen und trat gegen das Gartentor.
Celia: Als ich ihn am Tor stehen ließ, warf er Steine nach mir und sagte, er werde mittags nicht nach Hause kommen, sondern das Haus mit Steinen bombardieren. Ich sagte, das würde ich seinem Vater erzählen. Aber darüber lachte er nur. Leo war sehr verwöhnt und hatte einen starken Willen. Ich glaube, den hat er von uns beiden geerbt, aber mehr noch von mir. Er sagt, was er denkt, ob das gut oder schlecht ist. Er versucht weder Freude noch Ärger zu verbergen. Von seinem Vater hat er das Verantwortungsbewusstsein und einen ausprägten Gerechtigkeitssinn geerbt.
Das kleine Spielfeld des Grandoli-Fußballvereins ist umgeben von Betonblöcken. Er befindet sich in einem der Außenbezirke der Stadt, den manche für gefährlich halten. Späht man durch einen Spalt zwischen zwei Häusern, dann kann man die Boote sehen, die flussabwärts zum Hafen von Rosario fahren. Der Platz ist nur ein Feld mit ein paar grünen Rasenstücken, die die äußeren Linien markieren. Die großen Betonblöcke rundum kommen den kleinen Spielern riesig vor. Denn es sind Kinder von fünf, sechs, sieben Jahren, manche auch älter, die sich hier vergnügen. Das Spielfeld ist von einem Zaun mit einem rostigen Tor umgeben. Auf einem Schild steht geschrieben: »Macht hier eure Schuhe sauber.« Die Tribüne hat nur drei Reihen, in der zweiten Reihe sitzen meist die Eltern einiger Kinder.
Dort saß natürlich auch Großmutter Celia. Leo, der seine Brüder in ihren rot-weißen Grandoli-Trikots beobachtete, war bei ihr.
Um sich die Zeit zu vertreiben, kickte Leo seinen Ball unermüdlich gegen eine Wand.
Salvador Ricardo Aparicio betreute die Gruppe, ein magerer, ruhiger Mann, der vier Jahrzehnte lang den Fußball von Grandoli mit geprägt hat. An diesem Tag fehlte ein Spieler, sodass die Fußballer ihr Spiel 7 gegen 7 nicht beginnen konnten. Das passierte eben manchmal. Salvador wartete noch ein wenig auf den letzten Spieler.
»Nimm Leo«, sagte die Großmutter und deutete auf den kleinen Fünfjährigen.
»Gute Frau, der ist viel zu klein«, antwortete Aparicio.
»Jetzt nehmen Sie ihn schon«, beharrte Celia.
»Na schön, aber wenn er anfängt zu weinen, dann nehmen Sie ihn wieder vom Spielfeld.«
Leo spielte an dem Tag mit Jungen, die ein Jahr älter waren als er. In dem Alter macht das schon viel aus.
Als der Ball auf ihn zugeschossen kam, wirkte er größer als der Kleine selbst.
Und dann geschah, was geschehen musste. Der Ball landete auf Leos rechtem Spann. Leo schaute ihm beim Wegrollen nach und bewegte sich nicht von der Stelle.
Aparicio runzelte die Stirn, denn genau das hatte er befürchtet.
Aber dann bekam Leo den Ball wieder. Dieses Mal landete der Pass auf seinem linken Spann, ehrlich gesagt knallte er ihm hart gegen das Bein.
Doch Leo machte zwei Schritte und hatte den Ball unter Kontrolle. Mit kurzen Berührungen lief er mit dem Ball diagonal über dieses unebene Spielfeld und umdribbelte alle, die sich ihm in den Weg stellten.
»Schieß, schieß!«, schrie Aparicio. »Pass den Ball, Leo!«
Die Großmutter grinste.
Leo passte natürlich nicht.
Obwohl er so klein war, hätte ihn von diesem Tag an niemand mehr vom Spielfeld nehmen können, auch Aparicio nicht. »Er spielte, als hätte er das schon sein Leben lang gemacht«, erinnert er sich viele Jahre später. »In dem Jahr spielte er mit dem 1986er-Jahrgang alle restlichen Turniere, die sie auch alle gewannen.«
Messi kann sich an diesen Tag nicht erinnern. Seine Großmutter erzählte ihm aber später, er habe in diesem denkwürdigen Spiel zwei Tore geschossen.
Leo wollte immer nur Fußball spielen – auf dem Platz, auf der Straße, allein vor dem Haus, mit seinen Cousins oder mit Rodrigo und Matías. Aber wie jeder andere Junge wollte er auch ein Vereinstrikot und Fußballschuhe, so wie seine Brüder. So begann im Alter von fünf Jahren nach dem überraschenden Spiel unter den wohlwollenden Augen seiner Großmutter noch vor seinem ersten Vorschultag Leo Messis Vereinslaufbahn bei Grandoli. Dieser Verein lag in der Nähe seines Elternhauses, gegründet 1980 von den Vätern der jungen Fußballer.
Dieses Video zeigt es sehr gut: www.youtube.com/watch?v=ojUN SuW6DHg
El Piqui ist darin fünf Jahre alt und beweist bereits dieselbe Leichtigkeit beim Dribbeln und bei seinen Tempowechseln wie heute. Er bekommt den Ball, hält nach einer Lücke Ausschau, läuft los, dribbelt. Alle seine Gegner folgen ihm. Auch seine Mitspieler. Wenn er keine Lücke entdeckt, hält er den Ball dicht bei sich. Er versucht es auf der anderen Seite, seine Gegner und Mitspieler schwirren alle um ihn herum. Man muss wissen, dass es in Argentinien nicht gut angesehen ist, direkt ein Tor zu schießen. Es geht dort mehr um das Schaffen von Gelegenheiten und den Teamgeist als um Alleingänge, wie Messi sie bevorzugt. Deshalb dachten manche auch, dass dieser außerordentlich begabte Fußballer einmal zurechtgewiesen werden müsste. Die Worte »Pass den Ball, Leo!« hörte man in Rosario bald aber nicht mehr, weil es sowieso zwecklos war. Wann immer sich die Gelegenheit ergab, schoss Leo den Ball zwischen die Torpfosten. Tor!
Es gibt Spötter, die provokativ bezweifeln, ob Messi auch bei bitterer Kälte – zum Beispiel an einem Mittwochabend im winterlich verregneten englischen Stoke – so traumhaft spielen könne. Denjenigen sei gesagt: Schaut euch den Schlamm, die Steine und die Grasbrocken auf dem unebenen, schlecht beleuchteten Fußballplatz von Grandoli an, auf dem er mit seiner ersten Mannschaft die Spiele gewann.
Seit Leo zwei Jahre alt war, ging er mit seiner Großmutter Celia immer den ganzen Weg von zu Hause bis zum Grandoli-Verein zu Fuß. Dabei hielt er fest ihre Hand und versuchte, mit dem Ball unter dem Arm mit ihr Schritt zu halten. Sie wollten Rodrigo und Matías beim Spiel zusehen. Spieltag war immer der Samstag.
»Großmutter Celia war einfach die Beste. Sie hat für uns Enkel gelebt. Sie kam mit all unseren Launen klar. Wir Cousins stritten uns immer darum, wer bei ihr übernachten durfte. Ich weiß nicht, ob meine Großmutter überhaupt alle Fußballregeln verstand, aber sie war mein erster Fan beim Training und bei den Spielen. Ihre ermunternden Rufe vom Spielfeldrand werde ich nie vergessen«, erklärte Leo dem Magazin El Mundo Deportivo.
Celia schaute sich nie Fußball im Fernsehen an und ging auch nicht ins Newell’s-Stadion. Für sie fand Fußball da statt, wo ihre Enkel spielten. Und im Gegenzug drehte sich das Leben für ihre Enkel um diesen Fixpunkt, die italienische Matriarchin, die die Familie im gegenseitigen Respekt erzog und zusammenhielt. Wenn Leo sich an besonders schöne Augenblicke in seinem Leben erinnern soll, dann sagt er: »Die Geburt meiner Neffen.« Das war, bevor er selbst Vater eines Sohnes wurde.
Nach Schulschluss um fünf Uhr holte ihn seine Großmutter von der Schule ab, sie tranken etwas und gingen dann mit Matías zum Training. »Es war eine wunderbare Zeit, und wir hatten viel Freude an Leo, dem man sein besonderes Talent schon anmerkte. Leider starb meine Großmutter später, aber angefangen hat alles mit ihr«, erinnert sich Matías Messi.
»Gib Lionel den Ball, pass zu dem Kleinen. Der kann Tore schießen«, rief sie. Großmutter Celia hatte vollstes Vertrauen zu Leo. Und weil sie ihre Emotionen nicht zurückhalten konnte, konnte jeder ihr Temperament auf der Zuschauertribüne sehen.
Wie jeder Verein, so hatte auch Grandoli seine Erzrivalen. Einer davon war Alice. Spiele gegen solche »Feinde« darf man einfach nicht verlieren. Gegen Alice zu spielen war eine echte Herausforderung. Es ging hart und kämpferisch zu; jeder zeigte großen körperlichen Einsatz. Nach dem Spiel stritten die Väter miteinander, und manchmal wurde es auch handgreiflich. Bei einem dieser Spiele gegen die Mannschaft von Alice mischte sich auch Celia ein und schlug einem Alice-Fan eine Flasche an den Kopf. »Hör auf zu stören!«, rief sie. Natürlich ging Grandoli an diesem Tag wieder als Sieger vom Platz.
Kurz danach entdeckte man, dass Celia an Alzheimer erkrankt war. Der Journalist Toni Frieros enthüllt in seiner Messi-Biografie Messi: El Tesoro del Barça (Messi: Der Schatz des FC Barcelona): »Celia verlor langsam ihr Gedächtnis. Sie hatte Sprachschwierigkeiten und warf die Namen von Personen durcheinander. In den letzten Lebensmonaten musste die Familie hilflos mit ansehen, wie sie ihre Vitalität an diese unheilbare Krankheit verlor. Für Leo war es, als ob ein Teil von ihm selbst verloren ging.«
Leos Großmutter starb kurz vor seinem elften Geburtstag. Celia hat ihn daher nie beim FC Barcelona spielen sehen.
»Für uns alle war das ein großer Verlust, wir trauerten sehr um sie. Wenn ich daran denke, wie herzzerreißend Leo bei ihrem Begräbnis geweint hat, dann könnte ich selbst weinen«, erzählt seine Tante Marcela.
»Es war ein schwerer Schicksalsschlag für mich«, sagt Leo selbst. Kurz nach ihrem Tod schlich er sich zum ersten Mal allein aus dem Haus, ohne jemandem etwas davon zu erzählen. Es war an einem Samstag im Frühling. Er war mit seinem Freund Diego Vallejos verabredet, dem Bruder von Matías’ heutiger Ehefrau. Die beiden Jungen fuhren eine halbe Stunde lang mit dem Bus nach Villa Gobernador Gálvez im Süden der Stadt – zum Grab seiner Großmutter.
Seit ihrem Tod widmet Messi seine Tore häufig seiner Großmutter. »Ich denke oft an sie. Ich wünschte, sie könnte hier sein und meinen Erfolg miterleben. Dass das nicht geht, macht mich richtig wütend«, gestand er El Mundo Deportivo 2009.
»Zu Beginn seiner Karriere hielt er abends immer stumme Zwiesprache mit seiner Großmutter und bat sie um Hilfe«, erzählt Leos Mutter. »Es ist wirklich schade, dass sie ihn heute nicht sehen kann. Vielleicht schaut sie von oben auf ihn herab und ist stolz auf ihren Enkel, den sie so geliebt hat.«
Leo glaubt an Gott, obwohl er kein praktizierender Christ ist. Er ist dankbar für die Hilfe und Unterstützung, die seine Großmutter ihm in den ersten Jahren seines Lebens zuteil werden ließ. Sie ist in Gedanken immer bei ihm. Eines der wenigen Male, dass er nach einem Tor nicht zuerst die Finger grüßend zu ihr in den Himmel reckte, war nach der Geburt seines Sohnes Thiago. Aber bei den folgenden Spielen zollte er wieder Celia Respekt.
Leo blieb bei Grandoli, bis er sieben Jahre alt war. Im Team der ’87er-Mannschaft trug er die Nummer 10 auf dem Rücken. Sein Cousin Emanuel war damals Torhüter. Die Mannschaft gewann in der Zeit nahezu jedes Spiel, und immer hatte Lionel den Ball.
Natürlich war jedes Spiel, das gerade bevorstand, immer das wichtigste. Leo bereitete sich stets pflichtbewusst darauf vor. Zuerst reinigte er seine Schuhe mit Wasser, dann mit einem Tuch oder einer Bürste. Danach bandagierte er seine Knöchel. Er saß da wie ein kleiner Profi.
Salvador Aparicio war sein erster Trainer. Er sorgte dafür, dass die Jungen sich erst warm liefen, dann Lockerungsübungen machten, bevor er sie mit dem Ball üben ließ. Vor allem bestand aber das Training damals aus Spielen, Spielen und nochmals Spielen.
»Don Apa« Aparicio war nicht Leos Entdecker, aber er war ein früher Begleiter auf dem Weg eines unaufhaltsamen Talents. Der frühere Eisenbahnarbeiter, der 2009 mit 79 Jahren an einem Aneurysma verstarb, hielt sich nie für mehr als das: »Ich habe ihn nicht entdeckt. Aber ich war der Erste, der ihn aufs Spielfeld geholt hat. Darauf bin ich stolz.«
Aparicio hatte es sich wie viele hundert namenlos bleibende Trainer und Sportfunktionäre zur Aufgabe gemacht, Kinder von vier bis zwölf Jahren von der Straße zu holen. Sie sollten bei Grandoli Fußball spielen. Das sollte ihnen eine gewisse Tagesstruktur verleihen und sie froh und selbstbewusst machen. Aparicio gehören auch die Videofilme von dem fünfjährigen Leo, auf denen er in seinem rot-weißen Trikot zu sehen ist. Er war klein, ging aber mit Tempo und ungeheurer Wendigkeit ans Werk, dribbelte geschickt um jeden Gegner herum und erzielte großartige Tore. Sofort danach nahm er den Ball wieder auf und legte ihn auf den Anstoßpunkt, um gleich wieder loslegen zu können.
»Bei jedem Spiel machte er sechs oder sieben Tore. Er stellte sich in die Mitte des Platzes und wartete auf den Ball vom Torwart. Dieser kickte ihm den Ball zu. Nahm ein anderer ihn an, jagte Leo diesem den Ball sofort wieder ab und dribbelte los. Das war beinahe übernatürlich.« So beschreibt es Don Apa in Interviews. »Wenn wir aufs Spielfeld gingen, dann kamen die Leute in Scharen, um zuzuschauen. Hatte er den Ball, dann kontrollierte er ihn auch. Es war unglaublich, die Gegner konnten einfach nichts ausrichten. Im Spiel gegen Amanecer machte er einmal ein Tor wie aus einem Werbefilm. Ich erinnere mich noch gut: Er dribbelte an allen vorbei, sogar am Torwart. Er spielte so wie jetzt, ganz locker. Er war sonst eher still und ernst und suchte immer die Nähe seiner Großmutter. Er hat nie gegen etwas protestiert. Wenn er einen harten Ball abbekam, dann weinte er manchmal, stand aber sofort wieder auf und spielte weiter. Jedes Mal, wenn ich ihn auf dem Video spielen sehe, werde ich sentimental. Wenn ich sein Maradona-Tor gegen Getafe ansehe, fühle ich mich immer an diesen kleinen Kerl von damals erinnert …«
David Treves, der Aparicio als Trainer ablöste, ist heute Präsident von Grandoli. Er zeigt stolz die Pokale vor, die Grandoli gewonnen hat, und auch die Mannschaftsbilder. Messi ist der mit dem zu großen Trikot. »Es kommt sehr selten vor, dass ein Junge in diesem Alter schon so viel leistet«, bestätigt Treves. »Man munkelte damals gern, wir hätten den nächsten Maradona bei uns. Der beste Fußballspieler der Welt begann hier sein Training, und sein erstes Fußballtrikot war das von Grandoli.«
»Wenn er am Ball war, dann landete der auch immer im Tor, auch wenn er von anderen noch so heftig daran gehindert wurde. So ist es eben: Wenn einer klein, aber gut ist, dann versuchen die anderen sofort, sich mit Gewalt zu rächen«, erinnert sich Gonzalo Diaz, der mit Leo in einer Mannschaft bei Grandoli spielte.
Matías Messi erinnert sich noch gut an diese Zeit, zu der er selbst noch von einer Karriere als Fußballprofi träumte: »Es gab oft Probleme, weil er so wahnsinnig gut spielte. Manche Trainer schworen ihre Mannschaft regelrecht darauf ein, ihn fertigzumachen, wenn sie mit fairem Spiel nicht in Ballbesitz kamen. Das muss man mit eigenen Augen gesehen haben, sonst glaubt man es kaum. Es gab aber auch Spieler, die sein spielerisches Können bewunderten. ›Wie machst du das nur?‹, fragten sie ihn dann.«
Ja, Leo, er war ein Torjäger, ein brillanter Spieler – aber eben kein Teamplayer.
Bei Grandoli gab es aber auch andere aussichtsreiche Talente. »Ich habe so einige gesehen, die Messis Potenzial hatten, aber ihnen fehlte es an seiner Ausdauer«, erinnert sich Gonzalo Diaz. Ohne Durchhaltevermögen aber bleibt der Weg zum Profifußball versperrt.
Auch Jorge Messi hatte von einer Profikarriere geträumt, aber nach vier Jahren auf der NOB-Akademie, als sich gerade erste Chancen auf ein Team zu ergeben begannen, musste er zum Militär, und danach heiratete er sofort. Als Jorge 29 war, in dem Alter also, in dem die meisten Profifußballer den Höhepunkt ihrer Laufbahn erreicht haben, wurde Leo geboren.
Jorge erzog Leo zu harter Arbeit, Ausdauer und Bescheidenheit. Nur so lassen Ziele sich erreichen, das war sein Credo. Vielleicht hält sich Messi daher heute auch fern vom Starrummel. Er steht nicht gern im Rampenlicht. Für Jorge und die Mehrheit der Argentinier seiner Generation war Diego Maradona der Stern am Fußballhimmel. Jorge sah sich oft und mit Begeisterung Videos seiner Spiele mit seinen Söhnen an.
So vermittelte er ihnen Anerkennung für einen Fußballspieler, der an der Spitze seiner Mannschaft stand, der den Ball geradezu liebkoste, wenn er mit ihm spielte, und der in seinen Füßen Macht über eine ganze Nation hatte. Für Lionel und andere seines Alters war ein solcher Fußballgott der ehemalige River-Spieler Pablo Aimar. Lionel hat oft gesagt, er habe keine Idole gehabt, aber Aimar immer gern zugesehen. Ob er wirklich gar keine Idole hatte? Brauchen wir die nicht alle? Als er mit zwölf Jahren danach gefragt wurde, hatte er jedenfalls eine Antwort parat: »Meinen Vater und meinen Patenonkel Claudio.« Im selben Interview bezeichnete er die Bescheidenheit als wichtigste Tugend. Da hätte ihm Jorge sicher zugestimmt.
Jorge ist ein zurückhaltender Mann, manchmal wirkt er regelrecht kühl. Leo beobachtete ihn oft, wenn er mit seinen Arbeitskollegen von Acindar als Mittelfeldspieler in Aktion war. Jorge wusste über Fußball gut Bescheid. Die Messis sahen sich jedes Wochenende die Spiele ihrer Söhne Leo und Matías an. Eines Tages fragte man Jorge, ob er den Jahrgang 1987 trainieren wolle. So wurde er Leos zweiter Trainer. »Wir spielten in der Alfi-Liga in freien Wettbewerben in Rosario und in den angrenzenden Gemeinden. Bei den U-13-Jahrgängen gab es verschiedene Kategorien. Die Mannschaften spielten immer auf einem kleineren Spielfeld als normal, 7 gegen 7«, berichtete Jorge Toni Frieros.
Dreimal die Woche ließ Jorge die Jungen einfache Übungen mit dem Ball machen, damit sie ihre Technik verbesserten. Die Jungs nahmen neue Tricks lernbegierig an, waren bei der Sache und befolgten eifrig Jorges Anweisungen. Leo absolvierte keine speziellen Übungen. Weder übte er Pässe mit rechts noch Hindernisdribbeln, um sein schwächeres rechtes Bein zu trainieren. Sein Vater hielt ihn nie dazu an. Leo spielte einfach, wie er spielte, und sein Vater akzeptierte seinen freien Geist beim wöchentlichen Training.
1994 war Leo sechs Jahre alt.
Jorge Messis Mannschaft verlor in dem einen Jahr, in dem er Trainer war, kein einziges Spiel. »Wir holten uns den Ligasieg, gewannen alle Turniere und auch die Freundschaftsspiele. Vielleicht klingt es ein wenig anmaßend, aber die Mannschaft erregte damals schon Aufmerksamkeit, weil sie auf so hohem Niveau spielte. Leo war der herausragende Spieler im Team«, erklärte Jorge der argentinischen Presse. »In seiner Mannschaft – und das sage ich ohne Übertreibung – hat er alles gestemmt. Er schoss die Tore, meisterte brenzlige Situationen, alles hing von ihm ab. Okay, ich bin sein Vater, und er ist mein Sohn, aber darum geht es nicht. Ich sage das, weil es wirklich so war«, erzählte er dem Kicker.
Ein anderer Journalist fragte Jorge einmal, ob Leo mehr auf ihn als Vater oder als Trainer gehört habe. Jorge antwortete: »Er spielte ohnehin sehr diszipliniert und tat, was man ihm sagte. Er befolgte immer meine Anweisungen als Trainer. Auch heute ist das noch so. Zum Beispiel wollte Frank Rijkaard beim FC Barcelona ihn rechts einsetzen. Leo war damit einverstanden. Er tut einfach, was man ihm sagt.«
»Im Leben gibt es drei wichtige Dinge: Man muss eine Mission haben, eine Vision und Werte«, erläutert die argentinische Sportpsychologin Liliana Grabín. »Es ist wichtig, dass ein Vater Werte vermittelt und eine Vorbildfunktion erfüllt. Leo hat den starken Charakter seiner Mutter geerbt und die Ruhe, Toleranz und Geduld seines Vaters. Das ist eine schwierige Kombination. Yin und Yang, würde ich sagen. Aber sein Vater vermittelte ihm auch Demut, Beharrlichkeit und Opfermut.«
Der Sohn Leo Messi ist auch ein Ergebnis der Visionen seines Vaters. Jorge Messi hat einmal gesagt, die Menschen den eigenen Namen im Chor rufen zu hören sei das beste, was einem je passieren könne. So einen Traum gibt man gern weiter. Als er sah, wie gut Leo spielte, wurde er natürlich zum stolzen Vater. Er hatte immer gewollt, dass sein Sohn aus der Menge hervortreten würde. Und ein Sohn will immer seinem Vater gefallen. Dessen Vision erfüllen, selbst wenn er es ganz unbewusst tut. All das ist Teil der Reise zum Ruhm. Jorge setzte das Ziel und beschwor es immer wieder von Neuem: »Du kannst es schaffen, du kannst Profi werden.«
»Die Familie trug die Werte bei und die Vision. Leos Auftrag war es, Fußball zu spielen. Er hatte offensichtlich Talent, und seine Eltern ebneten ihm den Weg, um dieses Talent weiterzuentwickeln«, erklärt Grabín.
Als Vater, Trainer und Ratgeber übernahm Jorge eine zentrale Funktion. Als der Erfolg da war, lobte er ihn nicht über Gebühr, obwohl die ganze Welt ihn feierte. Er wollte ihm vielmehr eine Lebensperspektive aufzeigen. Und wenn es nötig war, dann ermahnte er ihn auch, sich auf seine Werte zu besinnen. Er wollte, dass Leo die Bodenhaftung nicht verlor, besonders in Zeiten, in denen es allzu leicht gewesen wäre, sich von seinen Erfolgen und dem damit verbundenen Ruhm ablenken zu lassen. Er sollte nur sein großes Ziel im Auge behalten.
Jorge war also von Anfang an Vater, Orientierung, Spiegel, Mentor und Gegengewicht für Leo – sein wahrer Held. Natürlich rebellierte Leo manchmal gegen seinen Vater, aber dieser ist und bleibt sein Weggefährte und engster Vertrauter.
Jorge entschied, dass Leo nicht mehr bei Grandoli weiterspielen sollte. Der Grund: Die ganze Familie hatte sich jeden Samstag die Spiele angesehen, aber einmal waren sie nicht in der Lage gewesen, die zwei Pesos Eintritt zu bezahlen. Der Verein war nicht bereit, sich kulant zu zeigen, und man ließ die Familie tatsächlich nicht zuschauen. Das war Leos letztes Spiel bei Grandoli gewesen.
Auch die Grundschullehrerin Mónica Dómina erinnert sich gerne an Leo. »Ja, er war sehr still. Leider behält man ja immer die Schüler besonders im Gedächtnis, die einem Probleme gemacht haben und die sich schlecht benahmen. Aber Leo war ruhig und höflich. Und zeigte nicht gern Gefühle. Seine Freundin Cintia war wie eine Beschützerin für ihn. Sie war viel größer als er. Er wirkte fast wie ein Kindergartenkind neben ihr. Er hatte so ein freundliches kleines Gesicht … eigentlich genau wie heute. Man hätte ihn am liebsten immer umarmt! Und als er klein war, natürlich erst recht. Damals war eine Lehrerin so etwas wie eine zweite Mutter. Nicht so wie heute, so ganz ohne mütterliche Instinkte. Wir haben das noch anders gemacht. Er saß oft auf meinem Schoß, um zu kuscheln. Er war sehr umgänglich, aber er sprach fast nie. Daran erinnere ich mich gut, weil ich mich sehr darum bemühte, ihn im Unterricht zum Sprechen zu bewegen. Ich versuchte, während der Freiarbeitszeit, beim Malen zum Beispiel, mit ihm zu reden. Aber er blieb stur. Er sagte nur Ja und Nein, sonst nichts. Nur wenn ich ihn etwas Fachliches fragte, ihm eine Rechenaufgabe oder Verständnisfragen stellte, dann gab er Antwort. Das hat mich ein wenig beruhigt.
Normalerweise saß er immer in der ersten Reihe. Er erledigte zwar seine Aufgaben, ohne zu murren, brachte sich aber nicht im Unterricht ein. Er hatte Probleme, an der Klassengemeinschaft teilzunehmen. Wir Lehrer unterstützten ihn, und er tat eben, was er konnte. Es war ja nicht so, dass er intellektuell nicht zu einer aktiven Beteiligung in der Lage gewesen wäre. Er wollte einfach nicht, weil er andere Interessen hatte; er wollte immer nur eines: einen Ball. Er war ein normaler Schüler, aber kein besonders guter. Er tat, was nötig war, aber nicht mehr; er war nicht sehr fleißig. Im siebten Schuljahr hatte er jedoch ein ordentliches Zeugnis. Eine Zeitung druckte ein Bild von dem Buch ab, in dem die Noten der Schüler verzeichnet waren, und zwar die Seite mit Leos Noten. Natürlich war er in Sport einer der Besten, aber auch Musik und handwerkliche Arbeiten lagen ihm. In Spanisch und Rechnen war er mittelmäßig.
Aber das eine Bild, das ich immer vor Augen habe, ist, wie er auf dem Schulhof Fußball spielt. Manchmal hatten die Kinder auch keinen Ball zur Verfügung, dann nahmen sie, was sie finden konnten, zum Beispiel Socken oder Papiertüten oder sogar Knetmasse aus dem Kunstunterricht. Aber normalerweise hatten sie einen Ball. Der Sportlehrer hatte einen Schrank, aus dem sie sich einen nehmen konnten, manchmal brachten sie auch einen von zu Hause mit. Heutzutage geben wir den Kindern keinen Ball mehr aus unserem Bestand. Denn sie benutzen ihn nur noch dazu, andere Kinder damit abzuschießen. Damals gingen die Kinder anders miteinander um. Auch wenn 100 gleichzeitig versammelt waren, sie passten trotzdem auf sich auf. Deshalb durften sie auch auf dem Schulhof Fußball spielen. All seine Freunde sahen Leo als ihren Anführer an. Auf den Klassenfotos stand er immer in der Mitte. Die Kinder liebten ihn. Immer rief einer: ›Komm Leo, lass uns zusammen spielen!‹ Sie bewunderten ihn für seine Wendigkeit und Schnelligkeit. Wenn sie Fangen spielten, dann konnte ihn nie jemand einholen. Er hatte Spaß an allen sportlichen Aktivitäten. Damit hat er die anderen angesteckt. Er spielte niemandem Streiche oder so etwas, aber wenn man ihm in die Augen schaute, wusste man, dass er einen eigenen starken Willen hatte. Ich wollte seine Mutter immer fragen, wie er sich zu Hause benahm, denn in der Schule war er immer brav, um seine Erlaubnis zum Fußballspielen nicht aufs Spiel zu setzen. Wenn es klingelte, rannte er als Erster nach draußen und alle anderen hinter ihm her. Die Pause wurde stets für ein kleines Fußballmatch genutzt. Jeweils nach 40 Minuten Unterricht gab es eine Pause von 15 Minuten. Heute dauert eine Schulstunde 60 Minuten, und erst dann gibt es eine Erholungspause. In der großen Pause veranstalteten die Schüler Miniturniere, die manchmal vom Unterricht unterbrochen wurden und erst später weitergespielt werden konnten. In den Pausen verwandelte sich Leo in ein anderes Kind. Ob sie nun 7 gegen 7 oder Mann gegen Mann spielten, er war immer am Ball. Bei ihm ging es nur darum, die anderen kunstvoll zu umdribbeln, weniger um das Fußballspiel an sich. Es schien, als wäre er stets im Training. Als seine Mutter einmal stolz mit all seinen Pokalen in die Schule kam, war ihm das peinlich. Er wollte einfach nur Fußball spielen, weil das seine Leidenschaft war, so wie heute noch. Und er wollte immer so wie die anderen auch behandelt werden. Das ist eine Charaktereigenschaft, die ihn auch heute noch auszeichnet. Er ist ein Engel. Manchmal treffe ich seine Mutter im Supermarkt, und sie ist immer sehr bescheiden. Sie kleidet sich auch so. Manche Mütter von Fußballstars sind da ganz anders und versuchen, sich groß als die Mutter von in Szene zu setzen. Aber sie ist unkompliziert, hat einen guten Charakter, und so ist Leo auch. Er gibt nicht an mit seinem Geld. Ich denke, er führt auch heute noch ein einfaches, bescheidenes Leben. Diese Werte haben ihm seine Eltern vermittelt.«
Leo hatte es nicht weit bis zur Schule in Las Heras. Morgens schnappte er sich seinen Ball und spielte noch eine Runde in den Armeebaracken, bevor er an die Buenos-Aires-Kreuzung zur Plaza Juan Hernández kam. Die kleine Schule war weiß und grün gestrichen, die Fenster waren vergittert und zeigten zur einen Seite auf einen nicht sehr gepflegten Platz mit Bäumen und Bänken ringsum. Sie hatte einen guten Ruf, denn hier wurde den Kindern gutes Benehmen beigebracht. Außerdem ist nicht das Gebäude bei einer Schule entscheidend, sondern das, was die Lehrer zu vermitteln versuchen. Es gab und gibt dort Benimmregeln und gewisse Wertvorstellungen. Die Lehrer legen Wert darauf, dass die Kinder weiterkommen und sich anstrengen. Also eine wirklich gute staatliche Schule.
Der Schulhof, den man durch ein Tor betritt und in dessen Mitte ein Baum steht, ist sehr klein. Er eignete sich nicht für Ballspiele; nicht einmal für Fußballspielen mit nur einem Tor. Aus dem Grund spielte Leo mit seinen Freunden woanders.
»Es gibt heute eine Mehrzweckhalle, in der auch Schulversammlungen stattfinden, aber als Leo hier zur Schule ging, war sie noch nicht da. Es existierte nur ein kleines Feld in der Nähe, auf dem die Kinder dann in der Pause spielten«, sagt Diana Torreto, die Leo unterrichtete, als er sechs Jahre alt war. Sie ist noch immer sehr gerührt, wenn sie von »dem Floh« spricht. »Manchmal gingen die Lehrer mit den Kindern auf dieses Feld. Ich erinnere mich gut, dass die anderen Kinder keine Chance hatten, den Ball zu bekommen, darüber muss ich heute noch lachen. Dann kamen sie zu mir gelaufen und beklagten sich, dass Leo nie den Ball abgab. Sie haben es einfach nicht geschafft, ihm den Ball abzuluchsen. Er war ein glücklicher Junge, introvertiert, aber glücklich. Er lachte immer. Und er hatte viele Freunde. Er war bei seinen Mitschülern sehr beliebt. Man merkte, dass er Eltern hatte, die sich gut um ihn kümmerten. Seine Mutter sagte uns, er sei oft ungezogen zu Hause, und fragte, wie er sich in der Schule benähme.«
Es gab also schon drei Leos: den Leo zu Hause, den Leo in der Schule und den Leo beim Fußball. Diana Torreto beantwortet die Frage, warum er seine Familie, seine Schule und seine Freunde so sehr brauchte. »Er forderte es irgendwie ein, dass man ihn im Auge behielt, nach ihm schaute. Vermutlich hatte er deshalb so viele Freunde. Er hatte wirklich die Fähigkeit, andere mitzuziehen und zu begeistern, echte Führungsqualitäten. Vielleicht war er sich dessen gar nicht bewusst. Das stand im krassen Widerspruch zu seinem passiven Verhalten im Unterricht. Aber wo immer er hinging, folgten ihm seine Klassenkameraden. Er organisierte Fußballspiele, weil es seine Leidenschaft war. Das ist schon außergewöhnlich. Es war, als hätte er zwei Persönlichkeiten.« Auf die Frage, wo Messi heute wäre, wenn er nicht der Messi wäre, erwidert Torreto: »Ich denke, er wäre bei seiner Familie. Er hätte eine eigene Familie gegründet, so wie jetzt auch, auf die er stolz ist. Wir hoffen, dass er eines Tages seinem Sohn Thiago einmal seine Grundschule zeigen möchte.«
Leo wurde immer von seinen Freunden und von Erwachsenen beschützt. Weil er so klein war. Weil er so gut Fußball spielte. Weil er der eigene Sohn oder der Sohn eines Freundes war. Oder einfach, weil er ein guter Junge war und ein verschmitztes Lächeln hatte. In der Schule wollte ihn niemand ärgern. Dort waren alle auf seiner Seite. Es ist leichter, sich als Mensch und Fußballer weiterzuentwickeln, wenn ein solch enormes Sicherheitsnetz vorhanden ist.
Normalerweise wird jeder Schüler erst von den Mitschülern beäugt und irgendwie auf die Probe gestellt, und das hat nichts mit seiner schulischen Leistung zu tun. Kinder können grausam sein und sich gegenseitig schikanieren. Aber die Kinder müssen selbst dafür sorgen, dass sie richtig damit umgehen und damit zurechtkommen. Leo war sich schon bewusst, dass er zu klein war, aber die anderen Kinder störten sich nicht daran, weil er so ein Ballzauberer war. Deshalb wurde er nie gemobbt. Im Gegenteil – die Schüler kämpften darum, in seiner Mannschaft spielen zu dürfen. Das war die Garantie für den Sieg. Es war in der Schule immer besser, zum Siegerteam zu gehören. Auch die älteren Schüler baten ihn, bei ihnen mitzuspielen, wenn einer fehlte. Die Lehrer hatten ständig Probleme, Leo klarzumachen, dass das Spiel vorbei war und er wieder zum Unterricht kommen musste. Dieser Kampf fand eigentlich täglich statt.«
Die neue Schuldirektorin Cristina Castañeira betrachtet das Phänomen Messi mit einem gewissen Erstaunen. »Es ist schon komisch, wie präsent Leo Messi heute überall in der Schule ist. Alle wissen, dass er hier mal Unterricht hatte. Man redet nicht ständig über ihn, aber es ist trotzdem so. Ich werde dafür sorgen, dass es bald einen Schaukasten für Messis Zeitungsausschnitte und Bilder gibt. Bisher haben wir so etwas noch nicht. Ich denke, es würde die anderen motivieren. Natürlich wird er nicht in den Lehrplan aufgenommen, aber hierher kommen Fans und Besucher, und da ist es schön, wenn man etwas vorzeigen kann. Vielleicht kommt er ja einmal selbst wieder hierher. Ich arbeite schon seit 30 Jahren als Lehrerin. Mit dieser Idee weiche ich vielleicht von den Schulregeln ab, aber das macht nichts. Ich möchte einfach, dass sich die Schüler an ihn erinnern. Wir sind doch alle stolz auf ihn. Seine Werte können gern von anderen Kindern übernommen werden. Vielleicht könnte man einen Werbefilm mit ihm machen, in dem er Kinder zum Zähneputzen anhält oder zu gutem schulischen Betragen. Ich bin sicher, das ganze Land würde sich regelmäßig die Zähne putzen und sich besser benehmen. Aber ich weiß nicht, ob sich das realisieren lässt.«
Wenn Leo kein Training hatte, dann spielte er Fußball mit seinen Freunden aus der Nachbarschaft, wie zum Beispiel mit Diego Vallejos. Dieser erzählt: »Wir haben viel zusammen gemacht, es gab immer etwas Neues, das wir ausprobierten. Wir machten nie Unfug, manchmal landete der Ball vielleicht in den Blumenbeeten, aber nichts Schlimmeres. Der Platz in der Nähe seines Hauses war unser argentinisches Camp Nou. Dort nahm alles seinen Anfang. Das war unsere Welt.«
»Wir haben den Drahtzaun eines Platzes bei den Baracken zerschnitten, damit wir dort spielen konnten, wurden aber vom Militär weggescheucht«, erzählt ein anderer Freund namens Walter Barrera. »Das Feld war so einladend und hatte einen Rasen. Und keiner lief je darüber. Manchmal, wenn wir dort verbotenerweise spielten, holten die Soldaten uns hinein und drohten uns mit Arrest. Sie wollten uns nur einen Schreck einjagen.«
Leo verbrachte seine Grundschulzeit in Las Heras, bis er mit 13 Jahren auf die Escuela Juan Mantovani auf der Avenida Uriburu in unmittelbarer Nähe seines Zuhauses wechselte. Nur um bereits vier Monate später diese Schule wieder zu verlassen. Für ihn bedeutete der Schulwechsel einen großen Umbruch, da jetzt nicht mehr seine Freundin Cintia beschützend an seiner Seite stand.
Leo unterstützt heute zwar seine Grundschule in Las Heras mit Geldspenden, nicht aber diese weiterführende Schule. 2005 kehrte er noch einmal dorthin zurück. Mit dem Sohn einer der Lehrerinnen hatte Leo einmal zusammen Fußball gespielt, und besagte Lehrerin nahm den Kontakt zum Anlass, Leo zum Schuljubiläum einzuladen. Damals war er noch nicht so berühmt wie heute, aber alle freuten sich, dass er beim Fest dabei war. Zwei Jahre später, bei einer anderen Gelegenheit, tauchte er wieder dort auf, um seinen Cousin Bruno Biancucchi zu besuchen. Es war für alle eine große Überraschung, als er plötzlich mit Brunos Mutter, seiner Tante Marcela, in der Tür stand. Ihm selbst war das eher peinlich, und er hielt sich zunächst im Hintergrund.
Aber plötzlich schien ihn etwas drastisch umzustimmen. Er fing an, sich mit den Kindern an der Schule zu unterhalten. Er machte seine Runde durch alle Klassenzimmer, verteilte Küsschen, gab Autogramme und ließ es zu, dass seine Fans Fotos von ihm machten. Für die Eltern und Schüler waren es drei unvergessliche Stunden. Ein kleiner fünfjähriger Junge sagte zu seinem Freund: »Kneif mich mal – Lionel Messi ist hier!«