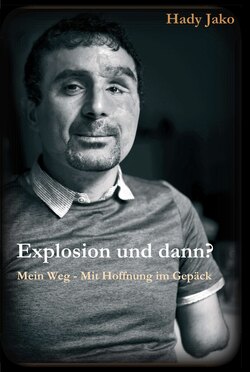Читать книгу Explosion und dann? - Hady Jako - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1: Bombenexplosion – Tage der Finsternis
Ich bin Hady Jako vom Stamm (*) der Raschka. Ich wurde am 01.01.1985 in Gohbal (*) geboren, einem Dorf im Norden des Distriktes Shingal (*), Provinz Ninive (*), Zentralirak. (*)
27.03.2006: An diesem Montag ging ich zu einer Rekrutierungsstelle in der Nähe der Stadt Mosul (*) im Distrikt Mosul. Dort wollte ich mich als Soldat registrieren lassen. Meine Freunde, einige Verwandte und viele junge Männer aus dem Dorf waren auch dabei. Wir wollten zusammen stark sein, für unser Dorf, für unsere Heimat. Wir wussten, dass die Folgen dieser Entscheidung gefährlich werden könnten. Meine Tante Khefsche hatte mich zuvor noch angefleht, ich möge nicht gehen. Sie habe in der Nacht geträumt, es gäbe ein Unglück …
Auf dem Platz vor der Kaserne befanden sich ca. 700 Männer, die sich registrieren lassen wollten. Überwiegend junge Männer waren das. Es gab keine Kontrollen, als wir uns zu den Wartenden stellten. Erst beim Einlass in die Kaserne wurde kontrolliert. Die Stimmung war aufgeladen, entschlossen, die Gemeinschaft machte Mut, wir standen wild durcheinander, doch das Ziel vor Augen einte uns. Das letzte, an das ich mich sehr viel später erinnerte, war dies: Ich rauche eine eilige Zigarette mit Freunden …
Da ertönte ein dröhnender, feuriger Knall! Eine brennende Wucht schlug mich nieder! Wie von weit her sprach eine Stimme: „Hady, was ist mit dir“? „Ich weiß nicht, aber Gott wird mir helfen.“ Hilfesuchende Blicke, wildes Gedankenkreisen … „ Es hat sich jemand in die Luft gesprengt, du warst nah dran Hady!“ Kathan, ein Bekannter aus dem Dorf sprach mit mir, aber ich hörte ihn nicht mehr. Das Koma trug mich fort, eine ganze Woche lang. Später erzählte man mir, dass ich ins amerikanische Lazarett gebracht worden war. Mein Bruder Ali hatte überall in verschiedenen Krankenhäusern im Irak nach mir gesucht. Schließlich hatte er vor mir gestanden – und mich doch nicht gesehen. Unmöglich war es, mich zu erkennen. Die Ärzte wussten auch nicht, wen sie da vor sich hatten – mehr tot als lebendig.
Das Koma bescherte mir seltsame Träume: Ich war zu Hause mit meinen Geschwistern, im Garten und bei meinen Schafen. Es gab einen riesigen, wunderschönen Saal. Mein Onkel Yousef und mein Onkel zweiten Grades Alo waren auch anwesend; sie wollten mich nach Hause holen - aber dann sah ich im Traum meine Lieben sterben und aus dem Saal hinauf in den Himmel fliegen.
Das Erwachen aus dem Koma geschah voller Verwirrung und Schmerz. Ich quälte mich, griff nach meinen Wunden – was war das, wo war mein Arm? Ich konnte meine Hände nicht zusammenführen, mir fehlte eine Hand! Voller Grauen merkte ich, dass mir der ganze linke Unterarm fehlte, der Oberarm war ein Stumpf! Was war das, überall fühlte ich Fäden?! Ich zog daran, zog mir die Nähte aus der Haut. Wie konnte es möglich sein, dass ich verletzt war?
Irgendwann hielt mir jemand einen Spiegel vor, in den ich hineinsah: Ein Arm fehlte, ein Auge war verwundet, mein rechter Oberschenkelknochen ragte blank aus einer Wunde heraus, mein Bauch war von einem Verband verdeckt. Ich sah grauenhaft aus! Und doch, ich lebte!
Dr. Corbin, Utah, USA:
„27.03.2006; The mass casualty numbers were so great on this day when we heard they were bringing 33 significantly injured patients from an outlying providence. I was on trauma call that day and was assigned to help with the casualties. The 47th Combat Support Hospital located on Forward Operating Diamond Back was known for saving human life at a greater rate than trauma centers in the United States.
Here we waited and when they came, we numbered the patients and coded them as to treat them. It was then I met Hady, he was coded as a potential non-survivor as he was so injured and there were many ahead. He was to be placed in a room and observed while we treated those, we felt we could save.
He somehow and miraculously showed signs he was beginning to wake when we immediately took him to the Operating Room. This was a big job, he was missing an Arm, most of his face was blown off and the left eye was massively wounded.
Once in the OR, I was able to establish his emergency cricothyroidotomy was misplaced therefore I properly performed an emergent tracheostomy and established an airway. Once this was done, we removed a human jawbone from his thigh wound, they properly closed off his left arm that had been blown off, and we took great care to put back his face the best we could.
We were successful in saving Hady’s life, he recovered well. What I remember most about Hady was his smile, he never came across as feeling sorry for himself, was very grateful to me and to my wife for sending me materials to make him an eye patch to cover the significant wound where he lost his left eye.
I remember Hady returned to the operating base hospital and brought two rings which I still have to give to the children that I had at the time as my third was not born at the time. I will never forget Hady and the blessings I received from working on and help mending him from his injuries. Have much love and smiles when I think of Hady.“
Übersetzung: „27.03.2006; Die Massenunfallzahl an diesem Tag war sehr hoch, als wir hörten, man werde uns 33 Schwerverletzte aus einer abgelegenen Gegend bringen. Ich war an diesem Tag im Dienst für Verletzte und wurde diesem Einsatz zugeteilt. Das 47. Combat Support Hospital in Forward Operating Diamond Back war bekannt für seine aus irgendeinem Grund vergleichbar hohe Anzahl von geretteten Menschenleben gegenüber der von Trauma-Kliniken in den Vereinigten Staaten.
Hier warteten wir, und als sie kamen, zählten wir die Patienten und teilten sie nach Behandlungsart bzw. Überlebenschance ein. Das war der Moment, als ich auf Hady traf. Er war als potenzieller ‚Non-Survivor‘ (Nicht-Überlebender) identifiziert worden, weil er so schwer verwundet war und weil so viele vor ihm da waren. Er sollte in einen Raum zur Beobachtung gebracht werden, während wir diejenigen behandelten, von denen wir glaubten, sie retten zu können.
Irgendwie, wie durch ein Wunder zeigte er Anzeichen, zu sich zu kommen. Wir brachten ihn sofort in den Operationsraum. Es war eine riesige Aufgabe: Ihm fehlte ein Arm, das meiste von seinem Gesicht war weggerissen, das linke Auge stark verwundet.
Nachdem er im OP war, war es mir möglich festzustellen, dass seine Krikothyrotomie fehlplatziert war. Daher setzte ich umgehend einen Luftröhrenschnitt und stellte so einen Atemweg her. Nachdem das getan war, entnahmen wir ein Stück Kieferknochen (verbombtes Splitterteil einer anderen Leiche, Anmerkung der Übersetzerin) aus seiner Oberschenkelwunde, verschlossen sorgfältig seinen linken Arm, der weggebombt war, und wir behandelten mit großer Sorgfalt sein Gesicht, um es so gut wir konnten wieder herzustellen. Wir retteten an diesem Tag erfolgreich das Leben von Hady, er erholte sich gut.
An was ich mich am deutlichsten bezüglich Hady erinnere, ist sein Lächeln, er kam niemals mit Selbstmitleid daher; er war sehr dankbar mir und meiner Frau gegenüber, die mir eine Augenklappe schickte, um die bedeutende Wunde zu bedecken, wo er sein linkes Auge verloren hatte.
Ich erinnere mich daran, wie Hady zurück zum Operating Base Hospital kam. Er schenkte mir zwei Ringe, die ich noch immer habe, um sie (mit seiner Geschichte) an meine beiden Kinder, die ich damals hatte, als mein drittes Kind noch nicht geboren war, weiterzugeben.
Ich werde Hady niemals vergessen und den Segen, den ich durch meinen Einsatz für ihn und für die Behandlung seiner Wunden erhielt. Ich empfinde viel Liebe und Optimismus, wenn ich an Hady denke.“
Im Krankenhaus blickte ich verstört zu den Ärzten, doch sie schienen sich zu freuen: Ich hätte Glück gehabt! Sie schienen tatsächlich froh zu sein, dass ich laufen konnte und waren stolz darauf. „Wir haben dein Leben gerettet, dein Gesicht und dein Bauch waren zerfetzt, die Gedärme hingen heraus, und nun sieh dich an, du lebst! Bitte, ein Foto! Ein Wunder! Du lebst!“
Aber ich – ich verstand das alles damals nicht, und ich dachte, ich komme nie wieder nach Hause. Ich konnte mit meinem Luftröhrenschnitt im Hals nicht sprechen und Panik überflutete meine Seele …
Ali, mein Bruder, und Hussein, mein Cousin 2. Grades, waren zu dieser Zeit immer noch auf der Suche nach mir, nach meinem Leichnam. Erneut flehten und weinten sie: „Wir wissen, Hady lebt nicht mehr, aber wir wollen seinen Leichnam finden, damit wir ihn begraben können.“
Ein Dolmetscher hatte Mitleid mit ihnen. Bei den Leichen sei kein Hady, er würde bei den schwer Verletzten noch einmal suchen. „Hady Jako!“, rief er die Verletzten an. Doch wie sollte ich jetzt ohne Stimme und mit Luftröhrenschnitt antworten?! Wild gestikulierend deutete ich das Schreiben in der Luft an und erhielt bald einen Stift. Dann schrieb ich in lateinischer Schrift, so dass es lesbar für Amerikaner war: ‚Hady, Hady Jako.‘ Doch er glaubte mir nicht – diesem verwirrten Opfer – und lies mich auf Arabisch schreiben: ‚Ich bin Hady Jako!‘ „Hady Jako?“, sprach der Dolmetscher erstaunt. ‚Jaaa‘ rief ich durch heftiges Kopfnicken und dabei schrie ich innerlich so laut ich konnte. Da lief der Mann fort.
Ich weiß heute nicht mehr, ob er mir etwas von der Suche meiner Familie erzählte. Ali und Hussein aber wurden erlöst. „Ich habe ihn gefunden!“, rief der Dolmetscher ihnen zu; übermorgen dürften die beiden mich besuchen; ihr Bruder werde überglücklich sein, sie zu sehen! Unvorstellbar war es: zwei Tage lang warten. Zwei volle Tage lang! Wie werden sie wohl sehnsüchtig die Stunden gezählt haben! Endlich wurde mein Bett vorbereitend mit Vorhängen umstellt – so bot man uns ein wenig persönliche Atmosphäre.
Dann waren Ali und Hussein tatsächlich da. Stürmisch umschlangen wir uns; wir hielten uns ganz fest umarmt und schluchzten und lachten minutenlang. Dann, langsam, setzten sie sich zurecht und berichteten mir, was geschehen war. Ein Selbstmordattentat vor der Kaserne hatte es gegeben; ich sei eines der Opfer. „Und die anderen, wo sind die anderen?“, wollte ich wissen. Sie seien zu Hause und bei der Arbeit, antworteten sie mir. Mein Kopf schien vor Schmerz zu platzen, alles drehte sich. Eine Mischung aus Schmerzen, Medikamenten und verwirrten Gefühlen trug mich erneut davon.
In den nächsten Tagen war eine weitere Operation geplant. Wieder verlor ich viel Blut; die Bettwäsche war durchnässt. Mein Alltag bestand aus Warten von einer Wundversorgung bis zur nächsten. Sehr, sehr langsam besserte sich mein Zustand. Nach Wochen hieß es, ich könne nach Hause und zwar ohne Verlegung in ein irakisches Krankenhaus!
Das hatte mein Bruder zum Glück verhindern können. Denn in irakischen Hospitälern wurden Patienten, die von Amerikanern behandelt worden waren, sogleich getötet. Überlebende Zeugen des Bombenterrors und von den Amerikanern Gerettete wollte man nicht haben! Das hatten wir gewusst; das hatten wir schon in der direkten Nachbarschaft erfahren müssen. Dort war ein Bekannter nach einem Verkehrsunfall von Amerikanern gerettet und in ein irakisches Krankenhaus gebracht worden. Doch hier war er sofort getötet worden. Unfassbar! Mein Bruder hatte also gut aufgepasst und nicht zugelassen, dass ich in ein irakisches Krankenhaus verlegt wurde. So konnte ich dem Tod erneut entrinnen.
Zu Hause wartete meine Familie. Es war ein trauriges Wiedersehen. Ich war der Sohn, der Bruder, der Freund und der Nachbar – mit schweren, bleibenden Behinderungen. Alle nahmen mich beseelt in die Arme, und im Nebenzimmer weinten sie, endlos. Doch das erlebte ich nicht mit. Ebenso erfuhr ich auch nichts von anderen Verlusten: Meine Besucher vermieden es, die Farbe der Trauer zu tragen, und sie vermieden es, meine Fragen zu beantworten. „Deine Freunde? Sie sind bei der Arbeit und werden später kommen.“ Doch die Freunde kamen nicht. Bald beschlich mich eine grauenvolle Ahnung. Derweil betete (*) meine Familie und dankte Gott für meine Rückkehr. Zum Zeichen ihrer Dankbarkeit spendete sie große Summen Geldes und gaben es einem Waisenkind aus der Nachbarschaft. Meine Schwestern Baran und Rehan spendeten ihren gesamten Goldschmuck. Gold besitzt in unserer Kultur einen hohen Wert. Wir alle stimmten in ihre Gebete für Erlösung unseres Volkes von Terror und Tod ein.
Ich aber fand keine Ruhe. Oft lag ich traurig in meinem Bett und wartete auf meine Freunde. Meine Seele blutete, mein Körper schmerzte. Mein verbranntes Gesicht war geschwollen und entstellte mich, der linke Arm fehlte. Die Kinder hatten Angst vor mir und weinten. Dieser Horrorkranke, halb kaputt, mit gruseliger Stimme, wirkte so bemitleidenswürdig furchterregend; auch mir selbst war zum Fürchten. Nur Jassim, mein kleiner Neffe: DER fürchtete sich nicht! Er hatte so sehr geweint und war nun überglücklich, mich wiederzuhaben! Er kam so oft er konnte. „Ich schenke dir meinen Arm und mein Auge!“ Vier Jahre alt war er damals, mein kleiner Held.
Einmal kam Majid, ein Freund aus Kindertagen. Er erzählte mir, wie er meine Familie informiert hatte: Die Ärzte hätten nicht daran geglaubt, dass ich überleben könnte; daher würde mein Leichnam bald nach Hause kommen. Vorher sollte nichts anderes gesprochen werden! „Du hattest Recht“, sagte ich zu Majid. So hätte ich es auch gemacht: Niemandem würde ich irgendetwas von Überlebenschancen sagen, bloß niemandem Hoffnung machen; es war ja sinnlos, wenn nicht einmal die Ärzte selbst daran geglaubt hatten! Die hatten es ja nur versucht, hatten einen Todgeweihten operiert, da gab es nichts zu verlieren.
Noch heute frage ich mich: Was war eigentlich damals in diesen Ärzten vorgegangen? Hatten sie selbst an ein Wunder geglaubt? Wollten sie dem täglichen Elend von T od und Verderben eine Hoffnung entgegensetzen? Operieren war eine Sache, aber Überleben, das war eine ganz andere Sache, und dafür gab es vielleicht fünf, maximal zehn Prozent Hoffnung, so erzählten sie mir später!
Mein Freund Kathan kam nicht zu mir nach Hause. Er wollte mich so, wie ich jetzt war, nicht sehen. Zu schmerzhaft waren seine Erinnerungen, zu groß war sein Mitleid. So fasste ich eines Tages den Entschluss, selbst zu ihm zu gehen. Ich wollte vermeiden, dass auch wir einander noch verlieren würden. Als er die Tür seines Hauses geöffnet hatte, sahen wir uns an, lange und sprachlos. Dann liefen die Tränen … erst nach und nach konnten wir reden. „Wie kann das sein? Das ist wie eine Auferstehung von den Toten! Dann können ja genauso gut auch meine Vorfahren wiederkommen, obwohl sie doch gestorben sind!“ Ja, das war alles wirklich unvorstellbar. Ich weiß nur so viel: Ich war wie durch ein Wunder gerettet worden, ein Wunder, das gute Menschen vollbracht hatten. Daher habe ich Hoffnung, dass mit solchen, guten Menschen auch der Friede möglich ist, dass es Rettung für alle gibt! Kathan und ich redeten an diesem Abend noch sehr, sehr lange. Dabei begleiteten uns überwältigende Emotionen bis tief in die Nacht. Noch ein paar Mal musste ich ins Lazarett: Operationen wurden durchgeführt, Hauttransplantationen waren erforderlich, Fäden wurden gezogen. Jedes Mal war dies alles ein Risiko auf Leben und Tod, denn das musste vor den Irakern verborgen bleiben. Keine Autokennzeichen, keine Terminabsprachen oder Personenerkennung durften bekannt werden. Alle erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wir, um unerkannt zu bleiben. Alles ging gut, mein Körper konnte heilen, meine Wunden konnten sich schließen.
Mein Herz aber, meine Seele – hier klaffte ein riesiges Loch und ich ahnte, dass das Leid noch viel größer war, als gedacht. Wo waren meine Freunde? Wo waren all die Männer, mit denen ich aufgewachsen war, mit denen ich die Heimat verteidigen wollte? Die Antwort war immer dieselbe: Sie haben Arbeit, aber sie werden bald kommen. Bald? Wann? Da verlangte ich schließlich nach den Müttern, den Schwestern, den Frauen und Schwägerinnen. Schließlich kamen sie, bunt angezogen, extra für mich! Die Farbe der Trauer sollte draußen bleiben. Dies wiederholte sich eine Weile, bis mein kleiner Neffe Jassim zu mir kam, ganz nah, mir tief in die Augen sehend, schweigend. Tiefer Ausdruck von Trauer stand in seinen dunklen Kinderaugen. Ich verstand ohne Worte. Dann küsste er mich: „Wir haben dich wieder – das reicht mir“.
Niemand hatte gewusst, wann und wie sie es mir hätten sagen sollen: Die Leichen meiner Freunde und Cousins waren längst nach Hause gebracht, betrauert und begraben worden. Es gab nichts, was ich noch tun konnte. Da breitete sich große Leere in mir aus. Meine Seele schwamm in einem dunklen Ozean voller Schmerz. Meine Mutter sah mich an, auch in ihrem Blick lagen Finsternis und Trauer. „Kinder sprechen die Wahrheit. Wir wussten, dass du es eines Tages erfahren musst.“ Elf junge Männer aus dem Dorf waren Opfer des Terrors geworden: meine drei Freunde, der einzige Sohn meiner Tante und viele weitere Männer. Tagen wie diesen, an denen mich Trauer und Verzweiflung besonders quälten, folgten Nächte mit Träumen, die an bessere Zeiten erinnerten: Wir Jungs durchstreifen die Straße im Dorf, rauchen Shisha, Wasserpfeife. Ach, und die Schafe! Mein Esel ist auch dabei. Ganz früh morgens gehen wir los auf den Berg, bevor die Hitze kommt. Wenn ich zu müde bin und faul im Bett bleibe, dann weckt Mama mich. Die Schafe müssen fressen, es ist Deckzeit, Mai bis August; manche Schafe werden sogar zwei Mal gedeckt. Also gut, dann gehe ich und mache auf dem Berg noch ein Nickerchen. Aber wenn ein Schaf verloren geht, bin ich hell wach! Ich finde es am selben Tag wieder. Manchmal ziehen sie in die Weizenfelder und fressen sich dort so richtig voll. Das ist eigentlich verboten, aber uns erwischt man nicht. In manchen Jahren behalten wir bis zu sieben Lämmer für uns für große Feste: Charshema Sere Sale (*) oder Ida Ezi (*). Da werden zwei Schafe extra gemästet. Alle Nachbarn kommen, das ist Tradition. Es gibt auch Trüffel, ich kenne die besten Stellen und sammle sie wirklich gerne; das ist ein Festessen für alle!
Nach einer Weile erzählte mein Freund Majid mir, wie sich die Tage nach der Explosion aus seiner Sicht ereignet hatten. Er hatte mich bei den Leuten liegen sehen, die in einen Leichensack gesteckt wurden. „Legen sie den da auch in einen Sack!“ Das habe ein irakischer Arzt am Anschlagsort gesagt und dabei auf mich gezeigt. Da sei Majid ganz krank vor Mitleid geworden. Er habe weinen müssen und habe meinen Körper in einem Meer voll Tränen in einen Sack gelegt. Die Säcke seien einer nach dem anderen in die Kühlkammer getragen worden. Es habe die ganze Zeit Grauen und Trauer geherrscht. Etwa siebzig bis achtzig Säcke seien das gewesen, und als zwei oder drei Säcke vor mir an der Reihe gewesen seien, hatten die Männer eine Zigarettenpause gemacht. Das war der Moment, in dem der amerikanische Arzt hinzukam, der Moment, in dem ich zum ersten Mal Rettung und Hilfe bekam.
Wie konnte es eigentlich sein, dass dieser Arzt einen schon geschlossenen Leichensack noch einmal öffnete? Hatte ich mich bewegt? Hatte er etwas gesehen? Wollte er den Tod einfach nicht akzeptieren? Eine Antwort gibt es nicht, dieser Arzt bleibt mir ein Unbekannter. Und doch weiß ich ganz genau, dass er einer von denen ist, die nicht aufgeben, die wie ein Licht in all der Dunkelheit sind, die uns manchmal umgibt. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich noch mehreren solcher ‚Lichter‘ begegnen würde.
Die folgenden Tage und Monate blieben zunächst dunkel, der Alltag schwierig. Immer wieder hörten wir Schüsse. Die Iraker schossen auf Patienten, wenn sie von den amerikanischen Ärzten kamen. Und ich – ich kam wie ein Wunder auch durch diese schwere Zeit. Jeder Nachbehandlungstermin im amerikanischen Lazarett war lebensgefährlich, doch meine Familie beschützte mich, bis die Krankenhauszeit endlich ein Ende fand.