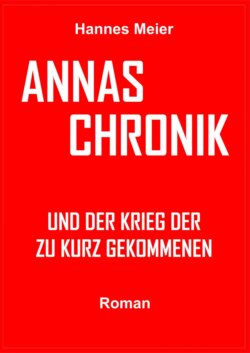Читать книгу Annas Chronik und... - Hannes Meier - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anna findet eine Arbeit und einen Mann – 1917 bis 1940
ОглавлениеKurz nachdem Lenin Zürich verlassen hatte, um in Russland die Revolution auszurufen, wird Anna als erstes Kind der Lehrersfamilie Dobler in der Kleinstadt Huwyler in der Ostschweiz geboren. In einem großen Stadthaus mit mehreren Wohnungen, das Annas Mutter Agathe Dobler, geb. Wick, zusammen mit ihrer Schwester Rosa Wick geerbt hatte. Zwei Jahre später kommt Schwester Magdalena zur Welt. Und noch drei Jahre später stirbt der Vater an einer Niereninsuffizienz, obwohl er eigentlich herzkrank war. Böse Zungen – und davon gibt es einige in Huwyler – behaupten, Alphons habe eine Jugendgeliebte als heimliche Nebenfrau gehabt, was weder seine Frau Agathe noch deren Schwester Rosa mit ihren katholischen Grundsätzen vereinbaren konnten. Genaueres weiß man aber nicht. Wie auch immer – nach dem Tod des jungen Gatten steht Agathe mit ihren zwei kleinen Kindern praktisch unversorgt da, weil man den jungen Lehrer wegen seiner Herzschwäche von den staatlichen Pensionen ausgeschlossen hatte. Großzügiger Weise bieten die Huwyler Schulbehörden der Witwe „vorläufig und bis die Stelle wieder ordentlich besetzt werden kann“ den Job ihres verstorbenen Mannes an, wenn auch nur zu 60 Prozent der Bezüge. Agathe kehrt also in ihren angestammten Beruf zurück und führt mit eisernem Regiment Grundschulklassen mit über 50 Kindern zum großen Einmaleins – daneben versorgt sie den Haushalt und ihre eigenen Kinder. Sie hatte es als eine der ersten Frauen in der Schweiz ins Lehrerseminar geschafft, war schon immer eine Kämpferin gewesen. Jetzt aber wird sie beinhart.
Ihre Schwester Rosa bestreitet ein sparsames Auskommen mit den zwei vermieteten Wohnungen im Haus und hilft Agathe gelegentlich im Haushalt. Wenn sie mag. Sie ist eigenwillig, aus Prinzip unverheiratet. Bis ins hohe Alter legt sie Wert darauf, Jungfrau zu sein und mit Fräulein angesprochen zu werden. Mit Kindern, gar mit kleinen, hat sie nichts am Hut. Nach dem frühen Abgang des Alphonse Dobler führt man im Stadthaus eine manchmal zänkische Weiberwirtschaft (damals war das Wort noch politisch korrekt), die neben streng-religiösen auch ausgeprägt sexual- und männerfeindliche Züge trägt, was sich bekanntermaßen nicht widerspricht. Es wird viel gebetet und gebüßt und auch geringe Verfehlungen und Unzulänglichkeiten der Kinder werden streng bestraft. Von Anfang an wird Anna zur Hausarbeit eingespannt. Im Gegensatz zur jüngeren Schwester, die nach Mutter Agathes Willen einmal Lehrerin werden soll. Trotz aller Bemühungen schafft Anna es kaum, den Anforderungen der harten Mutter und der ewig keifenden Tante zu genügen. Geplagt von Schuldgefühlen und einer chronischen Bronchitis, steht Anna von Anfang an auf der Schattenseite des Lebens. In ihrer Not nimmt sie Zuflucht zur heiligen Gottesmutter, die am Seitenaltar der Pfarrkirche über rußenden Bittstellerkerzen ein entrücktes Dasein führt. „Maria hilft – 1 Kerze = 5 Rappen“ steht über dem Schlitz im Sockel, wo Anna manches Fünferli versenkt und auf der harten Holzbank kniend versucht, Trost zu finden. Zum Beispiel im Gedanken, wie klein ihr eigenes Leid doch im Vergleich zu dem der heiligen Schmerzensmutter ist. So hat es jedenfalls der junge Kaplan Kägi gesehen, der später Stadtpfarrer wird und bei dem sie jede Woche zum Beichten geht. Am Samstagmorgen, schulklassenweise, wie das damals so war. Nach der Sekundarschule wird Anna ins „Welschland“ geschickt, in ein vornehmes katholisches Mädchenpensionat bei Lausanne. Nicht um eine höhere Bildung zu erlangen, wie die andern Mädchen in dem altehrwürdigen Institut, sondern als Haushaltslehrtochter. Also eine, die den gehobenen Töchtern den Dreck wegmacht. Ihr Schicksal teilt sie mit fünf einfachen Bauernmädchen. Dabei wäre Anna nicht dümmer gewesen als jene, die hier Matura machen. Aber ein studiertes Kind reicht. Und das ist, wie gesagt, Magdalena. Nach den „Welschland Jähren“ findet Anna in einer Bischofsstadt in der Zentralschweiz eine schlechtbezahlte Stellung als Haushälterin beim verwitweten Verleger Schmalzer. Schmalzer gibt neben den vielen erbaulichen Broschüren, die in den Ständern jeder katholischen Kirche zu finden sind, auch das Bistumsblatt heraus. Annas Entscheidung bekommt ausnahmsweise ungeschmälerten Beifall von Mutter und Tante. Doch es dauert nicht lange, bis Schmalzer im Nachthemd in ihre Mansarde eindringt und über heftige Beschwerden klagt. Da selbst für die naive Anna die Art der Beschwerde unterm Hemd deutlich auszumachen ist, ergreift sie die Flucht auf den Dachboden, wohin ihr der beleibte Patron nicht zu folgen vermag. Danach entwickelt sich das Arbeitsverhältnis zu einem zähen Spießrutenlaufen mit lüsternen Blicken, zweideutigen Bemerkungen und zufälligen Berührungen. In ihrer Not sucht sie wieder geistlichen Beistand bei einem Beichtvater. Diesmal ist es Prälat Zumsteg, der dem Verleger Schmalzer durch die redaktionelle Gestaltung des Bistumsblattes verbunden ist. Zumsteg sieht teuflische Mächte am Werk, Hochmut und die sündigen Verlockungen des Weibes, die seit Evas Zeiten immer wieder Schuld und Verdammnis über die Welt bringen. Er ermahnt Anna, diese Hauptsünde zu meiden, sich in Demut zu üben und die Kammertür zu versperren (was sie seit jener Nacht sowieso tut). Zur Vergebung der Sünden gibt er ihr eine Busse von drei schmerzhaften Rosenkränzen und einer Wallfahrt nach Maria Einsiedeln.
***
Wie ein brummender Hummelschwarm zieht der Pulk der betenden Pilger über den Klosterplatz, vorbei an den Ständen der Devotionalienhändler zum Haupttor des Doms, dessen meterhohe Flügel von zwei Benediktinerbrüdern eilig für die Wallfahrer geöffnet werden. Tief im düsteren Innern der riesigen Barockkirche flackern hunderte von Kerzen: die Gnadenkapelle mit der schwarzen Jungfrau. Als die Schar vor dem Altar zum Stehen kommt und das Lied „Meerstern ich dich grüße, oh Maria hilf…“ anstimmt, gilt Annas Aufmerksamkeit einem jungen Mann, der eine Fahne mit der Aufschrift „Kath. Turnverein Huwyler“ hochhält. Johann Weber ist ein schlanker, trotzdem athletischer junger Mann, groß, braunes Haar, das ihm öfter in die Stirne fällt, lachende Augen, die Schalk verraten. Kurz – ein attraktiver Bursche. Dass er etwas gelangweilt wirkt inmitten der frommen Verzückung schmälert den positiven Eindruck Annas nicht. Sein Blick trifft sich mit ihrem, er grinst und hebt verstohlen die Hand zum Gruß. Anna lächelt, doch ein strenger Blick ihrer Mutter lässt sie schnell den Kopf senken und wieder in den Pilgerchor einstimmen.
Nach dem Ende des Liedes herrscht ein paar Sekunden Stille. Dann erhebt sich in der Tiefe des Doms ein gregorianischer Choral. Eine schwarze Kolonne wallt vom Hochaltar Richtung Gnadenkapelle. In Zweierreihen, vorn die Knaben des Klosterinternats, dann die Brüder, hinten die Mönche, alle in schwarzen Soutanen mit gesenkten, in den Kapuzen versteckten Häuptern, die Arme in weiten Ärmeln vor der Brust verschränkt, eine Welle im wogenden Gleichschritt. 16-stimmig hallt das Ave-Maria durch das Gewölbe des riesigen Schiffes, als kämen die Stimmen aus einer anderen, mystischen Welt: „Ave Maria, gratia plenum…“. Kalte und heiße Schauer des Entzückens jagen über Annas Rücken, so innig, dass sie in die Knie sinken möchte und nur noch weinen. Auch Johann ist ergriffen von der Macht und der Herrlichkeit der Kirche, die sonst wirklich nicht so sein Ding ist und senkt die Fahne des katholischen Turnvereins bis zum Boden.
Später, als Anna mit Mutter, Schwester Magdalena und Tante Rose bei Tee und marzipangefüllten Schafböcken im Café Pilgereinkehr sitzt, fällt ihr plötzlich ein, dass sie noch ein Votivbildchen vom seligen Bruder Meinrad mitnehmen wollte. Wie erwartet findet sie die Turner in der Klosterschänke, wo sie sich bei einer Stange Hell von den Strapazen des Wallfahrens erholen. Johann, diesmal ohne Fahne, dafür mit einem Glimmstängel lässig im Mundwinkel, will austreten und stößt fast mit Anna zusammen. „Anna!“ „Johann du!“ haucht Anna „So ein Zufall…“ Er, wieder ganz Herr der Lage, grinst und meint, es handle sich wohl eher um eine Fügung der Gnadenmutter! Da sie kein Bier mag, lädt er sie zu einem Glas Milch ein. Lachend erinnert man sich der gemeinsamen Schulzeit. Der schmächtige Johann hatte sich einen Spaß daraus gemacht, sie an ihren dicken Zöpfen zu ziehen, den Knoten ihrer braven Schürze zu öffnen oder sie mit blöden Sprüchen zu ärgern. Wohlgefällig mustert er seine ehemalige Schulkameradin. Trotz der bescheidenen Pilgerkluft mit groben Bergschuhen, weitem Rock und steifer Bluse, gefällt ihm ihr offenes, liebes Gesicht mit den großen blauen Augen und das volle blonde Haar, das jetzt allerdings zu einem strengen Knoten geknüpft ist. Hübsch, noch etwas scheu, aber, wenn man ihr bei Garderobe und Frisur ein bisschen auf die Sprünge hilft, wäre sie ein rassiges Mädchen, lautet insgeheim sein Urteil. Im lockeren Plauderton erzählt er ihr, dass er im Turnverein Leichtathletik treibt (sogar in der kantonalen Auswahl) und alle ihn Johnny nennen. Noch arbeitet er als kaufmännischer Angestellter bei der „Schweizerischen Seifen AG“ in Zürich, aber er ist – wie er als Turner sagt – „im vollen Aufschwung zum Sessel des Chefbuchhalters“. Im Gegensatz zu früher hat er jetzt offenbar ein paar Sprüche drauf, die sogar die schüchterne Anna zum Lachen bringen. Also lacht Anna, und Johnny lacht mit, und Johnny gefällt Anna, und Anna gefällt Johnny. „Vom hässlichen Entchen zum hübschen Schwan! Du hast dich aber gemacht“, grinst er frech. Anna wird rot und weist die Anmache zurück, wie es sich für ein katholisches Mädchen gehört. Diesmal wollen sie sich aber etwas besser im Auge behalten, sagt Anna zum Abschied keck, wie es sonst gar nicht ihre Art ist und wird dabei nur ein bisschen rot.
Als sie nach über einer Stunde ins Café zurückkehrt, herrscht Unmut in der Damenrunde, die unbedingt den Fünf-Uhr-Zug nach Huwyler erreichen will. Der Unmut verstärkt sich, als Anna auf dem Weg zum Bahnhof zum eigentlichen Grund ihrer Verspätung kommt. Magdalena findet zwar, dass der Weber Junior ein „flottes Bürschlein“ sei, doch Mama gibt ihr einen strafenden Blick über ihre Nickelbrille hinweg und auch bei Tante Rosa findet Annas Begegnung gar keine Gnade. Zu wenig Gottesfurcht und Demut, ein Angeber, lautet das vernichtende Urteil. Er komme ganz nach seinem Vater! Mehr wird nicht gesagt, es bleibt bei vielsagenden Blicken zwischen Mama und Tante. Doch Anna erinnert sich schwach an den Tratsch in der Kleinstadt: „Tätschliweber“ – so wird Johnnys Vater genannt, weil er sich angeblich bei den hübscheren Serviererinnen mit gutem Trinkgeld und aufmunternden Klapsen hervortut. Annas Einspruch, das sei doch nur Geschwätz und wenn, was könne der Sohn dafür, wird von Tante Rosa zurückgewiesen: Davon, dass der Weber eine „Reformierte“ geheiratet habe, und was dann aus so einem Kind werde, wolle sie erst gar nicht anfangen. Nein, Anna solle sich vor Menschen wie den Webers hüten und lieber ihre Pflichten bei Verleger Schmalzer im Auge behalten. Mutter und Magdalena nicken. Dazu hätte Anna nun einiges sagen können. Aber sie schweigt, vergräbt es in ihrem Herzen. Betet im lärmenden Abteil des überfüllten Pilgerzuges ein Ave-Maria zur Heiligen Jungfrau, dass das Katz- und Mausspiel mit dem dicken Patron endlich ein Ende finde.
***
Am nächsten Tag – es ist ein Montag und ihr letzter Urlaubstag in Huwyler – treibt sie sich am Abend wie zufällig auf dem Bahnhofvorplatz herum (ihrer Mutter hat sie gesagt, sie wolle eine ehemalige Klassenkameradin treffen) und passt zwei Pendler-Züge aus Zürich ab. Aus dem 18:20-Uhr-Zug steigt er dann auch aus, ihr Johnny. Bella Figura, Anzug und Schlips, aber leider in Begleitung eines anderen, mit dem er sich so angeregt unterhält, dass er sie übersieht und sie sich nicht traut, ihn anzusprechen. Sie geht im Strom der Pendler hinter ihm her, bewundert seinen sportlichen Schritt, bis die beiden in einer Seitenstraße verschwinden.
Es ist eine harte Rückkehr in Schmalzers Villa. Die ersten Blätter fallen und ein Sonnenstrahl bricht zwischen den grauen Wolken hervor, um sofort wieder zu verschwinden, als das schwere Gartentor hinter ihr ins Schloss fällt. Ihr kommt es wie ein schlechtes Zeichen vor. Kaum im Haus, ruft Schmalzer sie in sein Büro. Offenbar hat er auf sie gewartet, die Tür ist weit offen. Sie bleibt im Rahmen stehen und sagt „Bitte?“. Schmalzer mustert sie unverhohlen von oben bis unten. Sie wird rot und er grinst. Die Ferien hätten ihr wohl gutgetan, sie habe Farbe bekommen! Er steht auf und kommt um den Schreibtisch herum. Anna weicht zurück. Er versucht sie am Arm zu fassen. „Was ist los Anna? Ich will dich doch nur begrüßen!“ Sie befreit sich. „Also – Grüezi!“, sagt sie, packt schnell ihren kleinen Koffer und verschwindet.
Am Abend, in ihrer Mansarde, beschließt Anna ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und schreibt einen Brief.
15. September 1940
Lieber Johnny!
Du erlaubst doch, dass ich Dich so anrede, denn der alte Johann, der mich immer geneckt hat in der Schule, ist gewiss nicht der, dem ich als „Fügung der Gnadenmutter“ (wie Du es so schön formuliert hast) begegnet bin. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut. Warum ich Dir schreibe, ist das Votivbild des seligen Bruder Meinrads, das ich Dir als Erinnerung beilege. „Es geht alles vorbei, nur die Ewigkeit nicht“ hat er gesagt. Schön, Johnny, gell, und so tief! Vielleicht laufen wir uns wieder einmal über den Weg. Gestern habe ich Dich von weitem am Bahnhof gesehen. Aber Du warst mit einem anderen beschäftigt und so habe ich mich nicht getraut. Vielleicht ein andermal – spätestens bei der nächsten Wallfahrt.
liebe Grüße Anna.“
Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten und schon zwei Wochen später trifft man sich zum ersten Tête-à-Tête am Huwyler Weiher, der zu dieser Jahreszeit höchstens von ein paar lustlos gründelnden Enten belebt wird. Kalt ist es den beiden auf der Parkbank aber nicht. Den Kopf neben seiner starken Schulter durchströmt ein nie gekanntes heißes Prickeln ihren Bauch. Er berichtet vom Kantonalen Turnfest (es ist zwar schon ein paar Wochen her), wo er am Barren Sechster wurde und sich am Reck bestimmt noch weiter vorn platziert hätte, wenn man ihm nicht seinen sensationellen Doppelsalto wegen eines falschen Griffs aberkannt hätte! Anna sieht Johnny vor ihrem geistigen Auge, wie einen Engel, in strammer weißer Keilhose, schwerelos durch die Lüfte schweben. Sie verspricht, am Sonntagnachmittag zum Training zu kommen. Hand in Hand geht es dann vorbei an Enten um den kleinen See zurück – ab der Stadtgrenze ohne Händchenhalten. Zum Abschied, in der dunklen, menschenleeren Apotheken-Passage, haucht er ihr einen Kuss auf die Wange, was Annas Herzschlag verdoppelt und später zu Mamas Frage führen wird, woher sie die roten Backen habe? Von der Kälte natürlich. Noch ahnen weder Mutter noch Magdalena noch Tante Rosa, was sich nach all den männerlosen Jahren hinter ihrem Rücken zusammenbraut. Am nächsten Tag – es ist Sonntag – trifft sich Anna mit Johnny im Hochamt. Besser gesagt, man trifft sich auf Distanz. Denn in der Pfarrkirche gilt strikte Geschlechtertrennung. Links die Mädchen und Frauen, rechts die Knaben und Männer, dazwischen der Mittelgang. Vorne überspannt ein Wandgemälde das Schiff. Es zeigt das Jüngste Gericht. In der Mitte thront ein zürnender Gott, flankiert von zwei Engeln mit Flammenschwertern. Auf seiner rechten Seite versammeln sich die Frommen auf ihrem Weg ins rosa leuchtende Paradies, zur Linken zerren Teufel und Dämonen schreiende Halbnackte hinab in Finsternis und lodernde Flammen. Schon als Kind hat diese Szene tiefen Eindruck auf Anna gemacht. Und schon damals ahnte sie, dass Sünde und ewige Verdammnis etwas mit Entblößung zu tun haben müssen. Heute aber steht Anna der Sinn nicht nach Höllenqualen. Mit Inbrunst und wie aus der Pistole geschossen kommen ihre lateinischen Antworten auf den psalmodierenden Singsang von Pfarrer Kägi am Hochaltar: „Dominus vobiscum“. „Et cum spiritu tuo“. Es herrscht eine feierlich gehobene Stimmung, wallender Weihrauch und brausende Orgelklänge verschaffen Anna in ein euphorisches Glücksgefühl. Hin und wieder wirft sie einen Blick auf die dumpf mitbrummelnde Männerseite, der von Johann forsch lächelnd erwidert wird (an diesem geweihten Ort scheint ihr „Johnny“ irgendwie unpassend). Was Magdalena nicht entgeht, die neben Anna kniet. Als es nach der Messe zu einem scheinbar harmlosen Schwatz zwischen den beiden kommt, ist ihr die Sache klar. Beim Mittagessen – Tante Rosa hat Hackbraten mit Nüdeli gemacht – lässt sie die Bombe platzen. Warum der Weber Junior jetzt ins Hochamt gehe? Sonst sehe man die Webers doch höchstens in der Elf-Uhr-Messe. Wenn überhaupt. Anna wird puterrot und Mama bitterböse. Ob sie sich letzthin nicht deutlich genug ausgedrückt habe? Oder ob das Wort einer Mutter gar nichts mehr gelte? Anna verteidigt sich nicht sehr überzeugend mit dem Argument, man werde sich nach der Messe ja wohl noch mit einem ehemaligen Schulkameraden unterhalten dürfen. Magdalena setzt noch einen drauf. Sie habe ganz genau gesehen, wie sich die beiden beim Hochamt zugezwinkert hätten! Zugezwinkert! Während der HEILIGEN Messe! Das bringt Tante Rosa so in Rage, dass sie Anna eine Ohrfeige gibt und Mama sie schrill von der Tafel weist. Schluchzend verschwindet Anna in ihrem Zimmer, das sie mit Magdalena teilt. Diese kommt dann auch prompt nach dem Essen, um ihr mitzuteilen, dass sie für heute Zimmerarrest habe. Später erscheint dann Mama, um zu beten. Anna muss sich vor dem Kreuz niederknien und den Herrn um Verzeihung für ihre gotteslästerliche Tat bitten. Zur Buße gibt es dann noch einen schmerzhaften Rosenkranz und von Tante Rosa einen Korb voll Wäsche zum Bügeln. Und Johnny wartet vergeblich in der Turnhalle. Dafür bekommt er dann zwei Tage später einen Brief.
„…Gell, du bist mir nicht bös, Johnny, aber es gab noch so viel im Haushalt zu tun, dass ich mich unmöglich davonstehlen konnte…Umso mehr war ich in Gedanken bei dir und deinem Training.“
Nach einer weiteren Durststrecke von drei Wochen – so lange dauert es, bis Verleger Schmalzer seiner Haushälterin wieder einmal ein freies Wochenende gönnt – ist Anna gewiefter. Sie treffen sich nicht unter den Augen der halben Kleinstadt im „Hochamt“, sondern diskret nach der samstäglichen Beichte. Und da es ein wunderschöner Herbsttag ist, fahren sie mit den Fahrrädern hinaus aufs herbstliche Land. An einem Waldrand legen sie sich in die dünne Sonne. Galant hat Johnny seine Jacke für Anna als Unterlage ausgebreitet. Erst reden und lachen sie, dann küssen sie sich und können nicht mehr aufhören. Es ist schon dunkel, als Anna wie in Trance ins „Stadthaus“ zurückkommt und in einem Anfall von Verwegenheit verkündet, dass Johann Weber und sie sich prüfen wollen im Hinblick auf das heilige Sakrament der Ehe. Mama wird stumm vor Schreck und Tante Rosa knurrt: „So etwas wie ein Mann kommt mir nie ins Haus!“ Aber wirkliche Argumente gegen ein Kennenlernen „im Geiste der Kirche“ fallen beiden nicht ein. So beschränkt sich die Mutter darauf, die Begegnungen mit diesem Herrn Weber vorauseilend zu reglementieren: „Nicht mehr als einmal im Monat!“ „Wie soll man sich prüfen, wenn man sich überhaupt nicht sehen darf!“ „Deine Schwester kann euch begleiten!“ „Die ärgert uns nur!“ „Er kann ja zu uns kommen und ihr könnt hier Mühle spielen!“ „Wir möchten aber nicht nur Mühle spielen!“ „Aha! Genau das habe ich befürchtet!“ Unwirsch unterbricht Tante Rosa und bringt die Sache auf den Punkt: „Männer bringen Unglück. Immer. Schlag ihn dir aus dem Kopf“ „Ich will aber mal Kinder haben und nicht als alte Jungfer enden!“, schreit Anna und fängt von der Mutter eine Ohrfeige. „Auf solche Saugofen wie dich, kann ich schon lange verzichten!“ ergänzt Rosa wütend. Mutter befiehlt Anna scharf, sich bei Rosa zu entschuldigen. Jungfräulichkeit sei mindestens so erstrebenswert wie eine noch so christliche Ehe! Da dämmert es Anna, in welchen Fettnapf sie gerade getreten ist. Mit 16 soll Tante Rosa nämlich einem Jungpriester aus der entfernteren Verwandtschaft als „geistiges Bräutchen“ zugewidmet worden sein. Ob sie sich dabei ganz irdisch in den jungen Mann verliebt hat? Ob sie von ihm enttäuscht worden ist? Oder ist Rosas Männerfeindlichkeit einfach ein Schutzwall, den sie um ihr damaliges Keuschheitsgelübde gezogen hat? Was immer die Klatschmäuler in Umlauf brachten, Tante Rosa hüllte sich in Schweigen, bis man sie schließlich so akzeptierte, wie sie ist. Was den Herrn Weber Junior anlangt endet der Abend mit einem Waffenstillstand. Auf jeden Fall habe er sich bei ihnen vorzustellen, erklärt die Mutter, bevor über alles Weitere diskutiert werden kann.
Schon am darauffolgenden Sonntag kommt Johnny zu Kaffee und Kuchen ins „Stadthaus“. Korrekt wie immer mit Schlips und Anzug und einem Strauß Blumen für die Mutter und Konfekt für Tante Rosa. Diese lässt sich entschuldigen, genauer gesagt: sie bleibt einfach weg, und Mutter Agathe entschuldigt sie mit einer erfundenen Migräne. Johnny gibt sich charmant und das bleibt – sehr zu Annas Erleichterung – nicht ohne Eindruck. Man redet übers Wetter und andere unverfängliche Themen, bis Agathe Dobler den Scheinfrieden mit der Bemerkung beendet, dass ihre Tochter noch lange nicht reif sei für eine christliche Ehe. Anna wird rot und ruft beschwörend „Mama!“, und Magdalena kichert so sehr, dass sie sich verschluckt. Johnny fasst sich nach kurzer Verblüffung: „Verehrte Frau Dobler, von einer Heirat zwischen Anna und mir kann doch gar keine Rede sein. Wir haben es nett gefunden, dass wir uns nach Jahren wieder getroffen haben und wollen in Kontakt zu bleiben.“ Das ist nun auch nicht das, was Agathe Dobler hören will. Dann haben Sie also keinerlei ernsthafte Absichten?“, fragt sie scharf, und Anna wäre am liebsten unter den Tisch gekrochen. Johnny rudert schnell ein Stück zurück. Das wollte er damit nicht sagen, aber erst einmal müsse man sich doch näher kennenlernen. Und darum sei er auch hier, um Annas Mutter um Vertrauen zu bitten. Er wolle ihr hiermit versichern, dass Anna, wie übrigens alle Damen, von ihm immer nur mit der größten Hochachtung behandelt werde. Die Rede verfehlt auch diesmal ihre Wirkung nicht, aber Frau Dobler ist noch nicht am Ende ihrer Befürchtungen. Wie er es denn mit der heiligen Kirche halte, fragt sie, Anna komme nämlich aus einem gottesfürchtigen Elternhaus. Da kann Johnny nur nicken. Auch er sei im Glauben aufgewachsen und könne sich nichts Anderes vorstellen. Mit einem ernsten Blick in Annas Augen gibt er seiner Aussage das nötige Gewicht, so dass Anna ihm spontan beispringt: am letzten Sonntag sei er sogar zweimal in der Kirche gewesen. Sie erwähnt natürlich nicht, warum. Er hatte gemeint, sie gehe ins Hochamt, und sie nahm an, er besuche die Elf- Uhr-Messe, wo sie sich schließlich auch gefunden hatten. Beim Abschied versucht Johnny, Frau Dobler die Hand zu küssen, was aber nicht so gut ankommt. Immerhin wird ihm der Umgang mit Anna nicht verboten. Aber oberstes Gebot bleibt die mütterliche Kontrolle. Was Tante Rosa später als einen „faulen Kompromiss“ bezeichnet.
Johnny, obwohl schon 23 und als kaufmännischer Angestellter gut im Brot, wohnt immer noch im Haus seiner Eltern. In seinem alten Kinderzimmer steht jetzt zwar auf dem Schülerschreibtisch eine nagelneue Hermes-Schreibmaschine (mit umschaltbarem Farbband schwarz/rot!). Über dem Bett hängt ein Bild mit Höhlenbewohnern, die ein Mammut jagen und ein Plakat vom „Eidgenössischen Turnerfest 1938 in Thun“, auf dem ein eleganter Turner in eleganten Keilhosen über dem Reck schwebt. Die geliebte Armbrust, mit der Johann früher auf Spatzen schoss, ist verschwunden. Dafür lehnt seit der Rekrutenschule ein Schweizer Armee-Karabiner neben dem Schrank. In der Schublade ist eine Armeepistole mit hundert Schuss Munition. Sonst hat sich nicht viel verändert, außer, dass sich zu den Büchern von Karl May und der ´Via Mala´ von John Knittel auf dem schmalen Bücherbrett über dem Bett ein prächtiger Bildfoliant über die Olympischen Spiele 1936 in Berlin dazu gesellt hat. Johnny war damals begeistert von Hitlers „Fest der Völker“ und berauschte sich an Leni Riefenstahls Fotos der Athleten im Gegenlicht, den flatternden Hakenkreuzfahnen, dem Fackellauf entlang der himmelstrebenden Olympia-Bauten und auch an dem 60.000 Arme reckenden Hitlerjungen und SA-Leuten, dem Portrait mit dem herrischen Blick auf der letzten Seite: „Und über allem steht der Führer“. Bis zum Überfall auf Polen bewunderte und beneidet Johnny also die Deutschen, dachte, ein Stück von ihrer zackigen Großspurigkeit könnte sich die biedere Schweiz durchaus abschneiden. Damit stand er nicht alleine. Sogar Bundesräte liebäugelten mit einem Anschluss à la Österreich, es gab eine schweizerische NSDAP, deren Führer Gustloff allerdings schon 1936 von einem jüdischen Studenten in Davos erschossen worden war. Jetzt, 1940, hat sich die Situation gründlich geändert. Es ist Krieg. Die neutrale Schweiz ist umzingelt von den Achsenmächten, ein Land nach dem andern ist von Hitler überrannt worden. Man fürchtet täglich den Einmarsch. Seit 1940 herrscht Notstand, die Armee hat die Generalmobilmachung befohlen und ist entschlossen, die Heimat militärisch zu verteidigen. Um die Wirtschaft des Landes nicht lahm zu legen, werden abwechselnd Teile der wehrfähigen Männer an den Grenzen und in der Alpenfestung in den Bergen stationiert. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Johnny einrücken muss. Kriegsverdunkelung ist auch in der Schweiz angeordnet. Auf Druck von Hitler und Mussolini, damit die alliierten Bomber sich schlechter orientieren können. Mit der Folge, dass es immer wieder zu „irrtümlichen“ Bombardierungen von Schweizer Städten kommt. Doch Johnny und Anna haben nichts gegen die Verdunkelung. Sie entzieht ihre Zärtlichkeiten dem Blick der neugierigen Kleinstadtbürger, wenn Johnny sie am Sonntagabend zum Bahnhof bringt.
Dass Johnny mit 23 immer noch gerne zu Hause wohnt, liegt auch an Gret Weber, seiner Mutter, einer gutmütigen, korpulenten Frau, etwas phlegmatisch und gern am Jammern. Sie verwöhnt ihr einziges Küken nach Strich und Faden, auch wenn es inzwischen ein prächtiger Hahn geworden ist. Sie wäscht und bügelt seine Wäsche und zaubert ihm und seinem Vater in normalen Zeiten Köstlichkeiten auf den Tisch, die auch der gehobenen Küche zur Ehre gereicht hätten. Jetzt aber ist Krieg und auch in der Schweiz herrscht Mangel. Natürlich ist die Not der Bevölkerung nicht so groß wie in den kriegsführenden Ländern, aber durch das Embargo der Achsenmächte fehlen plötzlich Lebensmittel, die vorher aus dem Ausland importiert wurden. 1940 ruft die Regierung zur „Anbauschlacht“ auf. Jeder Quadratmeter, ob Garten, Park oder Sportplatz, soll mit Getreide, Kartoffeln und Obst bepflanzt werden. So muss die Schweiz, als einziges Land in Europa zwischen 1940 und 1945 nie Gemüse, Kartoffeln und Obst rationieren. Auch bei den Webers kommt jetzt viel Selbstgezogenes auf den Tisch. Johnny lässt es sich unter den Fittichen seiner Mama gut gehen, zahlt keine Miete, steckt höchstens ab und zu einen Zehner in ihre Haushaltskasse und sieht keinen Anlass, sich nach einer eigenen Bleibe umzusehen. Mutter Gret ist, wie gesagt, eine Reformierte. Vor der kirchlichen Trauung musste sie geloben, ihre Kinder im katholischen Geiste zu erziehen (anders geht es nicht, wenn man im stockkatholischen Huwyler einen Beamten heiraten will). Dieses Versprechen bringt aber weder sie noch Johnnys Vater August um den gesunden Schlaf. Von seinem Wesen her neigt auch August weniger zum Grübeln. Gut gelaunt, eine frischgepflückte Nelke im Knopfloch, gibt er den Lebemann und Genießer und lässt jeden nach eigenem Gusto selig werden. Tagsüber ein korrekter Beamter im Rathaus, am Abend gesellig mit der Brissago im Mundwinkel und einem Viertel Roten vor sich, beim Kartenspiel im „Rössli“. Summa summarum also ein ziemlicher Kontrast zur herben Damenriege im Stadthaus.