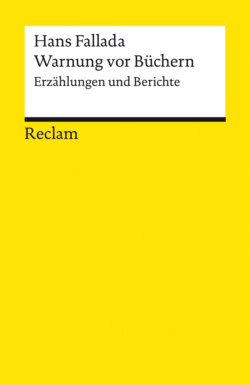Читать книгу Warnung vor Büchern. Erzählungen und Berichte - Ханс Фаллада - Страница 14
[47]Liebe Ordensgeschwister!
ОглавлениеMitte September hielten in Hamburg die Naturforscher eine Tagung ab. Und im Rahmen dieser Veranstaltung zog der Verein abstinenter Ärzte einen Vortragsabend auf, an dem auch unser Großtempler, Professor Dr. Strecker, sprach. Natürlich waren wir Guttempler uns einig darüber, dass wir unsern Großtempler hören müssten. Und so ist denn auch der Besuch dieses Vortragsabends durch die Guttempler ein sehr guter gewesen. Aber dieser Abend sollte ja mehr sein. Er sollte für den Abstinenzgedanken werben und war nicht ohne Vorbedacht in das Hamburger Studentenheim verlegt worden. Die abstinenten Ärzte hatten gehofft, dass die Studentenschaft in großen Scharen kommen würde. Gerade unter den Studenten mit ihrem Verbindungs- und Korpswesen wurzelt ja ein Gutteil unserer deutschen Trinksitten, und man hatte da von der Leitung der Tagung gehofft, werbend und aufklärend wirken zu können.
Leider hat man sich in dieser Hoffnung getäuscht. Die Studentenschaft ist, trotzdem die Vorträge in ihrem eigenen Heim veranstaltet wurden, ferngeblieben. Es scheint so, als ob diese Kreise jede Aufklärung von vorneherein ablehnen. Wenn sich auch gegen früher manches gebessert haben mag, so will die Studentenschaft – die farbentragende wenigstens –, nichts davon wissen, ihre alten Trinksitten, oder richtiger Trinkunsitten, aufzugeben.
Ein Fehlschlag also, aber nicht der erste Fehlschlag: Grade unser Großtempler, Bruder Strecker, erzählte unter dem Thema »Alkohol und Studentenschaft« von einem Mann, der schon früher den Kampf gegen das unsinnige Trinken [48]der Studenten aufgenommen hatte und der ebenfalls nichts erreichte.
Dieser Mann war der erste Rektor der 1811 gegründeten Berliner Universität und war der Philosoph und Vorkämpfer der Deutschen gegen die damalige französische Bedrückung: Johann Gottlieb Fichte.
Als Fichte 1811 in seiner Rektoratsrede den Kampf gegen den Alkohol mit wissenschaftlichen Waffen forderte, hatte er schon bittere Gelegenheit gehabt, die Frage Alkohol in Verbindung mit der Studentenschaft zu studieren.
1794 war Fichte auf Goethes Veranlassung an die Universität Jena berufen worden, dort sah er die Trinkgelage der Studenten, ihre Händel, ihre Mensuren, ihre Schlägereien. Er erkannte, dass dies alles unvereinbar mit den Zielen der Studentenschaft war, der Student sollte einmal, sei es als Gelehrter, als Richter, als Arzt, als Theologe, Führer und Beraten seines Volkes werden, es war ein Unding, dass diese künftigen Führer sich in ihren wichtigsten Entwicklungsjahren systematisch an den übermäßigen Alkoholgenuss gewöhnten. Gewöhnungen, deren Nachwirkungen viele von ihnen in ihrem ganzen Leben spüren würden.
Fichte wandte sich nun mit flammendem Aufruf an die Studentenschaft und er erreichte, dass die begeisterten Musensöhne die Auflösung ihrer Trinkverbände beschlossen.
Nun musste Fichte als Professor über diese wichtige Änderung an seiner Universität Jena seiner vorgesetzten Behörde berichten und deren Billigung und Weisung für seine weiteren Schritte einfordern. Damals, 1794, war Deutschland ja noch viel zerrissener als heute, 12 thüringischen [49]Landesregierungen gemeinsam gehörte die Universität Jena, an 12 Stellen hatte sich Fichte zu wenden, von 12 Stellen hatte er Antwort zu erwarten.
Diese Antworten kamen nicht sehr rasch, blieben teilweise ganz aus. Und unterdes verrauchte das erster Feuer der Begeisterung. Wie es immer bei derartigen Gelegenheiten geschieht, wagten sich nun die Freunde des studentischen Trinkwesens wieder hervor, sie hetzten gegen Fichte, beschuldigten ihn, er wolle nur die akademischen Freiheiten der Studentenschaft beschneiden – die kostbare Freiheit, sich zu besaufen, nämlich –.
Und diese Herren erreichten, dass Demonstrationen gegen Fichte vorgenommen wurden, ihm wurden die Fenster seiner Wohnung eingeworfen, ein nächtlicher Einbruch wurde in diese Wohnung versucht, an deren Folgen später sein erschreckter Schwiegervater stirbt, und schließlich musste Fichte noch 1795 ein Semester lang seine Lehrtätigkeit unterbrechen, bis sich die erregten Gemüter wieder ein wenig beruhigt hatten.
Das war Fichtes erster Angriff gegen den Alkohol, auch sein Angriff 1811 hat keine sichtbareren Erfolge gehabt, und Sie haben gehört, dass auch an jenem Vortragsabend abstinenter Ärzte, von dem ich Ihnen erzähle, der Erfolg gleich Null war. Die Studentenschaft fehlte.
Woran liegt das? Woher kommt es, dass das Interesse der breiten Öffentlichkeit, des Gebildeten wie des Einfachen, so unendlich schwer auf diese Dinge zu lenken ist? Woher kommt es, dass man immer wieder schlankweg ablehnt, uns auch nur anzuhören?
Vielleicht ist die Antwort richtig, die ein anderer Redner jenes Abends, Professor Dr. Delbrück, der ehemalige Leiter [50]der Bremer Irrenanstalten, auf diese Frage gab. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Professor Delbrück ist ein alter Mitkämpfer unsers Ordens. Mit feinem Humor erzählte er, wie allmählich Schritt für Schritt der Gedanke der völligen Enthaltsamkeit vom Alkohol an Boden gewann. Noch als er in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zum medizinischen Examen paukte, las er in seinen Lehrbüchern, das beste Mittel, dem Volk den Schnapsgenuss abzugewöhnen, sei die Verbreitung des Biertrinkens. Damals gab es auch schon eine Trinkerheilstätte in Deutschland, wie es in ihr aber zuging, kann man daraus ersehen, dass dort auch noch regelmäßige Bierabende für die Insassen veranstaltet wurden.
Auch Professor Forel, unser mutiger Vorkämpfer, war nicht von vorneherein für den Gedanken der Totalabstinenz eingenommen. Delbrück erzählt von einem Erlebnis, das ihn bekehrte.
Forel hatte Ende der 80er Jahre in seiner Irrenanstalt einen Alkoholkranken, der seine Anstalt ungeheilt verließ. Später schrieb dieser Patient einen Brief an Forel, in dem er spöttisch mitteilte, dass seine Heilung, die den hochgelehrten Herren Ärzten nicht geglückt sei, einem einfachen Schuster vom blauen Kreuz gelungen wäre, und das einzig wirksame Heilmittel hieße völlige Abstinenz.
Als dann Anfang der 90er Jahre die Engländer ihre Irrenanstalten zum Teil abstinent machten, folgte Forel ihrem Beispiel. Nur zögernd, unter ständigen Kämpfen, schlossen die übrigen Anstalten sich an. Noch heute wird ja in vielen Krankenhäusern den Patienten zur »Stärkung« Kognak oder Wein gegeben, den werdenden und stillenden [51]Müttern Bier. Denn alle diese Getränke enthalten Kalorien und heute wird eben alles, was Kalorien enthält, für nahrhaft angesehen.
Ich darf an dieser Stelle vielleicht einen Augenblick abschweifen und eine kleine Anekdote erzählen, die der dritte Redner jenes Vortragsabends, Dr. Bornstein-Berlin, uns erzählte.
Also: Dr. Bornstein sitzt mit irgendeinem hohen Tier aus einem Ministerium in einer Berliner Gastwirtschaft. Der hohe Herr hat zwei Glas Kognak bestellt und kann ganz und gar nicht begreifen, dass Dr. Bornstein den Kognak verschmäht. »Aber mein lieber Herr Doktor«, sagt er schließlich, »Kognak ist nahrhaft, Kognak hat Kalorien!« – »Jawohl«, antwortet Dr. Bornstein schlagfertig, »und Benzin hat auch Kalorien. Ober, ein Glas Benzin für den Herrn Geheimrat!« –
Ich sprach Ihnen davon, dass nur sehr langsam der Gedanke der Totalabstinenz an Boden gewann. Damals wurden schwere Kämpfe zwischen den sog. Mäßigen und den Total-Abstinenten – vor allem den Guttemplern – ausgefochten. Unser Orden war noch jung in Deutschland und stieß überall auf heftigsten Widerstand.
1905 verschickte Professor Delbrück Fragebogen an sämtliche Irrenanstalten des deutschen Sprachgebietes betr. Abstinenz. Die Hauptfragen lauteten: Bekommen die Patienten noch Alkohol? Bekommen die von der Anstalt beköstigten Ärzte und Pfleger noch Alkohol? Befindet sich in Apotheke und Küche der Anstalten noch Alkohol? Der Berichterstatter fasste das Ergebnis dieser Umfrage optimistisch dahin zusammen, dass die Tendenz auf Abstinenz hinginge.
[52]Die damaligen Hoffnungen haben sich aber nicht erfüllt. Seit 1905 sind keine wesentlichen Fortschritte erzielt worden. Nach Professor Delbrücks Ansicht liegt der Grund vor allem darin, dass die Abstinenzler, die Guttempler, wesentlich duldsamer geworden sind, seitdem sie gewissermaßen offiziell anerkannt wurden. Sie haben an Kampfkraft verloren.
Man darf nicht vergessen, dass unser Orden in seinen ersten Anfängen sehr schwer zu kämpfen hatte. Nicht nur das Alkoholkapital, nein, auch die breite Masse der Bevölkerung, ja, selbst unsere Kampfgenossen, die Mäßigen, übergossen den Orden und jedes Ordensmitglied mit Hohn und Spott. Unsere Ziele galten als verstiegenes, laienhaftes, unwissenschaftliches Idealistentum; wer damals dem Orden beitrat, musste ein ganzer Kerl sein, um dem Spott und Hohn in Familie, Freundeskreis und Arbeitsstätte zu trotzen. Es ist dem Orden unter diesen Verfolgungen nicht schlecht ergangen, es ging ihm ähnlich wie der sozialistischen Partei, die sich, in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgelöst, immer fester zusammenschloss. Die Lauen, die Mitläufer zogen sich ängstlich zurück, die Spreu wurde vom Weizen gesondert, und was übrigblieb, waren aufrechte Männer und Frauen, die kein Hohn und Spott, keine Verfolgung ihren Idealen untreu machen konnte.
Allmählich erkannten die Behörden, die breite Masse, dass der Orden nicht ganz so verstiegen und weltfremd war, wie sie geglaubt hatten. Kein Mensch mit offenen Augen konnte die Erfolge der Guttempler in der Trinkerrettung und Bewahrung übersehen. Die menschenkundige, weltkluge Idee seines Gründers, dem Trinker nicht nur die [53]Last seines Abstinenzgelübdes aufzuerlegen, die allein zu tragen er doch zu schwach wäre, sondern ihm im Familienleben, in der Anteilnahme der Loge einen Ersatz für das abendliche Kneipenleben zu bieten, – diese Idee siegte.
Immer mehr wurde der Orden von Wohlfahrtsorganisationen, von Behörden zur Trinkerrettung herangezogen. Wo eine Frau über ihren Mann, der Woche für Woche seinen Lohn in der Kneipe vertrank, ganz verzweifelt war, fand sich sicher eine Nachbarin, die schon vom Orden gehört hatte und ihn als Retter empfahl. Der Orden wurde groß und kräftig, er war anerkannt, nur noch Dummköpfe spöttelten über seine Arbeit.
Aber in dieser Anerkennung lag jene Gefahr, der dann der Orden auch nicht entgangen ist. Ja, dort, wo ein Familienleben vor dem Ruin stand, wo ein vertrunkener Mensch sich und die Welt verzweifelnd aufgab, dort waren wir gut zur Hilfe. Wir sollten die Wunden heilen, die der Alkohol schlug, sie immer von neuem heilen, aber die Hand, die sie schlug, den Alkohol selbst, sollten wir nicht bekämpfen.
Was würde man wohl zu einem Arzte sagen, der sich nicht darum kümmern wollte, wie eine Krankheit entstanden ist, der sich nur um ihre Heilung bemüht? Ein Typhuskranker kommt zu ihm, er heilt ihn, aber es kümmert ihn nicht, wo die Brutstätte der Typhusbazillen sitzt, er lässt hundert andere erkranken, und begnügt sich mit der Heilung der einzelnen, die den Weg zu ihm finden. Wir würden sagen, das ist ein Pfuscher, das ist ein gewissenloser Arzt, und würden ihn wegjagen.
Ist es unserm Orden nicht ähnlich ergangen? Die dort draußen, die einzelnen, die Brauer, die Gastwirte, die Schnapsfabrikanten, die Wohlfahrtsstelle, alle, alle, jeder [54]einzelne, der draußen herumläuft, sagt: Sei zufrieden, Guttempler, wir schicken dir die Lahmgeschlagenen des Lebens, die Kranken, die Vergehenden, du darfst sie heilen. Mehr nicht. Aber du darfst sie heilen.
Unmerklich ist der Orden immer mehr in die einseitige Arbeit der Trinkerrettung gedrängt worden.
Und so verdienstvoll das ist, was er auf diesem Gebiete geleistet hat und noch leistet, so ist das doch nur ein Teil seiner Arbeit. Wichtiger als die Heilung der Wunden ist es, ihre Entstehung zu verhindern. Grade in den Kreisen der Jugend wird das heute immer stärker empfunden. So mancher Wehrtempler hat mir gesagt: »Wir empfinden es bitter, dass ihr Grundtempler so wenig Zeit für uns habt. Wenn ein Wehrlogenwart gesucht wird, wenn die Stelle der Leiterin einer Jugendloge besetzt werden soll, seid ihr Grundtempler schwer dazu zu bekommen. Ist es aber nicht wichtiger, uns alle vorm Trunke zu bewahren als einen schon Gefallenen zu retten?«
So spricht die Jugend. Und mag diese Einstellung neben manchem zweifellos Berechtigten auch Übertriebenes enthalten, eines ist sicher: Die breite Masse draußen, das Volk, hat kein Interesse mehr für die über die Trinkerrettung herausgehenden Ziele unserer Arbeit. Sie finden, dass wir Guttempler ihnen eigentlich nichts zu sagen haben, sie singen: »Brüderlein trink!«, sie betrinken sich mit Maßen, sind also keine Trinker, und haben darum auch nichts mit uns zu tun. Trotzdem nach dem Kriege eine starke Zunahme der Alkoholkranken zu verzeichnen ist, will das Volk daraus nichts lernen, ja, nicht einmal etwas davon hören.
Wenn also nach Ansicht von Professor Dr. Delbrück die Frage der Abstinenz niemanden praktisch mehr [55]interessiert, so ist dafür eine andere Frage in den Vordergrund gerückt: die für und gegen das Alkoholverbot.
Es erscheint auf den ersten Blick seltsam, dass nicht wir Abstinenten es sind, die diese Frage zum Gegenstand heftigster öffentlicher Diskussion gemacht haben, sondern dass es das Alkoholkapital ist, das diese Frage immer von neuem anschneidet. Wir Guttempler kennen unsere Volksgenossen und wir wissen nur zu gut, dass bei der Einstellung der meisten deutschen Landesbrüder ein Prohibitionsgesetz, wie es Amerika kennt, zur Zeit in Deutschland nicht die geringste Aussicht auf Annahme hat.
Wer am vergangenen Mittwoch Gelegenheit hatte, zu hören, wie unser Bruder Hartung aus Kiel in der Loge Triumph von der immer größer werdenden Vormachtstellung des Alkoholkapitals berichtete, das ständig in andere Industrien eindringt und sie sich dienstbar macht, der weiß, dass der einzelne heute kampflos, ganz ohne es zu merken, den Einflüsterungen dieses allmächtigen Königs Alkohol erliegt. Der weiß, dass diese raffiniert durchgeführte Propaganda, die mit allen Fortschritten der Technik, mit der Presse, dem Radio, der Operette, dem Tanzschlager, der Dirnenbedienung, der Animiermusik arbeitet, seinen Opfern unmerklich das Gift der Gewöhnung einflößt.
Warum hat nun das Alkoholkapital die Frage der Prohibition in den Vordergrund des Interesses gerückt, sie zu einer persönlichen Frage für jeden einzelnen gemacht, während wir Guttempler, deren Sache es doch eher wäre, davon schwiegen?
Der Kampf des Alkoholkapitals gegen die Prohibition erfolgt nur aus Unehrlichkeit und Verlogenheit. Es weiß ebenso gut wie wir, dass der Deutsche noch nicht reif für [56]dieses Gesetz ist, aber es sieht die Erfolge in den Vereinigten Staaten und es will vorbeugen, will für alle Zukunft vorbeugen. Dieser Kampf wird auf lange Sicht geführt. Alle jene Zeitungsberichte aus Amerika, die jeder von Ihnen alle Augenblicke in einem Blatt findet, über Alkoholschmuggel, Bestechlichkeit der Polizei, Betrunkenheit ganzer Städte in der Neujahrsnacht, Kampf der Nassen gegen die Trockenen, – all diese Artikel sind bestimmt, dem Leser die ganze Prohibition von vorneherein lächerlich und verächtlich zu machen, in ihm das Gefühl zu erwecken: Getrunken wird ja doch, warum erst solche Gesetze erlassen? Immer wieder soll ihm eingehämmert werden: »Du bist ein freier Mann. Du kannst tun, was du willst. Niemand darf dir verbieten, zu trinken, wenn du Lust hast. Sieh nach Amerika. Dort haben sie es verboten und doch trinkt dort jeder. Lass es also gar nicht erst zu einem so lächerlichen Verbot kommen. Lass dir nichts verbieten, du bist frei.«
So spricht das Alkoholkapital und, wir werden es alle zugeben müssen, es findet sehr offene Ohren.
Lassen Sie mich Ihnen in diesem Zusammenhang aus dem Vortrag unsers Großtemplers einige Zahlen nennen, die die heutige Situation beleuchten, die darüber aufklären, ob die Alkoholnot in unserm Volke z. Z. wirklich nicht so dringend ist, wie von interessierter Seite immer wieder behauptet wird.
Der Alkoholverbrauch ging vor dem Kriege ständig aufwärts, von 1860–1900 vervierfachte sich der Konsum pro Kopf der Bevölkerung. Der Krieg brachte eine scharfe Unterbrechung dieser Entwicklung, der Verbrauch fiel auf ein Fünftel der Vorkriegszeit. Professor Kräpelin-München, der große Irrenarzt, zog damals die Folgerung: je weniger [57]Alkohol, desto weniger Trinkerfürsorge, Kriminalität, Familienelend. Die Unglücksziffern sinken, die erfreulichen steigen. Der Krieg hat also gewissermaßen ein Riesenexperiment am Menschen durchgeführt und uns bewiesen, dass Mäßigkeit schon in der lebenden Generation eine außerordentliche Besserung erzielt. Wieviel mehr noch wäre in einer Generation zu erreichen, die den Alkohol überhaupt nicht kennenlernt.
Nach dem Kriege steigt aber wieder der Alkoholkonsum und zwar so stark, dass selbst die Presse, die im Allgemeinen eine gefügige Dienerin des Alkoholkapitals ist, sich hie und da beunruhigt. So brachte die Berliner 12 Uhrzeitung einen Artikel unter der Schlagzeile: »Für 6 Milliarden Volksvermögen vertrunken.«
Aber die Brauerzeitung, das Fachblatt des Alkoholkapitals, ist zufrieden. Sie stellt fest, dass ¾ des Vorkriegsverbrauchs bereits wieder erreicht sind, und hofft, auch das letzte Viertel bald wieder aufholen zu können.
Doch das ärmere und kränkere deutsche Volk darf sich heute keineswegs die Ausschreitungen leisten, die noch vor dem Kriege möglich waren. Wir seufzen unter den Daweslasten, die in diesem Reparationsjahr erstmalig die volle Höhe von 2½ Milliarden erreichen. Wie aber können wir von unsern Vertragsgegnern Milderung erwarten, wenn wir zur gleichen Zeit in einem Jahr für Alkohol 6 Milliarden Mark verausgaben?
Und diese 6 Milliarden Mark sind nur die direkten Aufwendungen der Deutschen für Alkohol, dahinter steht eine sehr viel größere Summe, für Aufwendungen für Krankheiten, Elend, Verbrechen, die eine Folge des Alkoholgenusses sind.
[58]Aber von solchen erschreckenden Zahlen wollen die Draußenstehenden nichts hören, man hört lieber auf die Geschichtchen des Braukapitals über Prohibition, amüsiert sich und ist streng gegen ein Alkoholverbot als gegen einen Eingriff in die persönliche Freiheit jedes Einzelnen.
Nun weist Professor Delbrück mit Recht auf eine Tatsache hin, die manchem von uns entgangen ist, dass wir nämlich in Deutschland schon eigene Erfahrungen mit dem Alkoholverbot gemacht haben, dass es hier schon Stätten gibt, in denen das Verbot seit einer Reihe von Jahren strikte durchgeführt ist, das sind die deutschen Irrenanstalten.
Und Delbrück meint, dass wir aus nichts besser als aus diesen Versuchen lernen können. Ich habe Ihnen vorhin von dem Fragebogen gesprochen, den er an die einzelnen deutschen Irrenanstalten betr. Abstinenz versandt hat. Sie sahen schon aus den Hauptfragen betr. Alkoholabgabe an Ärzte und Pflegepersonal, wie außerordentlich schwierig dieses ganze Problem ist. Sicher ist es für den Leiter einer solchen Anstalt leicht, mit einem Federstrich dem gesamten Personal, wie selbstverständlich auch den Kranken, den Alkoholgenuss zu verbieten. Aber Verbote werden übertreten und die wachsamste Kontrolle kann nicht davor schützen, dass Alkohol eingeschleppt wird.
Professor Delbrück ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen zu der Ansicht gelangt, dass man von Verboten nichts zu erwarten hat, was allein helfen kann, ist Belehrung und freiwilliger Verzicht. Von ihnen erwartet er sich alles. Er hat grade auch bei dem Pflegepersonal mit dem freiwilligen Verzicht die besten Erfahrungen gemacht.
Freiwilliger Verzicht – das ist stets auch unsre stärkste [59]Guttemplerwaffe gewesen. Im Kampf, den das Alkoholkapital um die Prohibition aus verlogenen, eigensüchtigen Motiven entfesselt hat, ist unsre Gegenwaffe die Belehrung. Und da uns, von ganz wenigen, nicht ins Gewicht fallenden Ausnahmen abgesehen, die Tagespresse verschlossen ist, so bleibt für uns als stärkstes Kampfmittel ein aufrechtes Beispiel und Aufklärung im eigenen Kreise. Nichts wirkt stärker. Gezwungen Abstinente, Abstinente aus einem Verbot heraus, sind wertlos, sie werden jede Gelegenheit, in den Sumpf zurückzukehren, eifrig nutzen. Aber jeder, der freiwillig verzichtet, dem es ernst um unsere Sache ist, wird ein Glied in unserer Reihe, die endlich über die vergifteten Waffen unsers Feindes triumphieren wird.
Professor Delbrück sagte sehr richtig zum Schlusse seiner Ausführungen, dass, je größer die Schwierigkeiten des einzelnen bei der Durchführung seiner Abstinenz sind, um so größer aber auch die Wirkungen dieser Abstinenz werden.
Wenn ich das bisher Berichtete in wenigen Worten zusammenfassen darf, so stellt sich die augenblickliche Situation so dar: Ein ständig steigender Alkoholverbrauch findet infolge der rührigen Propaganda des Braukapitals keinerlei Bedenken im Deutschen Volke. Der Guttemplerorden ist von der Öffentlichkeit auf ein Teilgebiet seiner Bestrebungen, die Trinkerrettung, zurückgedrängt, seine Kampfkraft und seine Werbefähigkeit ist gesunken.
Es ist notwendig, dass er in Zukunft in erster Linie der Verhütung von Alkoholschäden seine ernste Aufmerksamkeit schenken muss, damit vor allem auch der Jugendbewegung. Er darf aber keinesfalls den ihm vom Alkoholkapital [60]angebotenen verlogenen Kampf um die Prohibition annehmen, denn für dieses Verbot ist das deutsche Volk noch nicht reif.
Seine Waffen müssen Belehrung und freiwilliger Verzicht sein. Den Weg, den diese Sätze dem Orden weisen, kann und muss jedes Ordensmitglied gehen, es begnüge sich in Zukunft nicht damit, Trinker und Gefährdete dem Orden zur Rettung zuzuführen, sondern jeder wirke im eigenen Kreise, dass alle Lauen und Gleichgiltigen davon überzeugt werden, dass die Abstinenz nicht ein Steckenpferd von ein paar Eigenbrödlern ist, sondern eine, nein, die Lebensfrage des deutschen Volkes.