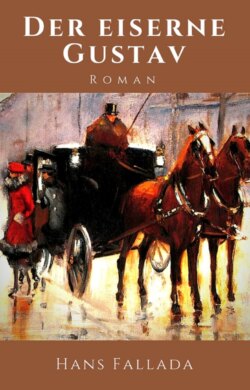Читать книгу Der eiserne Gustav - Ханс Фаллада - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12
ОглавлениеHinter der Gardine des Schlafzimmers hatte Eva gestanden und gebannt auf die Abfahrt des Vaters gewartet. Eigentlich hatte sie gewußt, daß sie fast nichts riskierte, als sie in des Vaters Zimmer geschlichen war, während der für Erich in Küche und Keller wirtschaftete. So töricht war sie nicht gewesen, das Geld auf dem Schreibtisch selbst anzurühren. Die Morgeneinnahme war gezählt, das wußte sie.
Das in der Lade liegende Geld, das in den Säckchen, war freilich auch gezählt. Aber wenn der Vater schließlich merkte, daß da nicht nur achtzig Mark, daß da zweihundertachtzig Mark fehlten, er würde immer nur an Erich als an den Dieb denken. Und Erich hatte schon soviel Butter auf dem Kopf, da kam es auf ein bißchen mehr oder weniger nicht an!
Sie machte eine geringschätzige Bewegung mit der Schulter, in der Schürzentasche fühlt sie mit den Fingerspitzen die zehn Goldfüchse – schlau muß man sein! Seit ihr Entschluß fest geworden ist, nicht mehr lange in diesem freudlosen Hause zu bleiben, sammelt sie Geld. Wo es zu machen war, hat sie kleine Beträge genommen, sie hat Schmugeld bei den Lebensmitteleinkäufen gemacht, heimlich hat sie Sachen aus dem Wäscheschrank der Mutter versetzt. Jawohl, sie befreit sich langsam und sicher aus der Abhängigkeit vom Vater.
Sollte sie sich ein Gewissen daraus machen, daß sie ihn beklaut? Nicht in die Tüte! Der Vater rückt freiwillig nicht einen Groschen heraus, und wenn er auch immer behauptet, er spart alles für seine Kinder – Vater kann hundert Jahre alt werden, und sie ist dann fast siebzig, ehe es was zu erben gibt. Nein, immer ran an die Kasse, solange sie offen ist, und heute früh war sie ja recht hübsch offen!
Eva schiebt schnell die Hängelampe zur Decke, es ist noch solche alte – ein bloß auf elektrisch aufgearbeitetes Petroleumdings. Je höher sie die Lampe schiebt, um so tiefer sinkt das Gegengewicht: ein blankes Osterei aus Messing, mit stumpfen Messingarabesken verziert. Rasch hakt sie das Gewicht los, schraubt es in der Mitte auseinander – und aus dem hohlen Innern, das früher wohl mit Sand oder Blei gefüllt war, schimmert ihr sanft golden ihr kleiner Schatz entgegen.
Sie starrt ihn an, atemlos vor Glück, ach, diese zwölf oder fünfzehn großen Goldfüchse – sie machen sie ganz selig! Ihr Vater hat ein gutes, solides Vermögen – teils steckt es im Geschäft, in Hofplatz und Haus, teils ist es in soliden Staatspapieren angelegt – hunderttausend Mark, schätzt sie, eher darüber als darunter!
Aber mit des Vaters Geld, mit dem Familienvermögen verbindet sie keinen Begriff. Der Vater gehörte zu der Generation, die gerne Geld verdiente, aber ungern Geld ausgab. Er war ein Anhäufer von Geld und meinte, seine Kinder müßten erst Geld verdienen, ehe sie Geld ausgaben. Aber die Zeiten hatten sich geändert, oder die Menschen hatten sich geändert, oder es war auch nur das alte Gesetz von Ebbe und Flut: Nach dem Hochstand kam Niedrigwasser. Die neue Generation interessierte aufgehäuftes Geld gar nicht, es war etwas Totes, Sinnloses, ja, Widersinniges! Geld war dazu da, um es auszugeben; Geld, das bloß dalag, war dumm!
So entzückt die Tochter des wohlhabenden Mannes der kleine Schatz im Gegengewicht der Hängelampe, den sie mit tausend schmählichen Kniffen und Pfiffen gesammelt hat. Langsam läßt sie die neuen zehn Goldfüchse auf die anderen fallen, das gibt einen leisen, sanften Klang, der sie berauscht. Aber nicht Klang noch Geld berauschen sie, es berauscht sie der Gedanke an das, was sie von diesem Gelde kaufen kann: Freiheit und ein seidenes Kleid, Genuß und einen neuen Hut.
Aufatmend bringt sie die Lampe wieder in Ordnung, setzt dann vor dem viel zu kleinen Spiegel (der Vater duldet keinen größeren) ihren Stroh-Florentiner auf und geht in die Küche.
„Gib mir Geld, Mutter, ich will einkaufen.“
Die Mutter sitzt in einem großen Stuhl am Herd, mechanisch rührt sie aus der Ferne mit einem langstieligen Löffel in einem großen Kochtopf. Alles an der Mutter hängt: Bauch, Brust, Backen – selbst die Unterlippe hängt. Am Fenster steht Bruder Otto, er dreht verlegen mit den Fingern an seinem dünnen, flaumigen Bärtchen.
„Was willst du denn einkaufen, Evchen?“ fragt die Mutter klagend. „Wir haben doch alles zum Mittag. Aber du willst nur wieder rumlaufen!“
„Gar nicht!“ sagt Eva, und ihre eben noch so strahlende Stimmung wird bei den tausendfach gehörten Klagelauten der Mutter sofort wieder gereizt und böse. „Gar nicht! Aber du hast selbst gesagt, Mutter, wir wollen heute abend Matjes mit Pellkartoffeln essen, und wenn ich die Matjes nicht heute früh hole, sind sie alle.“
Beides ist nicht wahr, weder hat die Mutter Matjes fürs Abendessen angesetzt, noch entleert sich der Berliner Markt bis zum Nachmittag gänzlich der Matjesheringe. Aber Eva weiß längst, daß es nicht darauf ankommt, was man der Mutter entgegenhält, sondern daß man ihr überhaupt widerspricht. Dann gibt sie sofort nach.
So auch jetzt. „Ich sage ja gar nichts, Evchen. Meinswegen kannst du gehen! Wieviel brauchst du denn? Is ’ne Mark genug? Du weißt doch, Vater will deine Lauferei nicht haben …“
„Dann muß Vater uns eben einen Botenjungen halten!“
„Ach Gott, Evchen, sage doch bloß das nicht! So ein fremder Bengel im Haus, und überall schnüffelt er herum, und nichts kann man offen liegenlassen, alles kommt weg …“
Sie bricht ab und wirft einen halb verlegenen, halb hilfeflehenden Blick auf den stummen Sohn am Fenster.
Statt seiner sagt Eva: „Ach, du meinst wegen Erich, Mutter? Hab dich man nur nicht so! – Der ist besorgt, den läßt Vater nicht eher aus dem Keller, bis er ganz kusch ist.“
„Aber er kann doch nicht – Tage und Wochen …“, sagt die Mutter hilflos. Wieder sieht sie zu dem Sohn hinüber. „Sag du doch ein Wort, Ottchen! Du meinst doch auch …“
„Habe ich das Geld genommen?“ ruft Eva und dünkt sich sehr klug. „Jeder muß seine eigene Suppe ausfressen, da kann ich ihm nicht helfen.“
„So bist du immer gewesen, Eva!“ ruft die Mutter, aber nur kläglich. „Bloß an dich hast du immer gedacht! Du sagst, Erich hat Geld genommen – aber wieviel Schmugeld hast du bei den Einkäufen …?“
„Ich …“, fängt Eva an, völlig verblüfft, daß die Mutter klüger gewesen ist, als sie geglaubt hat.
Aber bei der ist der schwache Zorn schon wieder vorüber. „Ich gönne es dir ja, Kind“, ruft sie weinend. „Du sollst doch auch etwas von deinem Leben haben! Aber sieh mal, Evchen“, fängt sie schmeichelnd an, „wenn ich dich nicht verrate, könntest du auch was für Erich tun …“
„Ich habe kein Geld genommen“, protestiert Eva für alle Fälle, „ich tu so was nicht.“
„Siehst du, Evchen, du bist doch nun mal Vaters Liebling, bei dir drückt er eher mal ein Auge zu. Wenn du in den Keller gingst und Erich freiließest? Otto sagt, die Schlösser schlägt man leicht mit Meißel und Hammer entzwei …“
„Und warum geht dann nicht der große Otto in den Keller und läßt Erich frei, wenn er so klug ist? Und warum gehst du nicht selber, Mutter? Du bist doch die Mutter! Nein, daraus wird nichts. Ich soll eure Dumme sein – aber das bin ich nicht! Von meinswegen kann der Erich da sitzen, bis er so schwarz wird wie die Preßkohlen. Da freue ich mich bloß!“
Damit schoß Eva noch einen triumphierenden Blick auf Mutter und Bruder, rief: „Und ihr laßt auch besser die Finger davon!“, fischte sich die Markttasche aus Wachstuch und schlüpfte aus der Küche.
Die beiden Zurückbleibenden sahen einander trostlos an, dann senkte die Mutter den Kopf, und mechanisch fing sie wieder an, im Topfe zu rühren …
„Und wenn er raus ist, wo soll er dann hin, Mutter?“ fragte Otto schließlich. „Er kann dann doch nicht hier im Haus bleiben.“
„Vielleicht kann er eine Weile bei einem Freund wohnen, bis Vater sich beruhigt.“
„Wenn Erich fortläuft, verzeiht Vater ihm nie. So lange kann er nicht bei einem Freund bleiben.“
„Wenn er nun was arbeitet?“
„Arbeiten hat er nicht gelernt. Und er ist auch zu schwach für Körperarbeit.“
„Dazu hat man nun Kinder gekriegt …“, fing die Mutter wieder an.
„Vielleicht ließe ich ihn raus“, sagte Otto schließlich. „Aber wo man gar nicht weiß, wo er bleiben soll … Und Geld haben wir auch nicht.“
„Siehst du!“ rief Frau Hackendahl aufgeregt. „Da ist man nun die Frau von einem reichen Mann, und glaubst du, daß ich je eine Mark für mich gehabt habe? Nie! In meiner ganzen Ehe nicht! Aber so ist dein Vater, Ottochen, was war er denn, bloß ein Wachtmeister – und ich habe ihm das ganze Fuhrgeschäft zugebracht …“
„Was hat es denn für Sinn, über Vater zu schelten? Vater ist so, wie er ist; und du bist so, wie du bist; und ich bin, wie ich bin …“
„Ja, und darum stehst du da und tust nichts und guckst bloß, und am liebsten säßest du wieder auf der Futterkiste bei deinem Rabause und schnitzeltest was aus Holz. Deinetwegen könnte die Welt untergehen und dein Bruder sterben und verderben …“
„Keiner kann aus seiner Haut“, sagte Otto ungerührt. „Mich hat der Vater, weil ich der Älteste bin, zuerst und am meisten in der Mache gehabt, und so bin ich denn wohl so geworden, wie er mich haben wollte. Ich kann mich nicht mehr ändern.“
„Ich“, rief die Mutter und kam wirklich in Bewegung, „ich hab am längsten mit Vatern gelebt, viel länger als du, mit mir hat er am meisten geschrien. Aber wenn ein Kind von mir in Not ist, dann stehe ich doch auf.“ (Sie tat es.) „Und wenn keiner meinem Erich helfen will, dann tu ich es. Lauf, Ottchen“, sagte sie entschlossen, „bring mir Handwerkszeug, womit ich die Schlösser aufkriegen kann. Dann mach, daß du in den Stall kommst, damit du nicht dabeigewesen bist und nichts wissen mußt. – Ich habe auch Angst vor Vatern – aber nur Angst, nein, dann möchte ich doch nicht mehr leben …“