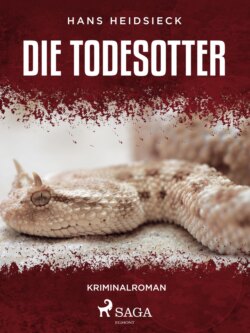Читать книгу Die Todesotter - Hans Heidsieck - Страница 4
ОглавлениеProfessor da Costa blickte betreten von der Lektüre eines Geschäftsbriefes auf, als sein Prokurist ohne Anmeldung und im Zustande höchster Erregung zu ihm hereingestürzt kam.
„Herr Professor!!!”
„Was gibt es, Giuliano?” fragte da Costa ruhig, der nicht leicht aus der Fassung zu bringen war.
Giuliano Conti blieb mit lebhaften Gesten dicht vor dem Schreibtisch stehen. „Die Todesotter ist ausgebrochen”, stammelte er, „Sie wissen doch, Herr Professor — die kleine Schlange, die Doktor Ricardi in einem Sonderbehälter verwahrt hielt. Der Behälter ist leer.”
Ein Zucken um die Mundwinkel des Professors verriet, daß auch er jetzt von der Erregung seines Prokuristen angesteckt wurde. Hastig erhob er sich. „So! Und was sagt der Doktor dazu?”
Conti wurde verlegen. „Er ist noch nicht hier”, erwiderte er mit schwankender Stimme, „ich habe ihn auch telefonisch noch nicht erreichen können. Sonst pflegt er um diese Zeit immer schon da zu sein.”
Da Costa warf einen Blick auf die Uhr. Es war genau dreizehn Minuten nach neun. „Haben Sie bereits alles abgesucht?” fragte er.
Conti wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Ja gewiß, selbstverständlich. Ich suchte das Zimmer des Assistenten ab und das Laboratorium. Die Schlange ist nirgends zu finden. Seltsamerweise hat die Tür zum Laboratorium offen gestanden; das Tier kann also auch weiter entwichen sein.”
„Weiß außer Ihnen jemand davon?”
„Ja. Der zweite Buchhalter, der den Doktor aufsucben wollte, um ihn etwas zu fragen. Er war es auch, der die Sache entdeckt hat.”
Der Professor schlug unwillig mit der Faust auf den Tisch. „Donnerwetter — das ist fatal. Es braucht nicht gleich im Hause herumzukommen, daß eine unserer gefährlichsten Giftschlangen unterwegs ist. Haben Sie dem Mann nicht gesagt, daß er den Mund halten soll?”
Conti starrte verwirrt vor sich nieder. „Herr Professor, ich war so erregt — — —”
Da Costa faßte ihn an der Schulter. „Kommen Sie! Kommen Sie! Da muß gleich was geschehen!”
Mit diesen Worten zog er den Prokuristen zur Tür hinaus.
Die beiden Herren rannten zum Hauptbüro der zoologischen Großhandlung, die hier von Genua aus den gesamten europäischen Kontinent mit Tieren jeglicher Gattung versorgte. Der zweite Buchhalter, ein scheuer und ängstlicher Mensch, hatte das böse Ereignis schon ausposaunt. Hierdurch war sofort eine panikartige Stimmung entstanden. Besonders die weiblichen Angestellten gebärdeten sich wie toll. Ein hysterisches Mädchen brach in Weinkrämpfe aus. Nur wenige Herren suchten mit ruhigen und vernünftigen Worten wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen.
Da Costa fuhr mit einem Donnerwetter dazwischen. „Seid ihr verrückt geworden? Das ist doch nur halb so schlimm! Außerdem wissen wir ja noch gar nicht, ob nicht Herr Doktor Ricardi das Tier zu Versuchszwecken mit sich hach Hause nahm. Im übrigen greift eine Schlange so leicht keinen Menschen an, wenn sie nicht gerade gereizt wird. Ich bitte Sie, ruhig wieder an Ihre Arbeit zu gehen. Inzwischen wird alles getan werden, um den Fall aufzuklären.”
Eine Stenotypistin, tiefrot im Gesicht, trat auf den Chef zu. „Die Polizei muß benachrichtigt werden!” rief sie mit fast überschnappender Fistelstimme. Dabei hielt sie scheu nach allen Richtungen Ausschau, ob die Schlange nicht bereits auf sie zukam.
„Die Polizei hat mit dieser Angelegenheit gar nichts zu tun”, erwiderte da Costa bestimmt und warf dem Mädchen einen verächtlichen Blick zu. „Was hier zu tun und zu lassen ist, das bestimme ich. Es ist unbedingt zu vermeiden, daß unser Institut durch eine solche Lächerlichkeit ins Gerede kommt. Wer es sich etwa einfallen läßt, meinen Anordnungen entgegenzuarbeiten, kann sich von Stund an als entlassen betrachten. Ich glaube hiermit deutlich genug gesprochen zu haben. Wenn Sie ein Hasenfuß sind, Signorina, gehen Sie ruhig nach Hause, bis die Angelegenheit aufgeklärt ist. Später sehe ich dann Ihrer mutigen Rückkehr entgegen.”
Das wirkte. Feigheit wollte sich niemand vorwerfen lassen. Die Leute begannen sich langsam auf ihre Plätze zurückzuziehen. Die Worte des Chefs, der bei alten hohe Achtung genoß, hatten ihre Wirkung getan. Die überlegene Ruhe, die ihn selbst stets beherrschte, übertrug sich auf seine Umgebung. Man sah ein, daß die Angelegenheit wirklich gar nicht so schlimm war, wie sie anfangs dargestellt wurde.
Im stillen machte sich allerdings mancher noch weiter seine Gedanken darüber. Eine gewisse Unruhe blieb bestehen. Aber äußerlich ließ man sich nichts mehr anmerken, — ja, man begann sogar Scherze zu machen und sich gegenseitig zu necken.
Da Costa zog sich mit Conti in sein Büro zurück. „Ich verstehe nicht”, sagte er, „daß der Doktor nicht kommt. Er könnte uns wahrscheinlich gleich eine Aufklärung geben. Ich verstehe das wirklich nicht.”
Während der Professor den Telefonhörer zur Hand nahm, fragte der Prokurist: „Und was soll nun veranlaßt werden?”
Da Costa sah ihn verwundert an. „Wie? Veranlaßt? Was zu veranlassen war, ist getan. Jeder weiß, was geschehen ist, und ich glaube kaum, daß ein einziger da ist, der nicht mit Luchsaugen Umschau hält. Wichtig erscheint mir nur, daß ich den Doktor erreiche.”
Der Professor hatte die Nummer der Leute gewählt, bei denen Doktor Ricardi zwei elegante Zimmer gemietet hatte. Eine Dame meldete sich.
„Verzeihen Sie bitte, Signora, — ich möchte Doktor Ricardi sprechen.”
„Doktor Ricardi? — Wer ist denn dort?”
„Hier spricht Professor da Costa.”
„Ach — Herr Professor — — — ich bin selbst ganz durcheinander. Der Doktor ist heute nacht nicht nach Hause gekommen. Eben bin ich in seinem Zimmer gewesen. Das Bett ist noch unberührt.”
Der Professor zuckte zusammen. „Hat er nichts hinterlassen?”
„Nein. Er ist immer so solide gewesen — — — bei Ihnen befindet er sich also auch nicht?”
„Dann hätte ich jetzt nicht bei Ihnen angerufen, Signora. Bitte benachrichtigen Sie mich sofort, wenn er kommt.”
„Selbstverständlich. Ob man nicht der Polizei davon Mitteilung machen soll?”
„Vorläufig nicht. Schließlich kann er ja mal woanders genächtigt haben. Ich habe das in früheren Zeiten sogar ziemlich oft getan. Wenn er freilich bis zur Mittagszeit nicht zurück ist — — na, darüber werden wir dann noch sprechen .....”
Da Costa legte den Hörer hin und starrte den Prokuristen an. „Er ist nicht zu Hause. Können Sie sich das erklären, Conti?”
„Nein, Herr Professor.”
„Ich auch nicht.”
„Vielleicht —” Conti kam nur zögernd damit heraus, — „vielleicht hängt es mit der Schlange zusammen.”
Da Costa horchte auf. „Meinen Sie? — Hm. Das wäre allerdings nicht beruhigend.”
Es war ein strahlender Tag, der über der Mittelmeerküste emporstieg. Die Sonne tauchte den Hafen von Genua, die Stadt und die Vororte in ein gleißendes Licht.
Ein wahrhafter Frühlingstag. Überall blühte es in den Gärten, hoben sich taubenetzte, buntfarbige Kelche dem Licht entgegen, — in einer prachtvollen Üppigkeit, wie man sie nur in diesen südlichen Ländern kennt.
Froh ihres Daseins, unbekümmert und unbeschwert jubilierte die tausendstimmige Vogelwelt in den lachenden Morgen hinein. Das silbern schimmernde Meer lag fast spiegelglatt. Schwer beladene Fischerboote kehrten von einer nächtlichen Fahrt zurück. Aus der Ferne vernahm man das gleichmäßige Knattern ihrer Motore.
Bunte Segel spiegelten sich auf der leuchtenden Flut.
Wer diesen Morgen erlebte, hatte es leicht, sich in einer gehobenen Stimmung zu fühlen und die Welt als ein Paradies anzusehen. Er konnte schwerlich auf den Gedanken kommen, daß auch an solchen Tagen das Schicksal seinen Weg ehern weitergeht und, ohne Rücksicht auf das Wohlbefinden des Einzelnen, seine dem Menschen ewig unerforschlichen Aufgaben erfüllt.
Der kleinen, hübschen, schwarzlockigen Leona Bastinelli lagen solche Betrachtungen jedenfalls fern, als sie in ihrer anmutig wiegenden Gangart die Promenade in Pegli entlangschritt, um ihre Freundin Viola zu besuchen, die gerade jetzt einige Tage Ferien hatte.
Leonas Gedanken kreisten um die letzten Ereignisse, die, wie sie meinte, geeignet waren, in ihr bisher wenig erfreuliches Schicksal eine entscheidende Wendung zu bringen.
Es handelte sich um die Verlobung Violas, die vor zwei Tagen dem jungen Colonna ihr Jawort gegeben hatte.
Eine gewisse Schadenfreude stieg in dem Mädchen auf. Doktor Ricardis Hoffnungen, die er sich bis zum letzten Tage gemacht hatte, sind nun durch Violas raschen Entschluß endgültig zerschlagen worden. Wie konnte man überhaupt so verbohrt sein und glauben, die Neigung eines Menschen gewinnen zu können, der deutlich zeigte, daß seine Wahl schon getroffen war?!
In seiner blinden Verliebtheit hatte er gar nicht bemerkt, wie ihm, während ihm Viola mehr und mehr entglitt, auf der anderen Seite die hübsche Freundin der Angebeteten eine immer stärker werdende Neigung entgegenbrachte. — —
Leona erschrak vor sich selbst. Hatte sie eben nicht einen Seufzer ausgestoßen — so laut, daß es deutlich zu hören war?
Sie streifte die unangenehmen Gedanken ab und gab sich der Hoffnung hin, daß nun alles bald anders werde. Vielleicht würde auch sie in Kürze, wie Viola, heiraten und glücklich sein.
In diesem Gedanken stieß sie einen Jubelruf aus. So langte sie in der besten Stimmung vor einem Häuschen an, das wie ein Schmuckkästchen in ein Meer duftender Rosen gebettet war. Es war das zu einer großen Villa gehörige Gartenhaus, dessen südliche Fenster einen prachtvollen Blick auf die See hinaus boten. Drei Räume besaß es. Für Viola war das übergenug. Ihre Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit stand in einem gewissen Gegensatz zu dem, was sie sich tatsächlich hätte leisten können.
Leona strebte mit tänzelnden Schritten dem Hause zu.
Antonio war ein Klubdiener, wie er sein soll: zurückhaltend, aufmerksam, ruhig — und vor allem diskret. Er kannte jede Schwäche der vielen Herren, die in ‚seinem Hause’ verkehrten, in dem er viel eher die Rolle eines liebenswürdigen Gastgebers, als die eines Dieners zu spielen schien.
Alles im Leben — so philosophierte Antonio — war eine ewige Wiederholung. Abend für Abend fanden sich die gleichen Gruppen über den Karten zusammen; Abend für Abend fachsimpelten drei Juristen am ‚Paragraphentisch’, und Abend für Abend trank der alte Kapitän Cato gerade so viel, daß er noch eben allein nach Hause fand.
Unerhört aber und aller göttlichen Ordnung zuwiderlaufend erschien es dem guten Antonio, wenn sich einmal etwas ereignete, was mit den Gebräuchen des Hauses nicht in Einklang zu bringen war.
So etwas war am gestrigen Abend geschehen. In Doktor Ricardi, diesen sonst so ruhigen und so sympathischen Menschen mußte der Teufel gefahren sein. Niemand kannte ihn bisher anders, als friedlich beim Schach mit einem Partner in einer Ecke hockend, wobei er bisweilen Bekannten ein freundliches Wort spendete. Manchmal auch unterhielt er sich mit einem Kollegen von der Universität über zoologische Fragen. Dabei trank er mit Maßen. Man hatte ihn niemals auch nur angeheitert gesehen.
Und gestern?
Gestern hatte er eine Flasche nach der anderen auffahren lassen. Alle, die an den Tisch traten, hatte er eingeladen. Man steckte die Köpfe zusammen; man fragte ihn, was denn los sei. Welches Glück war ihm zugestoßen? Hatte er in der Lotterie gewonnen? Fiel ihm vielleicht eine Erbschaft zu? Oder war ihm seine Frau durchgebrannt?
Aber er hatte ja gar keine Frau!
Sämtlichen Fragen wich er mit einem überlegenen Grinsen aus. Seine Züge waren verzerrt, seine Bewegungen hatten etwas Marionettenhaftes. Sein Blick war starr.
Als der Alkohol bei ihm zu wirken begann, war er plötzlich verschwunden. Zwei Stunden später tauchte er wieder auf, ließ neue Flaschen kommen, lud neue Gäste ein. Endlich konnte er sich nicht mehr aufrecht halten. Er saß und redete wirres Zeug. Er habe heute Abschied zu nehmen; Abschied von einer Lebensperiode.
Manche ahnten, was vor sich ging. Der junge Gelehrte tat ihnen leid.
Lallend begann er von Schlangen zu sprechen, und daß zwischen Schlangen und Frauen wirklich manchmal viel Ähnlichkeit herrsche. Er machte fade Witze darüber, — und damit verriet er sich.
Nach und nach zogen sich die anderen Gäste von ihm zurück: sie waren froh, von ihm loszukommen. Er achtete ihrer nicht mehr. Ob er zu ihnen sprach oder zu der tausendkerzigen Krone, die über ihm hing, war ihm gleichgültig.
Endlich hockte er, völlig in sich zusammengesunken, aber immer noch redend, allein in der Ecke.
Die meisten Gäste hatten das Haus verlassen. Es war schon spät.
Da kam Antonio und nahm sich des Einsamen an. Behutsam hob er ihn auf den Stuhl zurück, von dem er gesunken war. Dabei traf ihn Doktor Ricardis gläserner Blick. „An — Anto—nio!” lallte er, „Gu—gute Seele, bring — bring mir noch eine Fla — Flasche Wein!”
Antonio, aus Erfahrung schöpfend, benutzte diese Flasche als Lockmittel, um den Betrunkenen in ein anderes Zimmer zu bringen. Dieses Zimmer war leer von Gästen und enthielt eine Couch. Mit viel Takt und Geschicklichkeit brachte Antonio seinen ‚Patienten’ dahin, daß er sich auf dieser Couch niederließ.
Fünf Minuten später war Doktor Ricardi eingeschlafen...
Der Professor hatte bei allen möglichen Leuten herumtelefoniert. Erst zuletzt kam er auf den Gedanken, auch im Klub einmal anzurufen. Ob man von Doktor Ricardi was wisse? Wie, bitte? Ricardi befindet sich dort?
Da Costa atmete hörbar auf. „Rufen Sie ihn doch gleich an den Apparat.”
Antonios freundliche Stimme erwiderte: „Ich möchte ihn lieber ausschlafen lassen. Er hatte sich gestern abend ein wenig übernommen. Da blieb mir nichts anderes übrig, als ihn hier zu beherbergen, Herr Professor.”
„Es hilft nichts, Antonio. Wecken Sie ihn — ich muß ihn unbedingt sprechen.”
„Ist es wirklich so dringend?”
„Ja! Es handelt sich um — — aber das kann ich Ihnen telefonisch nicht sagen. Jedenfalls ist Gefahr im Verzuge.”
„Warten Sie, Herr Professor — — ich hole ihn!”
„Gefahr im Verzuge — Gefahr im Verzuge” — murmelte Antonio immerfort, während er in das Zimmer eilte, in dem sich der Doktor befand.
Ricardi mußte gerade erwacht sein. Vielleicht von dem Läuten des Telefons. Er blinzelte mit den Augen, rieb sich über die Stirn.
„Wo bin ich — —? Du lieber Himmel —!”
„Kommen Sie mit mir, Herr Doktor. Der Professor wartet am Telefon. Es ist Gefahr im Verzuge!”
Ricardi sprang mit einem Satz hoch. Taumelnd schritt er der Tür zu. Antonio führte ihn zum Apparat.
„Herr Professor!”
„Sind Sie es wirklich, Doktor? Ihre Stimme klingt ja so fremd.”
„Mag schon sein, Herr Professor. Ein wenig rauh, wollten Sie wahrscheinlich sagen. Das hat seine Gründe. Ich muß um Entschuldigung bitten.”
„Beantworten Sie mir sofort eine Frage, Doktor! Wo steckt die Todesotter?”
Doktor Ricardi fuhr einen Schritt zurück, starrte den Apparat an, als begreife er nicht, was eben gesprochen wurde. Endlich erwiderte er, fast belustigt, als habe der Professor nur einen Scherz gemacht: „Selbstverständlich ist sie in meinem Zimmer in dem Blechkasten eingesperrt.”
„Nein. Eben nicht. Die Schlange ist fort. Der Kasten stand offen. Ich glaubte, Sie hätten sie vielleicht mitgenommen.”
Vier, fünf Sekunden verstrichen, bis Doktor Ricardi sich so weit gefaßt hatte, daß er antworten konnte. „Ich habe die Schlange nicht. Wenn der Kasten tatsächlich offen stand, muß ihn ein Fremder geöffnet haben. Hat man denn das Tier nicht im Zimmer gefunden?”
„Nein. Niemand weiß, wo es steckt. Es wird sich in irgend einen Winkel des Hauses verkrochen haben. Die Aufregung, die hier herrscht, werden Sie sich vorstellen können. Kommen Sie bitte sofort!”