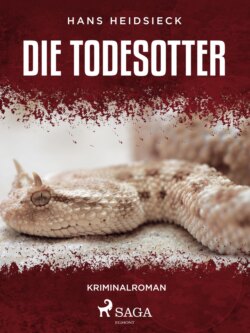Читать книгу Die Todesotter - Hans Heidsieck - Страница 5
ОглавлениеDer Passagierdampfer ‚Genova’, ein stolzes Schiff neuerer Bauart, brach sich durch eine mäßig bewegte See seine Bahn.
Das letzte Tageslicht, blaß verglimmend, wich der anrückenden Nacht.
Doktor Colonna, der Schiffsarzt, wurde vom Capitano angerufen, der auf der Kommandobrücke die Instrumente verglich. „Kommen Sie noch ein wenig zu mir herauf, Dottore!” sagte der Kapitän. Dann deutete er in die Ferne, wo sich an dem sonst klaren Himmel düstere Wolken zusammenballten. „Ich fürchte, wir werden in dieser Nacht noch ein Wetter bekommen!”
Colonna stieg mürrisch die eiserne Treppe hinauf. Er haderte mit dem Schicksal. Seine Gedanken kreisten um Viola. Vorgestern hatte er sich mit ihr verlobt, und er hatte damit gerechnet, einige Tage an Land bleiben zu können. Aber schon am folgenden Tage hatte er wieder mit auslaufen müssen. Der Urlaub war schon bewilligt gewesen, — da wurde seine Vertretung krank, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als diese Fahrt nun doch wieder mitzumachen. Das Ziel des Dampfers war Kairo.
Gewiß — Dienst ist Dienst, — aber wenn es so kam, machte es keinen Spaß mehr. Warum hatte nur der Kollege gerade jetzt krank werden müssen!
„Colonna — Sie träumen ja?!” hörte er plötzlich die rauhe Stimme des Kapitäns.
Er fuhr sichtlich zusammen. „Verzeihen Sie, Capitano —”
Der lächelte. „Oh — ich verstehe schon, — wenn man sich gerade mit einem hübschen Mädchen verlobt hat, kommt einem die See nur noch salzig vor. Ja ja, das war Pech, mein Lieber, daß Sie nun doch gleich wieder fort mußten. Aber nach unseren persönlichen Wünschen geht es ja leider nicht, — oder wenigstens doch nur selten. Daran müssen wir uns gewöhnen. Wie man sich damit abfindet, — daran erkennt man den inneren Kern eines Menschen.”
„Verzeihen Sie, Capitano — aber ich glaube, mein Kern ist noch ziemlich weich.”
Beide lachten. Aber Colonna wurde gleich wieder ernst. Er versuchte vergeblich mit dem ‚sich abfinden’ fertig zu werden, — obwohl er doch eigentlich sonst recht vernünftig war, — viele Jahre und eine reiche Erfahrung, wie etwa der Kapitän, hatte er allerdings noch nicht auf dem Buckel.
Er blieb einsilbig und verdrossen. Der Capitano fand diesmal nicht den erwünschten Unterhalter an ihm.
Colonna zog sich auch bald mit einer knappen Entschuldigung in seine Koje zurück. Er träumte mit offenen Augen von seiner Braut. Dabei dachte er mit dem Gefühl einer tiefen Genugtuung darüber nach, wie sich alles entwickelt hatte.
Jeder Außenstehende würde behauptet haben, daß hier das Schicksal keine außergewöhnliche Leistung vollbracht habe. Dem jungen Verliebten kamen jedoch die Dinge besonders romantisch vor.
Er hatte Viola vor zwei Jahren kennen gelernt. Damals trat sie als Sekretärin in das große Speditions- und Lagerhaus seines Vaters ein. Professor da Costa, dessen Nichte sie war, hatte sie dem Vater empfohlen. Der alte Colonna gab viel auf diese Empfehlung und fuhr auch nicht schlecht dabei.
Da Costa hätte seine Nichte gern bei sich beschäftigt; er hielt dies jedoch nicht für das richtige.
Ottone Colonna wurde erst auf sie aufmerksam, als der Assistent des Professors, Doktor Ricardi, dem jungen Mädchen in der auffälligsten Weise den Hof zu machen begann. Plötzlich entdeckte Ottone, daß hier etwas nicht in Ordnung sei, — ohne gleich den Grund seiner seltsamen Aufregung zu erkennen.
Heute wußte er ihn: es war Eifersucht. Durch die Schwärmerei eines anderen war er selbst zum Schwärmer gewordeh. Auch er begann nun dem eigenartig hübschen Mädchen seine Neigung zu schenken und — diesen Umstand fand er besonders romantisch — ihre Wahl fiel auf ihn. Er war der Glückliche, der als Sieger aus diesem Rennen hervorging; der gute Assistent hatte das Nachsehen.
Diese Ereignisse batten sich in aller Ruhe und Friedfertigkeit abgespielt. Allerdings machte Ricardi bis zuletzt noch Versuche, den verlorenen Posten zurückzugewinnen. Aber das half ihm nichts. Violas Herz, ihr strahlendes Lächeln, das glückliche Aufblitzen ihrer Augen galten ja doch nur ihm.
Wie sich Ricardi wohl damit abfinden mochte? Er mußte inzwischen von der Verlobung erfahren haben. Leicht war es bestimmt nicht für ihn.
Colonna verspürte eine angenehme, erschlaffende Müdigkeit. Er spann seine Träume weiter und schlief alsbald, von den schönsten Bildern umgaukelt, ein.
Leona hatte schon mehrere Male geläutet und, als niemand öffnete, an die Tür geklopft. Es blieb still im Hause. Nichts regte sich. Sollte Viola schon zum Baden gegangen sein?
Die Freundin hatte gewiß nicht daran gedacht, daß sie, Leona, heute noch frei hatte. Sie war wegen einer starken Erkältung dem Betriebe mehrere Tage lang fern geblieben, hatte sogar das Bett hüten müssen. Heute freilich fühlte sie sich wieder wohl.
Viola war gewiß zum Strande hinuntergegangen.
Also machte sich auch Leona dorthin auf den Weg. Sie tänzelte einen schmalen steinigen Pfad hinunter, der sich zwischen stachligen Kakteen hindurchwand. Zwischen den Kakteen wucherte eine üppige Blumenpracht.
Im Wasser tummelten sich bereits zahlreiche Badende, vorwiegend Fremde, die das entzückende Pegli zum Kuraufenthalt gewählt hatten. Badehäuschen und Liegestühle mit farbigen Schirmen leuchteten in verwirrender Buntheit. Die vielfarbigen Badeanzüge der Damen vervollständigten das abwechslungsreiche Bild.
Spielende Kinder tobten lärmend am Strande entlang.
Leona hielt überall Ausschau, aber sie konnte ihre Freundin nirgends entdecken. Viola war nicht hier.
Etwas enttäuscht kehrte das junge Mädchen auf dem gleichen Wege zurück, auf dem es gekommen war. Der bequemere Promenadenweg, der sich etwas weiter nördlich zur Höhe hinaufwand, war ihr gar zu belebt. Sie wollte für sich allein bleiben und ungestört ihren Betrachtungen nachgehen können.
Die Tür, die in Doktor Ricardis Zimmer führte, wurde nur einen Spalt weit geöffnet und gleich wieder zugemacht.
Niemand befand sich in dem großen, behaglich eingerichteten Raum. Wenigstens kein menschliches Wesen. In dem Herbarium, das in der Nähe des Fensters stand, herrschte allerdings Leben genug. In ihm befanden sich prächtig schillernde exotische Eidechsen der verschiedensten Art.
Einige Minuten waren vergangen, da wurde die Tür abermals, diesmal vollständig, aufgemacht.
Der Hausmeister, gefolgt von Herrn Conti, trat in das Zimmer. Da Costa hatte beiden den Auftrag gegeben, noch einmal gründlich Umschau zu halten.
Plötzlich stieß der Hausmeister einen Schreckensruf aus.
„Die Schlange! Die Schlange! Schauen Sie — — dort in der Ecke, Herr Prokurist!”
Auch Conti starrte das Tier an, das sich in einen Winkel des Zimmers geflüchtet und dort zusammengeringelt hatte. Es machte durchaus nicht den Eindruck, als ob es auf einen Angriff bedacht sei.
Der Hausmeister hielt einen langen Stock in der Hand. Er begann der Schlange näher zu rücken.
Conti suchte ihn davon abzuhalten. Aber der Mann war wie behext. „Ich schlage sie tot!” rief er. „Nur wenn sie tot ist, wird man uns glauben, daß sie unschädlich gemacht worden ist.”
Mit diesen Worten hieb er in blinder Wut auf das Tier ein.
Die nicht sehr große Schlange war bald erledigt. Der Hausmeister faßte den noch lange zuckenden Körper am Schwanz und hob ihn empor. Triumphierend zog er, von dem Prokuristen begleitet, davon.
Im Hauptbüro wurde die Schlange herumgezeigt. „Die Gefahr ist vorüber. Niemand braucht jetzt mehr Angst zu haben.”
Die meisten lächelten. Angst? Pah — Angst hatte doch überhaupt niemand gehabt!
Ihren Mienen sah man jedoch die Erleichterung an.
Eine Viertelstunde später kam Doktor Ricardi. Er sah elend und blaß aus. Seine sonst immer frischen und lebhaften Züge waren erschlafft. Ein schwacher Bartansatz umrahmte seinen Kinn. In der Eile hatte er keine Zeit gefunden, sich zu rasieren. Es war ihm darum zu tun, sofort mit dem Professor zu sprechen.
Da Costa empfing ihn mit einem Lächeln. „Da kommt ja der plötzlich unsolide Gewordene!” rief er. „Nehmen Sie Platz, Herr Doktor. Wie fühlen Sie sich?”
Ricardi ärgerte sich über die Art, wie er empfangen wurde. Auch wunderte er sich darüber, daß der Professor nicht gleich auf die Schlange zu sprechen kam. Er erkundigte sich deshalb danach, ohne auf die Frage da Costas zu antworten.
„Oh — die Otter?” sagte da Costa ruhig, „die ist inzwischen gefunden worden. Sie hatte wohl nur einen kleinen Ausflug durch Ihr Zimmer gemacht. Wahrscheinlich wollte sie einmal eine Abwechslung haben.”
Die ganze Art, wie der Professor sprach, paßte dem Doktor nicht. Aber er schwieg dazu. Endlich fragte er: „Hat man sie wieder in den Kasten gesperrt?”
„Nein, — leider muß ich Ihnen berichten, daß der Hausmeister sie erschlagen hat. Das wäre allerdings nicht nötig gewesen — aber man muß es schon seiner Erregung zugute halten. Auch dem übrigen Personal gegenüber war es wohl besser, wenn man sich überzeugen konnte, daß das Tier tot ist.”
Doktor Ricardi fuhr erschrocken zusammen. „Was — tot?” rief er. „Man brauchte die Schlange doch nicht gleich zu erschlagen. Das werde ich dem Hausmeister nicht verzeihen. Ich machte gerade eingehende Experimente mit dem Gift dieses Tieres. — Wo hat man es hingebracht?”
Da Costa zuckte mit den Achseln. „Was weiß ich! Jedenfalls bin ich froh, daß der Aufruhr im Hause beigelegt und kein Grund mehr zu Befürchtungen da ist. Ich verstehe nur nicht, wie das Tier hat entweichen können.”
Der Doktor rückte nervös auf seinem Stuhl hin und her. „Ich auch nicht. Meines Wissens ist der Kasten, als ich fortging, fest verschlossen gewesen.”
„Hm. Ihres Wissens. Sie sind also nicht ganz fest davon überzeugt?”
„Doch. Ich möchte einen Eid darauf leisten.”
Der Professor blickte seinen Assistenten von der Seite an. „Mit Eiden muß man vorsichtig sein, lieber Doktor!”
„Möglicherweise hat jemand anders den Kasten aufgemacht.”
„Wer sollte das denn gewesen sein?”
Doktor Ricardi schwieg. Er erhob sich und trat ans Fenster.
Man hatte von hier aus einen weiten Blick über den Hafen. Eben lief ein großer Frachter aus Übersee ein und bewegte sich majestätisch langsam zwischen den unzähligen anderen Fahrzeugen hindurch auf die Mole zu, an der er festmachen wollte.
An einer anderen Stelle strömten zahlreiche Menschen zusammen, um einen Passagierdampfer zu besteigen, der nach Ostindien ausfahren wollte. Die verwehten Klänge einer Kapelle schallten herüber. Der schrille Pfiff einer Pinasse klang jäh dazwischen.
Dieses Bild prägte sich der Doktor mit einer unnatürlichen Schärfe ein. Es war ihm zu Mute, als sei er auf einmal aus einem Traum in die Wirklichkeit zurückversetzt worden.
Der Professor sprach weiter: „Jedenfalls wollen wir froh sein, daß die Sache behoben ist, — und da nichts passierte, brauchen wir ihr auch nicht weiter nachzugehen. Aber ich möchte Sie doch bitten, auf Ihre gefährlichen Pfleglinge in Zukunft ein noch wachsameres Auge zu haben, Herr Doktor!”
Ricardi empfand diese Mahnung als unberechtigt. Aber er wollte sich jetzt nicht streiten. Er hob nur bedauernd die Schultern und ging hinaus.
Leona hatte beim Friseur und in verschiedenen Geschäften nach ihrer Freundin Umschau gehalten. Aber Viola war nirgends zu finden.
Endlich kehrte das junge Mädchen zu dem Häuschen zurück, um dort noch einmal sein Glück zu versuchen.
Es wurde ihm wieder nicht aufgemacht.
Daraufhin wandte sie sich an die Bewohner der Villa, zu der das Häuschen gehörte. Ob man Viola heute noch nicht gesehen habe?
Nein. Weder die Herrschaften noch das Personal hatten das junge Mädchen erblickt. Was jedoch nichts zu bedeuten habe, da man Viola des öfteren tagelang nicht zu Gesicht bekam. Sie pflegte selten den Haupteingang zu benutzen. Meistens betrat sie das Grundstück vom Garten her.
Leonas Unrute wuchs. Irgend etwas, das fühlte sie deutlich, stimmte hier nicht.
Sie kehrte zu dem Häuschen zurück. Von der Veranda aus konnte man in Violas Schlafzimmer blicken. Leona ging die kurze Treppe hinauf und hielt Umschau. Das Fenster war nicht völlig geschlossen. Die junge Späherin drückte es vollends auf.
Da sah sie in höchstem Erstaunen, daß Viola in dem Zimmer auf ihrem Bett lag.
Ohne Bedenken stieg Leona über Sims und Blüstung und drang in das Zimmer ein.
Der Hausmeister hatte die tote Schlange herumgezeigt und war im Begriff, sie in den Hof zu bringen, um den Kadaver dort in einem Abfalleimer verschwinden zu lassen.
Unterwegs hielt ihn der Tierpfleger Pucci an. „Zeige mal her das Biest! Ich habe eben ein wenig abseits gestanden und konnte es nicht recht sehen.”
„Was ist daran schon zu sehen!” versetzte der Hausmeister mürrisch und schickte sich an, seinen Weg fortzusetzen. „Eine Schlange wie jede andere.”
Pucci tippte sich an den Kopf. „Hast du eine Ahnung! Wie jede andere! Weißt du, wie viele verschiedene Arten es gibt?”
„Wenn du fachsimpeln willst, mußt du zu Doktor Ricardi gehen.”
„Zeig mal die Schlange her!”
Der Hausmeister hielt das Tier dem Pfleger so dicht vor den Kopf, daß es fast die Nase des Mannes berührte.
„Da hast du sie! Kannst sie dir sauer einlegen lassen oder auch um den Hals hängen, wenn du willst! — Warum starrst du das Vieh denn so an?”
Tatsächlich hatte Pucci die Augen weit aufgerissen. Dann schüttelte er den Kopf. Aber das einzige, was er hervorbrachte, war: „Sehr merkwürdig!”
„Was ist merkwürdig?” fragte der Hausmeister, „wieso kommt dir diese Schlange merkwürdig vor?”
„Ach — ich vergleiche sie in Gedanken mit einer anderen. Legst du großen Wert darauf, sie auf den Müll zu werfen?”
„Was heißt das?”
„Ich möchte sie haben.”
„Brate sie meinetwegen und friß sie auf!” rief der Hausmeister, warf dem anderen das tote Tier vor die Füße und ging davon.
Pucci nahm einen Zeitungsbogen aus seiner Tasche, raffte die Schlange auf und wickelte sie vorsichtig, als ob sie etwas besonders Kostbares sei, in den Bogen ein.
Eine Minute später ließ er sich bei Doktor Ricardi melden.
Ricardi hatte sich nach der Aussprache mit dem Professor rasieren lassen, um dann gleich in sein Zimmer zurückzukehren. Er hatte verschiedene wichtige Arbeiten vor, in die er sich mit Eifer versenkte. Auf diese Weise kam er am besten über alles hinweg.
Es klopfte. Pucci trat ein.
„Verzeihen Sie, wenn ich störe, Herr Doktor — — — ich wollte Ihnen bloß etwas zeigen. Es handelt sich um die Todesotter, die bei Ihnen entwichen war.”
Ricardi wandte sich mürrisch um, erhob sich und trat mit fragender Geste auf den Mann zu. „Ja — also was ist mit ihr? Ich hörte, daß sie erschlagen wurde.”
Der Pfleger packte die Schlange aus. „Das ist sie jedenfalls nicht, nicht wahr?”
Der Doktor starrte die Schlange an. „Nein, natürlich nicht. Es war eine Todesotter. Dies ist eine ganz andere Gattung.”
„Deshalb bin ich gekommen, Herr Doktor. Dies ist das Tier, das als Todesotter herumgezeigt wurde, — als die in Ihrem Zimmer erschlagene Todesotter.
Ricardi erblaßte. „Aber das ist ja — — ich verstehe das nicht.”
„Mir ist es auch schleierhaft. Irgend etwas stimmt da doch nicht.”
„Nein. Gewiß nicht. — — Kommen Sie, kommen Sie! Das muß aufgeklärt werden. Wir wollen gleich zum Professor gehen.”
Mit diesen Worten zog Doktor Ricardi den Mann zur Tür hinaus.
Leona war an das Bett ihrer Freundin getreten. „Viola!” rief sie, „wach auf!”
Ihr war unheimlich zu Mute. Sie wußte, sie fühlte schon, daß ihr Rufen vergeblich war. Viola konnte sie nicht mehr hören. Sie lag steif und still, rührte sich nicht mehr — war tot.
In der ersten Aufregung wußte Leona nicht, was sie anfangen sollte. Tausend Gedanken berührten sie, drangen jedoch kaum bis zu ihrem Bewußtsein vor. Die furchtbare seelische Spannung, in die sie so unerwartet geraten war, löste sich endlich in einem markerschütternden Schrei.
Dunkel entsann sie sich, daß sich die Freundin ja gestern schon nicht ganz wohl gefühlt hatte. Viola hatte über starke Rückenschmerzen geklagt. Leona hatte ihr noch empfohlen, zum Arzt zu gehen. Daß sie jedoch jetzt tot sein sollte, erschien dem jungen Mädchen unfaßbar.
Nachdem sie sich einigermaßen gesammelt hatte, alarmierte sie die Bewohner der Villa. Von hier aus wurde der Arzt verständigt, der sofort kam.
Leona fragte ihn, als er den Totenschein ausgestellt hatte, wie es denn möglich sei, daß ihre Freundin so plötzlich sterben konnte.
Der Arzt blickte nachdenklich vor sich nieder. „Eigentlich”, sagte er, „war dieser Ausgang nicht zu erwarten. Gestern abend ist die Signorina noch bei mir gewesen. Sie hatte über Rückenschmerzen geklagt, auch schien sie mir etwas benommen zu sein. Es handelte sich um einen Grippeanfall, der meines Erachtens zu ernstlichen Besorgnissen keinerlei Anlaß gab. Ein tödlicher Ausgang kommt in derartigen Fällen, namentlich in einer so kurzen Zeitspanne, nur äußerst selten vor.”
„Aber hier ist er eingetreten! Haben Sie Viola genau untersucht?”
„Selbstverständlich. Eine Herzlähmung hat ihrem Leben ein Ende gemacht. — Hat Ihre Freundin Verwandte hier?”
„Nur einen Onkel. Das ist mein Chef, der Professor da Costa vom zoologischen Institut. Andere Verwandte besaß Viola nicht mehr. Ihre Eltern sind früh gestorben, Geschwister hatte sie keine. Sie stand eigentlich recht allein, bis sie sich vor zwei Tagen verlobte. Mein Gott — — und jetzt kommt es so!”
Der Doktor legte seine knochige Hand auf die Schulter des jungen Mädchens. „Sie sind ihre Freundin gewesen?”
„Ja. Von der Schule her schon. Wir haben wie Geschwister zusammen gelebt.”
Leona sank vor dem Lager nieder und brach in Tränen aus.
Die Herrschaften aus der Villa nahmen sich der Verzweifelten an. Leona suchte vergeblich zu begreifen, was geschehen war. Es lag wie ein Schleier vor ihren Augen. Viola tot? — Unfaßbar!
Der Onkel mußte benachrichtigt werden, fiel es ihr plötzlich ein. Alle Kräfte zusammenfassend, eilte isie selber zum Telefon.