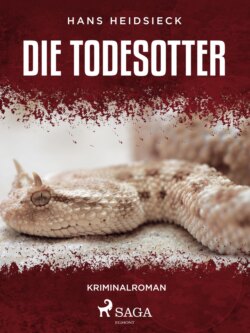Читать книгу Die Todesotter - Hans Heidsieck - Страница 6
Оглавление„Herr Professor”, sagte Ricardi erregt, auf den Kadaver zeigend, „die Schlange ist keine Todesotter.”
Da Costa betrachtete das Tier. „Nein — allerdings nicht!” gab er zu.
„Es ist aber als solche bezeichnet und den Leuten herumgereicht worden.”
Der Professor starrte seinen Assistenten an, als glaube er nicht, was jener eben gesagt hatte. „Was — bei den Leuten — —? Ach so, das war dieses Tier?”
„Ganz recht. In meinem Kasten aber befand sich doch eine Todesotter. Hier liegt also eine Verwechslung vor.”
„Demnach müßte die Todesotter — — —”
„Jawohl, — die müßte demnach noch verschwunden sein. Und wie diese Schlange in meinen Raum kam, ist mir vollkommen unverständlich.”
„Woher haben Sie denn das Tier?”
„Der Hausmeister hat es dem Pfleger auf seine Bitte hin überlassen.”
Pucci bestätigte diese Worte mit einem Nicken des Kopfes. „Jawohl, — ich traf ihn, als er die Schlange auf den Müll werfen wollte.”
Da Costa ging erregt auf und ab, wobei er die Hände auf dem Rücken verschränkt hielt. „Das ist freilich merkwürdig”, sagte er nach einer längeren Pause. „Immerhin wollen wir das, was wir wissen, zunächst noch für uns behalten. Damit nicht im Hause eine neue Panik entsteht.”
Doktor Ricardi pflichtete dieser Meinung bei. Auch der Tierpfleger wurde angehalten, zunächst einmal niemandem etwas davon zu sagen.
Da Costa wandte sich wieder dem Assistenten zu. „Sie haben also bestimmt eine Todesotter in Ihrem Kasten gehabt?”
„Ja, Herr Professor. Ich weiß genau, was ich hatte.”
„Wäre es aber nicht möglich, daß Ihnen jemand einen Streich spielen wollte und das Tier gegen ein anderes ausgetauscht hat?”
Ricardi machte eine abwehrende Handbewegung. „Wer sollte so etwas tun? Allerdings haben wir genug Schlangen im Hause, aber — ich kann mir nicht vorstellen, daß mir jemand einen solchen Streich gespielt haben sollte.”
„Nein. Natürlich nicht. Aber es steht doch fest, daß diese Schlange in Ihrem Zimmer gefunden wurde.”
„Und wo befindet sich die, die wirklich in meinem Kasten war?”
„Das weiß ich nicht. Sicherlich hat doch ein Tausch stattgefunden. Darauf deuten ja schon die ganzen übrigen Tatsachen hin. Der Betreffende, der den Tausch vornahm, vergaß den Kasten richtig zu schließen, so daß die Schlange entweichen konnte. Der Mann ließ in seiner begreiflichen Eile sogar die Tür zum Laboratorium offen.”
Ricardi strich sich mit der flachen Hand über die Stirn, als ob er einen bösen Traum wegscheuchen wollte. „Mir kommt diese ganze Angelegenheit rätselhaft vor”, erwiderte er. „Wenn nun doch kein Tausch stattfand?”
Da Costa packte ihn an der Schulter. „Was wollen wir machen? Wir können bloß abwarten, bis sich die Angelegenheit vielleicht von selbst aufklärt. Es wäre doch sinnlos, auch das wieder an die große Glocke zu hängen. Im Gegenteil. Meiner Meinung nach muß diese neue Feststellung strengstens verschwiegen werden. Unter der Hand können wir natürlich weiterhin nachforschen. Aber ich bitte Sie, dies ganz im stillen zu tun.”
Bei dieser Abmachung blieb es.
Das Telefon klingelte. Der Professor meldete sich; er zuckte zusammen. „Wie, bitte? — — — Etwas geschehen? Etwas Schreckliches? Reden Sie doch, Signorina!”
„Es — es betrifft Ihre Nichte. Sie ist einem plötzlichen Grippeanfall erlegen. Als ich kam, um sie aufzusuchen, fand ich sie tot im Bett.”
Da Costa schwieg einen Augenblick. Er mußte erst zur Besinnung kommen. Dann rief er: „Ich mache mich sofort auf den Weg.”
Er steuerte seinen eleganten Wagen selbst und jagte in einem irrsinnigen Tempo nach Pegli hinaus.
Leona trat ihm in der Tür des Häuschens entgegen. Mit verweinten Augen begrüßte sie ihren Chef.
In sichtbarer Erschütterung trat da Costa an das Lager der Toten. Dann sprach er leise mit dem noch anwesenden Ehepaar, das die Villa bewohnte. Wie das nur möglich — und wie das gekommen sei? Gestern habe er seine Nichte doch noch in strahlender Frische gesehen!”
Eine Herzlähmung — sagte man ihm — habe Viola plötzlich dahingerafft. Gestern sei sie beim Arzt gewesen, weil sie von Schmerzen geplagt wurde. Mehr wußte man nicht.
Da Costa wandte sich wieder Leona zu. Ob sie bereit sei, ihm bei Erledigung der verschiedenen Formalitäten zu helfen? Man müsse zunächst an Colonna telegrafieren.
Leona war bereit, alles zu tun, was nur in ihren Kräften stand. Sie brachte die Nachricht zur Post.
Der Professor ordnete eine Überführung der Toten in seine Wohnung an. Die nötigen Schritte hierzu unternahm er selbst.
Seine Frau, mit der er in einer kinderlosen und nicht sehr glücklichen Ehe lebte, zeigte sich äußerst ungehalten, als er ihr sagte, daß die Beerdigung von seiner Villa aus stattfinden sollte. Sie war auch schuld daran, daß Viola in diesem Hause niemals die Aufnahme fand, die sie eigentlich hätte beanspruchen können. Signora da Costa nannte das Mädchen stets nur „die verrückte Person.”
Warum — das war eigentlich nicht recht erklärlich. Vielleicht, weil Viola manche Eigenschaften besaß, die der Tante vollkommen abgingen und die dadurch den Neid der Älteren herausforderten. Schon, daß Viola hübsch und jung war, reichte zu einer Verärgerung ihrer Tante hin. Eifersucht sprach wohl auch mit.
Ferner wußte sich Viola stets gut und geschmackvoll zu kleiden, was sie auch mit den bescheidensten Mitteln zuwege brachte, — während Signora da Costa, auch wenn sie ihr teuerstes Kleid anzog, ihrer Körperfülle wegen immer noch recht gewöhnlich wirkte.
Viola hatte wenig Wert darauf gelegt, ihre Tante bei jeder Gelegenheit ins Vertrauen zu ziehen. Das wurde aber von ihr erwartet.
So kam es, daß sie bei ihrer Tante nicht warm werden konnte und jede Gelegenheit wahmahm, um diesem wenig gastlichen Hause den Rücken zu kehren.
Professor da Costa hatte keinerlei Anstalten gemacht, tun einen anderen Zustand herbeizuführen. So blieb es bei gelegentlichen Besuchen und einem einmaligen Mittagessen im Hause des Onkels an jedem ersten Sonntag des Monats.
Viola machte sich wenig daraus. Sie war es gewohnt, auf sich allein gestellt zu bleiben und war auf den Verkehr mit Onkel und Tante nicht angewiesen. Reichlich entschädigt wurde sie außerdem durch die überaus freundliche Aufnahme, die sie in der Familie Colonna fand. Hier ging sie ein und aus, wie ein Kind, das zum Hause gehörte. Auf diese Weise hatte sich auch ihr immer herzlicher werdendes Verhältnis zu ihrem Verlobten angebahnt.
Was sie als einziges Kind, das die Eltern sehr früh verlor, lange hatte entbehren müssen, nämlich ein schönes Familienleben, — das fand sie hier. Es gab zwei Söhne und drei Töchter im Hause, die ihr alle in gleicher Herzlichkeit zugetan waren.
Deshalb fühlte sie sich hier sehr wohl. Deshalb war sie auch stets eine treue Mitarbeiterin des Speditionshauses Colonna geblieben.
Doktor Ricardi hatte versucht, ernsthaft zu arbeiten. Doch es gelang ihm nicht. Er fühlte sich sowohl körperlich wie auch geistig nicht auf der Höhe, was schließlich kein Wunder war, wenn man an den alkoholischen Exzeß dachte, den er sich gerade geleistet hatte. Das viele hastige Trinken hatte eine um so verheerendere Wirkung bei ihm getan, als er es eben gar nicht gewohnt war.
Sein Schädel brummte. Er fühlte sich matt und schwach. Dazu war er unlustig, mißgestimmt, ja, verzweifelt. Was er in sich hatte betäuben wollen, brach jetzt mit doppelter Gewalt wieder vor: die. Erkenntnis, daß er mit seiner Liebe zu Viola auf einem verlorenen Posten gestanden hatte. Ihre Verlobung mit dem jungen Doktor Colonna hatte ihn wie ein Schlag getroffen.
Man hatte ihn kurzerhand vor die vollendete Tatsache gestellt. Hätte ihm Viola das Bevorstehende nicht wenigstens schon einmal andeuten können? Täglich fast hatten sie sich getroffen, wenn er das Institut und sie das gegenüberliegende Speditionshaus betrat. Sie hatten gemeinsam gesegelt und Tennis gespielt. Bei den verschiedensten gesellschaftlichen Veranstaltungen trafen sie immer wieder zusammen. Er glaubte bereits in ausgiebigem Maße ihr Vertrauen und ihre Neigung gewonnen zu haben. Jedenfalls hatte er niemals den Eindruck gehabt, ihr irgendwie lästig zu sein. Im Gegenteil — er glaubte zu fühlen, daß sieine große Neigung zu ihr nicht ganz unerwidert blieb.
Angenehm war es freilich nicht, daß immer noch eine dritte Person zugegen sein mußte. Leona Bastinelli wich nicht von Violas Seite — die beiden Freundinnen schienen unzertrennlich zu sein. Manchmal empfand Francesco Ricardi geradezu einen Haß gegen Leona, nur weil sie da war, weil sie ihn mit Viola niemals allein lassen wollte. Er konnte nicht wissen, daß dies zwischen den beiden Mädchen verabredet war. Auch ahnte er nicht, daß es bei Leona noch einen anderen Grund hierfür gab.
Ricardi erhob sich von seinen Büchern, gab sich einige Augenblicke mit seinen Eidechsen ab und machte sich dann bereit, das Institut zu verlassen. Ein unwiderstehlicher Drang trieb ihn nach Pegli hinaus, — dorthin, wo er oft heimlich verweilt hatte, nur, um Viola nahe zu sein und vielleicht eine ‚zufällige’ Begegnung mit ihr herbeiführen zu können.
Auch jetzt, nachdem doch eigentlich alles vorüber war, zog es ihn dort hinaus. Es war eine Art Selbstquälerei, mit der sich unglücklich Liebende oft zu beladen pflegen.
Leise surrend glitt sein Zweisitzer über die glatt asphaltierte Straße hin, zwischen blühenden Gärten und herrlichen Villen, die zum Teil einen schloßartigen Eindruck machten. Von Zeit zu Zeit bot sich zwischen den Häusern hindurch von der erhöhten Straße herunter ein Blick auf die See, die um diese Zeit etwas bewegt war. Die weißen Schaumkronen der Wellen unterbrachen, angenehm für das Auge, das sonst fast zu eintönige Blau der Flut.
Tausend berauschende Düfte wehten dem einsamen Fahrer entgegen.
In Pegli ließ er den Wagen auf einem Parkplatz stehen und schritt zu Fuß einen Weg entlang, der ihn in die Nähe Violas brachte. Verstohlen schlich er um das Häuschen herum, um sie vielleicht zu erblicken.
Plötzlich stand Leona vor ihm.
Der Arzt, der den Totenschein für Viola ausgestellt hatte, Doktor Viano, sprach mit einem Kollegen über den seltsamen Fall. Eigentlich — meinte er — sei dieser rasche tödliche Verlauf einer einfachen Grippe kaum zu erklären.
Der Kollege gab zu bedenken, ob denn die Diagnose auch richtig gewesen sei?
Doktor Viano schilderte ihm den Befund. „Ich habe nichts weiter entdecken können. Glauben Sie mir — — ich habe sie sehr gewissenhaft untersucht.”
„Herzlähmung — sagten Sie?”
„Ja.”
„Sonderbar. Vielleicht wäre es gut gewesen, eine Blutprobe abzunehmen.”
„Warum?”
„Hm. Mir sieht die Geschichte eher nach einer Vergiftung aus, — das heißt, so weit ich die Angelegenheit nach Ihrer Schilderung beurteilen kann. Gibt es wohl eine Möglichkeit, die Tote noch einmal zu untersuchen?”
„Kaum. Was sollte das auch für einen Zweck haben? Zweifeln Sie meine Feststellung an?” Viano warf seinem Kollegen einen mißtrauischen Blick zu.
„Nein — ich bitte Sie! Aber Sie wissen ja, wie ich mich gerade für außergewöhnliche Fälle interessiere.”
„Deshalb habe ich Ihnen diesen auch mitgeteilt.”
„Also! Dann werden Sie wohl begreifen, daß ich die Tote noch sehen möchte.”
„Ich müßte mit dem Professor sprechen.”
„Mit welchem Professor?”
„Da Costa. Er ist ein Onkel des Mädchens, der einzige nähere Verwandte, soviel ich weiß. Der Fall ist auch deshalb besonders tragisch, weil sich die junge Dame gerade zwei Tage vorher verlobt hatte.”
„Kennen Sie den Verlobten?”
„Nein. Es ist ein junger Kollege, Schiffsarzt, der sich zur Zeit gar nicht hier befindet.”
„Traurig für ihn. Hm. Also, ich wäre Ihnen sehr dankbar, Kollege, wenn Sie es mir ermöglichen könnten — — —”
„Ich werde mit dem Professor reden.”