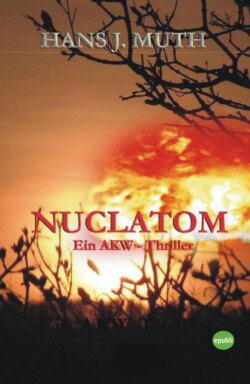Читать книгу Nuclatom - Hans J Muth - Страница 8
1. Kapitel
ОглавлениеDie Zeit danach/Stadtklinik
Ich werde sterben.
Das ist eine Tatsache, die unausweichlich ist, an der kein Sterblicher etwas ändern kann. Sie werden wahrscheinlich angesichts dieser für Sie dilettantischen Aussage geneigt sein, das gerade begonnene Buch mit einer Geste des Unverständnisses enttäuscht beiseite zu legen. Denn sterben, das tun wir schließlich alle, irgendwann.
Doch tun Sie es nicht, denn es ist nicht der lapidare Versuch, das Interesse in Ihnen wecken zu wollen, Sie weiter an die folgenden Zeilen zu fesseln.
Ich werde sterben, schon bald.
Bevor Sie meine Aussage nun tatsächlich zum Anlass nehmen, endgültig zu einem anderen Buch zu greifen, werde ich Ihnen den Grund offenbaren:
Ich bin verstrahlt.
Ja, Sie lesen richtig. Verstrahlt. Atomar verstrahlt. Mein baldiges Dahinscheiden beruht auf dem Versagen von Menschen, denen Macht und Geld vor der Sicherheit ihrer Spezies steht. Ich bin verseucht durch nukleare Energie. Obwohl, wenn ich es mir so überlege, Energie, bezogen auf meine Person, ist in diesem Zusammenhang der falsche Ausdruck. Was mich betrifft, ist Energie ein Zustand, der schon lange meinen Körper verlassen hat. Wobei auch der Begriff Zeit, bezogen auf meinen Zustand und meine Hilflosigkeit, als relativ eingestuft werden muss.
Die Ärzte sagen, dass ich vor zwei Monaten eingeliefert wurde. Ich selbst kann mich kaum daran erinnern. Irgendwann vor ewiger Zeit, die man in medizinischen Kreisen wohl Koma nennt, verließen meine Gedanken das Dunkel und mithilfe der Ärzte und des Pflegepersonals schleicht sich die Erinnerung wieder mühsam und zaghaft in meine Gehirnwindungen.
Ich weiß nicht, wie lange ich heute geschlafen habe, drei, vier Stunden oder mehr. Ist auch egal. Ich öffne meine Augen, deren Lider den Befehlen meines Gehirns zunehmend weniger zu gehorchen scheinen und warte, bis sich der Schleier vor meinen Augen langsam verflüchtigt.
Die Zimmerdecke und zwei unter Reflektoren versteckte Neonröhren sind das Erste, was sich jeweils beim Öffnen meiner Augen in ihren Blickwinkel drängt. Ich rolle meinen Kopf langsam mühevoll zur rechten Seite und blicke zur Tür, erkenne einen Schrank daneben, einen Nachttisch dicht neben meinem Bett, auf dem eine Flasche Wasser und ein Glas stehen und verspüre angesichts der Flüssigkeit den Drang, meine Kehle zu befeuchten. Das kühle Nass lindert meine Schmerzen im Hals, zumindest für kurze Zeit und auch nur dann, wenn sich einer der Pflegekräfte bemüht, mir das Glas an den Mund zu setzen.
Meine Arme liegen an meinem Körper entlang. Ich bewege die Finger. Sie gehorchen problemlos. Mein Schlafanzug, oder das, was ich dafür halte, bedeckt meine Arme und lässt nur eine Sicht auf meine Hände zu. Ich sehe kurz hin und schließe die Augen sofort wieder. Auf meinen Handrücken sehe ich, seit meine Erinnerung zurückkehrte, meine Zukunft. Ich wage mir nicht vorzustellen, was sich auf der Oberfläche meiner restlichen Haut abspielt.
Seit meiner Einlieferung habe ich keine Gelegenheit, in einen Spiegel zu sehen. Aber, um ehrlich zu sein, hatte ich bisher nicht das geringste Bedürfnis, nach einem solchen zu verlangen.
Mein Blick saugt sich an meinen Händen fest. Die roten Flecken, mit denen die Haut übersät ist, beginnen aufzubrechen. Glänzende Reste von irgendwelchen Cremes verstärken den Eindruck, der selbst auf mich abstoßend wirkt. Sie bekommen den Fortschritt der Krankheit nicht in den Griff.
Krankheit? Was rede ich? Es ist doch keine Krankheit. Es ist ein Siechtum, das muss ich akzeptieren, muss mit ihm leben, mich mit ihm anfreunden in den letzten Tagen, die mir noch bleiben.
In etwa zwei Wochen werde ich tot sein. Das versuchen die Ärzte mir so schonend wie möglich beizubringen, abwechselnd und scheu wie Kinder, die sich eines schlechten Gewissens bewusst sind. Das Einzige, das sie für mich tun können, ist das Verabreichen der Jod-Tabletten in regelmäßigen Abständen und das Wechseln der Verbände, dort, wo die Haut die Körperflüssigkeit nicht mehr zurückhalten kann. Die Pillen verlängern mein nicht lebenswertes Dasein unwesentlich, denn gegen radioaktive Strahlung schützt grundsätzlich kein Medikament.
In wenigen Minuten ist Visite. Ich sehe bereits jetzt schon die mitleidvollen Mienen der hereinschwebenden Weißkittel, von denen sich einige zurückhalten, obwohl sie wissen, dass meine so genannte Krankheit nicht ansteckend ist. Ich glaube, sie sind überfordert. Überfordert wie auch die meisten derjenigen, die mit der Sicherung und der Handhabung einer solchen Gefahrenstelle, die für meinen Zustand verantwortlich ist, betraut sind.
Überfordert wie die Behörden, die nicht einmal über konkrete Alarmpläne verfügen. Niemand, absolut niemand scheint je damit gerechnet zu haben, dass es in der Region jemals zu einem Super-Gau, das ist die genaue Bezeichnung für einen Vorfall in einem Atomkraftwerk, um das theoretische Szenario des vollständigen Abrisses einer Hauptkühlmittelleitung am Reaktordruckbehälter kommen könnte.
Wenn ich ehrlich bin, auch ich hatte nie einen Gedanken an einen solchen Vorfall verschwendet. Neben dem durch die Explosion ausgelösten Schock war es auch ein Teil Überraschung, der von mir Besitz ergriffen hatte, bevor hochradioaktiver Schutt auf das Kraftwerksgelände und damit auf mich und meine Kollegen geschleudert wurde.
Die Ärzte sagen, bei der Höhe meiner Verstrahlung spreche man von einer des dritten Grades, der höchsten Kontamination überhaupt. Flüssigkeitsabsonderungen und Absterben der Haut seien die Folge, sagen sie, während sie meine sich lösende Haut mit getränkten Verbänden belegen. Meine Schweißdrüsen und die Haarbälge seien irreparabel geschädigt, so wie mein gesamter Organismus, mit dem es schon bald zu Ende gehen werde. Nur mein Wille zu leben könne die Prozedur um wenige Tage verlängern.
Ich habe lange darüber nachgedacht. Darüber, ob ich mich aufgeben soll, weil ich mein Siechtum dadurch verkürze oder ob ich kämpfen soll wie Don Quichotte gegen die unbesiegbaren imaginären Gegner. Mein Gegner ist ebenfalls unbesiegbar. Aber er ist nicht imaginär. Er ist Wirklichkeit, er ist in mir drin, ich beherberge ihn, teile mein Leben mit ihm bis in den Tod.
Ich denke auch darüber nach, warum das alles passieren konnte und komme schnell zu dem Ergebnis: Weil es da ist. Nein, weil es da war. Und weil es noch viele Male passieren kann, weil sie da sind, zahlreich da sind, die Kernkraftwerke in unserem Lande und dem angrenzenden Ausland. Sie sind angeblich sicher, wahrscheinlich sind sie das auch. Ich glaube das beurteilen zu können, denn ich bin vom Fach.
Da fällt mir ein: Ich war vom Fach. Ich arbeitete bis zu dem Störfall der höchsten Kategorie in einem Kraftwerk. Nicht in Deutschland, obwohl ich hier lebe und seit einiger Zeit in meinem Heimatland dahinvegetiere. Ich bin Ingenieur, genauer gesagt, ich war Nuklearingenieur im französischen AKW Nuclatom, als Mitglied einer deutschen Firma mit einem Zeitvertrag betraut. Ich war hauptverantwortlich für das Ressort Nuklearwissenschaft im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Kontrolle und dem Nutzen von Kernenergie sowie dem Entsorgen radioaktiver Abfälle. Abfälle gibt es nun wahrlich in großen Mengen zu entsorgen, doch ich werde dabei nicht mehr behilflich sein können.
Einen der vier Reaktoren des AKW Nuclatom gibt es nicht mehr!
Ich denke an die armen und hilflosen Menschen in der kleinen Stadt, unmittelbar neben den strahlenden Reaktoren. Ihnen wird es nicht viel anders als mir ergangen sein. Vermutlich sind die Krankenhäuser voll von ihnen. Vorübergehend. In wenigen Wochen werden nach und nach die Betten frei werden.
Doch Frankreich hat aufgerüstet. Weitere 54 Nuklearanlagen stehen im Land verteilt. Ich wage nicht zu beurteilen, ob sich der Fall Nuclatom wiederholen könnte. Ich weiß nur eines: Die Zeit die mir noch bleibt, werde ich nutzen, soweit es mir möglich ist, um aufzuklären, zu warnen. Wie, das weiß ich noch nicht. Eines aber weiß ich: Nie wieder darf sich das wiederholen, was unzählige Menschen ins Unglück gestürzt hat.
Meine Gedanken werden unterbrochen. Das weiße Geschwader schwebt in mein Krankenzimmer, die Jüngeren der insgesamt vier Weißkittel bleiben an der Tür stehen, während der Oberarzt und eine Krankenschwester sich meinem Bett nähern. Die Schwester trägt Latex-Handschuhe und einen Mundschutz. Ihre Augen flackern. Dr. Maximilian Bollinger, so steht auf dem Namensschild geschrieben, zieht sich einen Stuhl heran und setzt sich vor mich.
„Wie fühlen Sie sich?"
Er sieht mich mit großen graublauen Augen väterlich an. Sein Alter schätze ich auf fünfzig, eher etwas weniger und mit meinen achtunddreißig Jahren hat sein väterlicher Ausdruck für mich etwas Kurioses.
„Was soll ich sagen?", antworte ich und frage mich, welche Antwort er auf seine Frage erwartet.
Er fasst meine Hand und hebt sie an. Dr. Bollinger trägt keinen Mundschutz und er hat auch keine Handschuhe übergestreift. Das macht ihn mir sympathisch.
„Sie denken viel nach, habe ich Recht?"
Bollinger sieht mich erwartungsvoll an und bevor ich antworten kann, fährt er fort: „Sie sollten Ihre … Zeit nicht damit verschwenden."
„Was?"
Ich verstehe seine Bemerkung nicht.
„Welche Zeit? Sie sagten mir, in zwei Wochen oder …"
„An dieser Meinung hat sich auch nichts geändert, Herr Westermann“, antwortet Bollinger, ohne sein väterliches Lächeln zu verlieren.
Zum ersten Mal höre ich seit langem wieder einmal meinen Namen. Westermann. Jakob Westermann. Meine Freunde und Bekannten nennen mich Jerry, der amerikanischen Übersetzung von Jakob wegen.
Ich bin seit einiger Zeit wieder Junggeselle und heute danke ich Gott dafür. Nicht, dass ich froh darüber wäre. Dass Christine mich verlassen hat, was ich einerseits bedaure, war für sie eine Gottesfügung. Und meine neue Liebe? Ich versuche krampfhaft, mir ihr Gesicht vorzustellen. Offensichtlich habe ich Gedächtnislücken. Wie auch immer. Sie würde von dem Unfall erfahren und keinen Gedanken mehr an mich verschwenden. Es ist gut so, wie es ist. So kämpfe ich alleine gegen die Krankheit und mich selbst, meinen inneren Schweinehund, wie sich der Volksmund auszudrücken pflegt.
„Dennoch sollten Sie die Zeit sinnvoll nutzen", höre ich Dr. Bollinger sagen.
Ich sehe ihn an. Sein Gesichtsausdruck hat sich nicht verändert. Er scheint zu meinen, was er sagt. Ich habe nicht den Eindruck, dass er mich hochnehmen will.
„Sagen Sie mir bitte, was ich in meiner Situation Sinnvolles tun kann?", krächze ich und ein Hustenkrampf schüttelt mich. Ich zeige auf die Flasche auf dem Nachttisch. Die Schwester eilt herbei und wird durch eine Handbewegung Bollingers gestoppt. Er nimmt die Flasche, gießt ein halbes Glas voll mit der Flüssigkeit und hält es mir hin. Ich sehe ihn fragend an.
„Versuchen Sie es. Mobilisieren Sie Ihren Willen, Jerry! Ich darf Sie doch so nennen?"
Ich nicke und hebe langsam meine rechte Hand. An ihr scheint ein schweres Gewicht festgebunden zu sein. Der Arzt schaut mir in die Augen, immer noch lächelnd. Ich merke, wie ich zu schwitzen beginne. Mein Unterarm hebt sich, dann fällt er zurück auf das Bett, neben meinen dahinsiechenden Körper.
„Das ist gut. Sie haben es versucht", sagt Dr. Bollinger und führt mir das Glas an die Lippen. Ich trinke gierig. „Mehr habe ich nicht erwartet", lächelt er. „Sie haben noch Energie. Nutzen Sie sie."
„Ich verstehe Sie immer noch nicht", flüstere ich und merke, wie Müdigkeit über mir hereinbricht. Sollen Sie doch gehen und mich allein lassen.
„Sie sollten alles aufschreiben“, höre ich den Doc sagen und kämpfe dagegen an, dass mir die Augenlider zufallen. „Das, was Sie erlebt haben, was geschehen ist. Schreiben Sie es auf. Schreiben Sie es für die Menschen auf, damit sie niemals vergessen, warum sie für ihre Ziele kämpfen. Es reicht nicht, dass Schilder mit dem Slogan „Atomkraft nein danke" hochgehalten oder auf Autohecks geklebt werden. Jetzt, da es passiert ist, muss es sich in das Gewissen all derer einbrennen, die Verantwortung tragen und in die Herzen jener, die von dieser Verantwortung abhängig sind. Wenn Sie es jetzt niederschreiben, ist es wie eine Aufforderung zum Kampf, eine Aufforderung zum Widerstand. Tun Sie es! Der Zukunft zuliebe."
Bollinger lächelt nicht mehr. Sein Gesicht ist ernst, seine Miene fordernd.
„Schreiben Sie!", wiederholt er sich und noch einmal: „Schreiben Sie alles auf!"
„Wie soll das gehen?“, frage ich kraftlos und denke darüber nach, dass mir bereits Ähnliches in den Sinn gekommen war.
Bollinger erhebt sich. Als er in seiner ganzen Größe vor mir steht, nickt er, als habe er eingesehen, dass es keinen Sinn hat. Doch ich habe mich getäuscht.
„Ich werde Ihnen alles besorgen: Ein Diktiergerät, ein Headset mit Mikrofon und eine Fernbedienung. Sie werden sehen, Sie werden Freude an Ihrer zukünftigen Arbeit haben."
Während ich langsam in den Schlaf hinüber dämmere, interessiert mich nur noch eines. Ich nehme alle meine Kraft zusammen und hauche ihm entgegen: „Warum wollen Sie unbedingt, dass ich das tue?"
„Wie aus weiter Ferne höre ich die stockende Antwort, die gemeinsam mit mir ins Reich der Träume dahinschwebt:
„Meine Frau … sie ist heute Morgen an den Folgen der Kontaminierung gestorben."