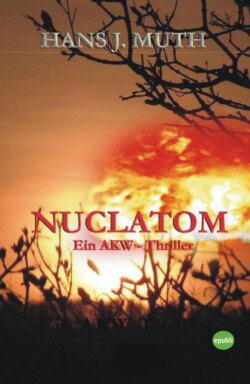Читать книгу Nuclatom - Hans J Muth - Страница 9
2. Kapitel
ОглавлениеDie Zeit davor/Felix
Der Himmel erstrahlte in einem Blau, wie ich es in diesem Sommer selten so erlebt habe. Die weißen, mit Grau durchzogenen Wolkenpartikel gaben dem Gesamtbild über mir etwas von einer Polarisierung, wie es Fototechnik kaum besser würde ausdrücken können.
Ich schaute hinauf in diese Pracht der Unendlichkeit. Es fiel mir nicht schwer, regungslos, über einen längeren Zeitraum, den Blick nach oben gerichtet zu halten. Ich lag auf meiner Sonnenliege, auf dem Balkon der vierten Etage in der Stadt, unter mir das Brummen und Hupen der Fahrzeuge, über mir die Ruhe des unendlichen Weltalls. Ein Kontrast, wie er unterschiedlicher nicht sein konnte. Die Wohnung in der Innenstadt konnte ich mir leisten, mein Beruf machte es möglich und außerdem hatte ich nach niemandem zu fragen.
Noch eine knappe Woche, dann würde mein Urlaub vorbei sein, so vorbei, wie meine Beziehung zu Christine, die mich vor wenigen Tagen verlassen hatte. Die Trennung kam nicht plötzlich, nicht spontan aus einem unmittelbaren Grund heraus. Sie hatte sich lange angebahnt und es war nur eine Frage der Zeit gewesen, wann Christine für sich feststellte, dass mir meine Arbeit mehr bedeutete, als ein Zusammenleben mit ihr, so, wie sie es sich sicherlich erhofft hatte.
Auch für mich war diese Beziehung in meinem Inneren schon längere Zeit beendet. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es zu einer Trennung kommen sollte. Außerdem war da eine andere Frau. Christine wusste nichts von ihr und ich selbst war von dieser neuen Beziehung mehr als überrascht. Es hatte sich ergeben, einfach so, im Werk, im Anschluss an irgendeine dienstliche Zusammenarbeit.
Ich starrte weiter auf den blauen Himmel und begann, die Geschwindigkeit zu schätzen, mit der sich die Wolken bewegten. Der Wind, heute ging eine leichte lauwarme Brise, kam von Westen und trieb die Wolken kaum sichtbar für meine Augen vor sich her.
Der Wind kommt immer von Westen, dachte ich für mich. Auch der Regen. Das schlechte Wetter. Immer kommt es aus dem Westen. Wir Grenzbewohner sagen deshalb scherzhaft: Die Franzosen schieben das Wetter, das ihnen nicht gefällt, über die Grenze zu uns herüber. Heute war das nicht so. Über den leichten Wind, der von Westen herüberweht, konnte ich mich durchaus erfreuen.
In der Ferne, am Ende des westlichen Horizonts hatte sich eine Wolke gebildet, die anders war, als die, die über mir schwebten und einen Kontrast zu dem blauen Himmel bildeten. Die Wolken dort waren künstlicher Natur. Ich wusste das und konnte das auch begründen. Schließlich war ich in den meisten Fällen an ihrer Kreation beteiligt. Nur nicht heute. Heute hatte ich Urlaub. Aber wenn ich zur Arbeit ging, wenn ich im Kernkraftwerk Nuclatom hinter der Grenze meinem verantwortungsvollen Job nachging, dann war ich daran beteiligt.
Die Grundbezeichnung meines Jobs war Ingenieur, speziell für meinen Einsatzbereich war meine Berufsbezeichnung Nuklear Ingenieur. Ein verantwortungsvoller Job, wie ich schon sagte. Ich war verantwortlich im Bereich Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Nukleartechnik und hauptverantwortlich für das Ressort Nuklearwissenschaft im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Kontrolle und dem Nutzen von Kernenergie sowie dem Entsorgen radioaktiver Abfälle. Und ich war Mitproduzent dieser Wolken, die man Kilometer weit sehen konnte, ohne das darunter befindliche Atomkraftwerk in Augenschein zu bekommen.
Die Bevölkerung sah stets mit gemischten Gefühlen zu dem künstlichen Wassergebilde hin, obwohl man von Seiten der Kraftwerks-Direktion und auch der Politik nicht müde wurde zu erklären, dass dieser Wasserdampf ungefährlich für Mensch und Tier sei. Ich musste stets lächeln bei diesen Bekenntnissen und manche Diskussion, die ich entfachte, machte mich, zumindest für eine Zeitlang, zu einem Außenseiter, dem man zu verstehen gab, dass es Folgen haben würde, beschmutzte man das eigene Nest.
Wenn alles seinen geregelten Gang ging, war es auch tatsächlich so, dass keine Gefahr von der Wolke, die im Hintergrund inzwischen an Volumen leicht zugenommen hatte, ausging. Kühltürme sind normalerweise Bestandteile der Anlagen, die für die Bereitstellung des so genannten Kühlwassers für die Prozesskühlung erforderlich sind. In der Regel befinden sich Kühlwasser und Kühlturm in einem eigenen geschlossenen thermodynamischen Kreisprozess.
Ich sagte: normalerweise. Aber ich finde, Normalität darf man nicht in Projekten wie diesen suchen. Atomare Kraftwerke reagieren nach besonderen Regeln. Natürlich auch nach denen der Physik und der Chemie und diese Gesetzmäßigkeiten hat der Mensch auch im Griff … wenn alles so verläuft, wie es sich der Mensch, sprich Betreiber, vorstellt. Wenn allerdings Einflüsse von außen dafür sorgen, dass die Paragraphen der Gesetzmäßigkeit durcheinandergewirbelt werden, ist meist jede Zeit zu kurz, wieder Ordnung in dem Gefüge zu schaffen. Dann werden auch für einen gewissen Zeitraum die Gesetze der Physik und der Chemie in andere Bahnen gelenkt und nicht immer ist der Mensch in der Lage, diesen Bahnen zu folgen oder das Geschehene in Bahnen zu lenken, die seiner Vorstellung entsprechen.
Sie werden sich fragen, warum ich als Deutscher in einem französischen Atomkraftwerk arbeitete, wo die Kapazität dieser monströsen Errungenschaften im eigenen Land wahrlich nicht unerheblich ist. Der Grund ist einfach zu erklären. Im Kraftwerk Nuclatom waren neben den etwa 1150 Beschäftigten auch Fremdfirmen beschäftigt, wobei die Zahl der Beschäftigten auf rund 2000 angestiegen ist. Ich war ein Angestellter einer dieser Fremdfirmen und man hatte mir einen befristeten Arbeitsvertrag über fünf Jahre angeboten, den ich aus finanzieller Sicht nicht ausschlagen konnte.
Ich griff nach der Sonnenlotion, die ich neben mir auf dem Betonboden des Balkons abgestellt hatte und gab etwas davon auf meine linke Handfläche. Während ich die flüssige Creme in die Haut meiner Beine einmassierte, läutete das Telefon. Ich griff nach dem Handtuch über der Lehne des Liegestuhls und trocknete meine Hände. Ich hielt mein Smartphone ans Ohr und meldete mich.
„Hi, Jerry", tönte es mir entgegen. „Störe ich deine traute Zweisamkeit?"
Die Stimme gehörte Felix Hormeyer, einem Kollegen von mir, der zurzeit vermutlich meine Arbeit in Nuclatom mit verrichtete.
„Hallo, Felix", wie geht's?", antwortete ich mit einer Gegenfrage. Es war mir nicht danach, mich über die noch frisch gebrochene Beziehung mit Christine auszulassen. „Möchtest du auf einen Schluck vorbeikommen?"
„Na, na. Schau mal auf die Uhr. Ach ja, du bist ja im Urlaub. Da verliert man das Zeitgefühl."
Tatsächlich. Es war drei Uhr nachmittags und Felix war offensichtlich noch im Werk.
„Was gibt es denn? Probleme?"
Ich hörte, wie Felix die Luft einsog.
„Ich muss dich unbedingt sprechen. Da ist etwas Großes im Gang."
„Was meinst du damit: Etwas Großes? Und vor allem: Wo ist etwas im Gang. So rede doch!"
„Da läuft etwas in unserem Werk“, flüsterte er. „Ich glaube, ich habe auch Beweise dafür."
Er meinte offensichtlich das AKW Nuclatom. Unser Werk. Wenn wir über unsere Arbeitsstelle redeten, sprachen wir immer von unserem Werk. Doch was meinte er?
„Felix, was ist los? Ich verstehe nicht, was du meinst. Kannst du nicht deutlicher werden?"
„Nein, nicht am Telefon", antwortete Felix aufgeregt. Ich kann in einer halben Stunde bei dir sein. Ist das okay?"
Es war okay. Natürlich war es das. Ich klappte den Liegestuhl zusammen und stellte ihn an der Außenwand des Balkons an. Mit einem letzten Blick auf die inzwischen angewachsene Wolke am Horizont schloss ich die Balkontür und begab mich unter die Dusche.
Ich überlegte. Wenn Felix mit mir über das Werk reden wollte, dann hatte er triftige Gründe. Felix war keiner von denen, die sich an Belanglosigkeiten hochzogen.
Ich drehte den Wasserhahn ab, band mir ein Badetuch um und schaltete den Fernseher im Wohnzimmer an. NTV, die Nachrichten. Alles andere als das, was ich dort sah, hätte mich auch gewundert.
Während die Nachrichtensprecherin Geschehnisse aus aller Welt über den Äther hauchte, drehte der Ticker seine unermüdlichen Kreise. „Erneuter Störfall im Atomkraftwerk Nuclatom Gefahr für die Bevölkerung? Verantwortliche schweigen Politik verweigert Statements Gefahr für die Bevölkerung? ..."
Ich wartete nicht darauf, dass die Nachrichtensprecherin mit süffisanter Art die Nachricht verkünden würde, sondern schaltete den Fernseher aus. Felix würde mir berichten, was zurzeit dort abging. Was er mir sagte, würde für mich und meine Meinungsbildung von Bedeutung sein, nicht aber eine Nachrichtensendung.
Ich ging wieder nach draußen, auf den Balkon und sah hinab. Die Ampel an der Straße, in der ich meine Wohnung bezogen hatte, war auf Rot geschaltet. Das zweite Auto in der Reihe der wartenden Schlange gehörte Felix. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er sich an der Sprechanlage melden würde.
Während ich mich ankleidete, drückte ich auf die Protokolltaste meines Smartphones, um es nach weiteren eingegangenen Anrufen zu überprüfen. Keine Einträge, keine privaten, aber auch keine meiner Arbeitsstelle. Also konnte es nicht so schlimm sein, wie es schon wieder in den Medien breitgetreten wurde. Bislang hatte man mich bei Störungen, gleich welcher Art, stets hinzugezogen. Da machte es auch keinen Unterschied, ob ich mich gerade im Urlaub befand oder zuhause meine Beine auf den Tisch legte.
Ich legte das Handy beiseite und kleidete mich fertig an. Felix musste jeden Moment die Klingel betätigen. Ich ging zum Fenster und sah nach unten auf die Straße. Im Kreuzungsbereich bewegten sich Menschen wie Ameisen. Die meisten standen, andere liefen hin und her, einige telefonierten.
Ein Unfall, dachte ich und suchte mit den Augen die Unfallstelle ab. Keine Unfallautos. Mein Interesse stieg und ich starrte auf den Punkt, auf den sich das Interesse der Menge konzentrierte. Ich konnte es nicht genau erkennen, aber ich glaubte drei Personen zu sehen, die sich offenbar um einen Verletzten kümmerten.
Felix hatte immer noch nicht an der Tür geläutet. Vermutlich hatte er dort unten seine Hilfe angeboten. So war er. Felix hatte ein gutes Herz und wenn es zu helfen galt, dann tat er es. Sein Freundeskreis war entsprechend groß, man hatte seine gute Seele erkannt.
Ich steckte mein Smartphone in meine Hosentasche, schnappte den Wohnungsschlüssel und warf die Eingangstür hinter mir zu. Auf den Aufzug verzichtete ich. Die Stufen der vier Etagen bedeuteten für mich kein großes Problem und einige Minuten später stand ich unten und ging auf die Menge zu. In der Ferne hörte ich Sirenen von Polizei oder Krankenwagen. Oder von beiden.
Als ich mir einen Weg durch die Menge gebahnt hatte, traf mich fast der Schlag. Es war Felix, der dort lag, von Helfern in eine stabile Seitenlage gebracht. Ich sah, dass er atmete.
Er lebte.
Ein Arm hielt mich fest.
„Bleiben Sie weg! Der Krankenwagen ist unterwegs."
Ich wehrte den Mann ab, einen schlanken Zwanziger mit Brille und wichtigem Gesicht.
„Er ist … er ist mein Bruder", log ich und kniete kurz darauf neben Felix.
„Ich bin es, Jerry", flüsterte ich und berührte vorsichtig seine Schulter. „Der Krankenwagen kommt gleich. Du kommst wieder in Ordnung."
Felix drehte den Kopf ein wenig zu mir und ich sah, dass die Gesichtshälfte, unter die man eine gefaltete Sommerjacke gelegt hatte, blutverschmiert war. Verletzungen unter seiner Kleidung konnte man nur erahnen. Für mich war klar: Felix war von einem Auto angefahren worden. Ich sah hoch zu dem jungen Mann, der nun neben uns stand.
„Der Unfallverursacher?"
Er zuckte mit der Schulter. „Unfallflucht. Es gibt Zeugen."
Ich wandte mich wieder Felix zu, der mich mit weit aufgerissenen Augen anstarrte. Seine Lippen bewegten sich lautlos.
„Bitte, streng dich nicht an, Felix", versuchte ich auf ihn einzureden. „Der Krankenwagen muss jeden Moment hier sein."
Seine Lippen bewegten sich weiter und in seinen Augen bemerkte ich etwas Flehendes. Ich beugte mich zu ihm hinunter und mein Kopf befand sich neben seinem.
„Sabotage", entnahm ich seinem stockenden Flüstern. Er wiederholte es „Sabotage. Du ... musst ... sei vorsichtig."
Seine Stimme verebbte, die Lider seiner Augen flackerten kurz und zogen sich bis auf einen Spalt zusammen. Er atmete nicht mehr.
„Gehen Sie zur Seite, Lassen Sie uns durch!", hörte ich eine energische Stimme. Ich wurde beiseitegedrängt und Sanitäter begannen mit der Reanimation. Benommen schlich ich davon und fand mich kurze Zeit wieder in meiner Wohnung. An den Weg dorthin konnte ich mich nicht mehr erinnern, so tief saßen die Gedanken um Felix und seine letzten Worte: „Sabotage". Was bedeutete das? Was wollte er mir damit sagen? Was meinte er damit, ich solle vorsichtig sein?
Ich sah zum Fenster hinaus und sah den Rettungswagen davonfahren. Ein Polizeiwagen stand in unmittelbarer Nähe des Unfallbereichs. Ein Leichenwagen bahnte sich den Weg durch die inzwischen größer gewordene Ansammlung von Menschen.
„Es war kein Unfall, Felix", sagte ich leise vor mich hin, während ich beobachtete, sie meinen Mitarbeiter in einen Zinksarg legten und ihn im Leichenwagen verstauten. „Sie haben dich vorsätzlich überfahren. Die Unfallflucht im rechtlichen Sinne war nur vorgetäuscht. Es war Mord. Kaltblütiger Mord. Was wusstest du, Felix, das du nicht wissen solltest?"
Ich fühlte mich leer, ausgebrannt, mit der derzeitigen Situation überfordert. Was meinte Felix nur mit seinen letzten Worten? Als ich den Leichenwagen davonfahren sah, lief es mir kalt den Rücken herunter. Dann verstand ich plötzlich. Felix wollte mich warnen. „Sei vorsichtig", waren seine letzten Worte. Das konnte vieles bedeuten. War man hinter mir her? Versuchte man auch mich umzubringen. Oder meinte Felix mit vorsichtig, ich solle an meinem Arbeitsplatz die Augen offenhalten? Ich würde es selbst herausfinden müssen.
Langsam leerte sich der Platz unten auf der Kreuzung und der Verkehr begann sich wieder zu normalisieren. Es war, als wollte ich Felix ein Versprechen hinterherrufen, als ich vor mich hin flüsterte: „Leb wohl, mein Freund, du bist nicht umsonst gestorben, das verspreche ich dir. Ich werde herausfinden, warum man dir das angetan hat."