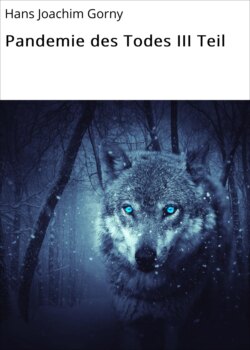Читать книгу Pandemie des Todes III Teil - Hans Joachim Gorny - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Emmer
ОглавлениеDie Getreidefelder sehen schlimm aus. Auch das Maisfeld. Die größte aller gemeinsamen Mähaktionen startet, um die befallenen Pflanzen möglichst schnell zu beseitigen. Zwei Mähmaschinen sind von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang beschäftigt, die ziehenden Pferde müssen mehrmals am Tag gewechselt werden. Dann geht auch noch eine der beiden Maschinen kaputt. Die Männer greifen zu Handsensen. So mancher hat Tränen in den Augen. Die nun heiße Julisonne trocknet das Getreide innerhalb eines Tages. Danach wird es in aller Eile auf den Feldern verbrannt, damit es zumindest noch wertvollen Dünger liefert.
Und die Angst geht um. Bitte nicht auch noch die Kartoffeln, denken viele. Jedem wird täglich bewusster, wie sehr seine Existenz auf Getreide und Kartoffeln basiert. So schnell wie möglich pflügt die Gemeinschaft die Äcker um. Fast schon panikartig wird nachgesät. Vielleicht schaffen es Linsen und Sojabohnen noch, bis Ende des Jahres zu reifen. Auch die Gärten werden erweitert, für Wintergemüse.
Carlina hat jeden Sonntagmorgen eine volle Kirche. Sie versucht Trost zu spenden und Hoffnung zu verbreiten. Aber Getreide und Brot kann sie nicht herbeireden. Tagelang wird der Bevölkerung vorenthalten, dass nach der Vollversammlung, aus Vernunftgründen, die Lagerhalle geschlossen bleibt, kein Getreide mehr ausgegeben wird. Nachdem die Feldarbeiten abgeschlossen sind, muss Carlina blank ziehen. Es kommt zur längst fälligen Krisensitzung.
Sie gibt einen Lagebericht, erklärt wie die Sporen entstehen, dass der Wind sie überall hin verbreitet. Und, dass es sich um einen unbekannten Schimmelpilz handelt, der in keinem Buch zu finden ist. Deshalb hätten sie auch keine Ahnung, wie er bekämpft werden kann. Dann spricht sie den entscheidenden Satz.
„So leid es uns tut, aber wir können kein Getreide mehr ausgeben.“ Sofort wird die Vollversammlung unruhig. „Das was wir noch haben, muss für die Aussaat zweier Jahre reichen“, sagt sie ungewohnt laut über das Stimmengewirr hinweg. „Es wäre unvernünftig, wenn wir alles Getreide aufessen würden. Wir sind auf die Körner angewiesen. Keine Körner, keine Getreidefelder.“
„Und wenn das Getreide nächstes Jahr wieder verfault“, ruft jemand, „war das Sparen für die Katz und wir haben immer noch kein Brot.“
Auch Kim, die Oberärztin, ist anwesend. „Sollen die Kranken auf Brot verzichten? Das kann doch nicht euer Ernst sein.“
„Habt ihr mal daran gedacht“, schimpft eine Frau in Richtung Rat, „dass Hühner Körner picken. Wenn die nur Grünes bekommen, schmecken die Eier nicht mehr.“
Jemand sehr erboster ruft: „Kann ein Pferd überhaupt ohne Hafer leben? Wie stellt ihr euch das vor?“
Grissly schimpft dagegen: „Wenn ich ohne Brot leben muss, kann ich von meinem Pferd verlangen, dass es ohne Hafer auskommt.“
Ein Landwirt, der sehr viel Getreide anbaut, steht auf. „Ich bin dafür, unser Getreide zu verbrauchen und für die Aussaat nächstes Jahr neues einzutauschen oder zu kaufen. Wer schließt sich mir an?“ Aufmunternd schaut er im Sportheim umher. Doch die Leute zögern.
Carlina mischt sich ein. „Wir wissen überhaupt nicht, wie weit diese Getreideseuche verbreitet ist. Auch deshalb wollen wir mit dem Verbrauch vorsichtig sein. Es ist natürlich jedem belassen auf den Märkten, bei Freunden und Bekannten Getreide und Mehl zu besorgen. Wir werden niemanden aufhalten. Aber unsere Vorräte bleiben unter Verschluss, bis sich wieder eine Perspektive auftut.“ Damit sind die Bäcker arbeitslos.
Nun reden die Leute nicht mehr von Schimmel und verfaulten Pflanzen, sondern nur noch von Getreideseuche.
Der experimentierfreudige Landwirt, der den Emmer anbaut, steht auf. „Mein Emmer ist ja nicht betroffen. Deshalb werde ich die Körner nicht verbrauchen und die komplette Ernte nächstes Jahr aussäen. Auch die werde ich nicht verbrauchen, sondern übernächstes Jahr wieder aussäen. Ich werde solange Körner sammeln, bis sie für alle reichen. Es sei denn, wir bekommen den Pilz in den Griff.“
„Das ist sehr vernünftig Ralf“, lobt Carlina. „Dafür sind wir dir sehr dankbar. Wir wollen nun aber nicht das Schlimmste befürchten.“
„Auf was können wir denn hoffen?“ ruft eine Frau. „Wie wollen wir aus dem Notstand herausfinden, wenn die Sporen praktisch überall sind?“
„Hoffnung gibt es“, sagt Carlina mit erhellter Stimme. „Wir bräuchten mal wieder einen richtig harten Winter. Ich kann mir vorstellen, dass die Sporen das nicht überleben. Sie scheinen mir sehr wärmeliebend zu sein. Außerdem werden wir ein kleines Versuchsfeld anlegen und Gegenmittel entwickeln und ausprobieren. Allerdings, wenn wir tatsächlich eines finden, sind wir noch lange nicht am Ziel. Wir müssten eine riesige Menge Gegenmittel herstellen, damit alle Felder besprüht werden können. Das kann Jahr dauern. Deshalb hoffe ich auf Kälte.“
Mit einem Funken Hoffnung entlassen zu werden, lässt die Leute einigermaßen ruhig nachhause gehen. Der Rat bleibt sitzen und diskutiert weiter. Richard tritt an den Tisch. Unaufgefordert sagt er: „Wenn die Sporen überall sind, sind sie vielleicht schon in der Lagerhalle und sitzt in unserem Saatgut.“
Carlina und Grissly, die beide sofort begreifen, werden ob ihrer Nachlässigkeit gemeinsam tiefrot.
„Müssen wir nun alles abdecken?“ fragt Michelle. „Haben wir so viele Häute auf Lager?“
„Leder können wir nicht nehmen“, weiß Fritzi. „Das schimmelt auch. Wir sollten solche Plastikfolien haben, wie es sie früher mal gab. Aber die sind alle zerbröselt. Sobald man etwas aus Kunststoff anfasst, fällt es auseinander.“
Sigsig wird lebendig, reckt sich vor zur Tischkannte. „Es könnte sein, dass es noch feste Planen gibt. Ich kenne noch die ehemalige Mülldeponie. Die wurde mit dicken, schwarzen Planen abgedeckt. Ich kann mir vorstellen, wenn man schädlichen Müll abdeckt, macht man das für eine möglichst lange Zeit. Diese Planen müssten deshalb endlos haltbar sein.“
„Sollen wir jetzt die Erde auf buddeln und nach Planen suchen?“ prudelt Buran.
Sigsig schüttelt seinen Kopf und grinst. „Ich habe vor ungefähr fünfzig Jahren mehrere Rollen entdeckt. Mein Vater hatte zeitweise auf dem Deponiegelände die Fahrzeugwerkstatt betrieben. In einem Lager lagen solche Kunststoffrollen. Da sollten wir nachschauen.“
„Wenn nicht inzwischen das Dach darauf liegt“, knurrt Richard.
„Satteln wir unsere haferfreien Pferde und schauen einfach nach“, schlägt Grissly vor. „Richard, du darfst mit, wir brauchen junge Arme die tragen können.“
Ein Packpferd wird mit Sägen und Äxten beladen. Letztlich reiten nur Grissly, Richard, Sigsig und Fritzi. Wo die Werkstatt steht, können sie nur noch erahnen. Die Deponiegebäude sind von bis zu hundert Jahre alten Bäumen verdeckt. Auf der Suche nach Mauern, irrt Sigsig eine Zeitlang durchs Unterholz. Auch an den Asphaltstraßen kann er sich nicht orientieren, denn die sind von Pflanzen gesprengt und genauso Wald, wie die ganze Deponie. Das Dach der Werkstatthalle ist tatsächlich eingestürzt. Doch finden sie durch den Hintereingang hinein und von dort in die einzelnen Lager. Als Sigsig seine Kameraden in einen Raum winkt, bleiben alle ehrfürchtig stehen. Dort liegen sie. Zwei Meter lange fette, schwarze Rollen. Sigsig hat sie schon von Spinnweben, herabgefallenem Putz und sonstigem Dreck befreit. Die Gruppe steht davor, wie man vor einem heiligen Altar steht, oder einem blendenden Goldschatz. Nach dem Ende der Andacht reißt Grissly sein Messer heraus und tätigt einen Probeschnitt.
„Fällt nicht auseinander“, stellt er fest. „Hervorragendes Material. Damit könnte man sogar Dächer abdecken.“
Alle bestätigen durch Nicken. Richard meint: „Und Teiche bauen. Ich wollte schon immer hinter meinem Haus einen Fischteich.“
Sigsig hebt eine Rolle an. Sie sind enorm schwer. „Wie viele Rollen werden wir brauchen? Reicht eine? Oder eher zwei?“
„Die nehmen wir alle mit“, tut Grissly verwundert. „Sowas kann man immer mal wieder brauchen. Wir gehen zu den Pferden und holen die Äxte. Dann hacken wir uns einen Pfad frei und tragen die Rollen zum nächsten offenen Platz. Nach dem Abendessen fahren wir mit dem Wagen her, laden auf, und bevor es dunkel wird, haben wir das Getreide abgedeckt“, gibt er die Richtung vor.
Richard, Sigsig und Fritzi schauen ungläubig. Hektik und Übereifer sind die Menschen nicht gewohnt. Arbeiten werden meist gemütlich und ohne Druck ausgeführt. Beim Sport beeilt man sich, oder wenn man vom Feld zum Essen heimgeht, bei der Arbeit selten. Das Wort Stress kennt bestenfalls Carlina. Alle anderen können sich darunter nichts vorstellen. Aber was Grissly gerade fordert, hört sich nach maximaler Aktivität an.
Bevor die Nacht hereinbricht, ist die Schinderei beendet. Alle Beteiligte schauen, mit dem Gefühl außerordentliches geleistet zu haben, zufrieden auf den schwarzen Berg, unter dem das Getreide hoffentlich Sporengeschützt lagert.
Der Verzicht auf Körner macht sich bei den Tieren zuerst bemerkbar. Die Pferde sind ab dem ersten Tag unzufrieden und bockig. Verweigern manchmal die Arbeit. Wer hat, nimmt nun lieber einen Esel und lässt sein Ross einige Tage im Stall schmollen. Die Hühner picken nach den Beinen, die ihnen das Futter bringen und fordern mehr. Unbestritten schmecken die Eier nun anders. Und es werden weniger. Allerdings gewöhnen sich die Tiere schneller an die Umstellung, als die Menschen.
Jede Familie geht mit dem Mangel anders um. Einige ziehen sofort mit Wagen los und besorgen sich im Umland Weizen oder Mehl, bevor es andere tun. Andere nehmen es gelassen, lassen sich allerhand Brotersatz einfallen, wollen für fremdes Getreide nichts opfern. Die Tüftler denken sich neue Mischungen aus, die sie wie Brot in die Röhre schieben. Begehrt sind jetzt vor allem längst vergessene Kochbücher. Zucker und Salz gibt es ja nach wie vor. Die Frage lautet, wie backe ich ohne Getreidemehl einen Kuchen?
Das Hospital muss genauso ohne Brot auskommen wie alle. Das Personal zerbricht sich den Kopf, welche gleichwertige Ernährung den Patienten vorgesetzt werden kann. Den Schulkindern werden keine Pausenbrote mehr mitgegeben, sondern gekochte Kartoffeln, Gemüsebratlinge, Obst. Käse und Wurst pur am Stück. Die Kleinen, denen das Verständnis fehlt, schmeißen ihre Vesper weg und fordern dann zuhause dicke Brote. Das Gemaule in den Familien hört nicht auf. Essensverweigerung wird Alltag.
Auch einige Nachbargruppen, so stellt sich heraus, wie die Religiösen in Lahr und die Straßburger, sind von der Getreideseuche betroffen. Beide Gemeinschaften haben auf Zoratoms Überproduktion und Wirtschaftskraft gehofft. Nun konkurrieren sie um das Getreide, das überregional erhältlich ist. Schon Ende des Sommers ist nichts mehr zu bekommen. Aber die Misere spricht sich herum. Auf einmal tauchen Händler auf, die man noch nie gesehen hat, die allerlei Getreide zu unverschämt hohen Preisen anbieten. Getreide, das aus den Tiefen Frankreichs, aus Ostdeutschland und sogar südlich der Alpen stammt. Getreide, das von weit her kommt, schon mehrmals den Besitzer gewechselt hat und deshalb sehr teuer ist. Anstatt es dem Meistbietenden zu überlassen, nehmen es die Händler lieber wieder mit.
Ralf, der Landwirt mit dem Emmer Feld, stellt Vogelscheuen auf. Wie es ihm gerade einfällt, reitet er manchmal sogar nachts hin, um nach dem Rechten zu sehen. Er glaubt zwar nicht an Diebstahl, aber sicher ist sicher. Nachdem einige Feldhasen es gewagt haben seinen Schatz anzuknabbern, bindet er dort einen Hofhund an. Leider liegt das Feld zu dicht am Dorf. Der einsame Köter jault die ganze Nacht. Zur Beruhigung wird ein zweiter Hund angebunden. Als der Emmer endlich geerntet wird, geschieht das auf eine übertrieben vorsichtige Weise, damit nichts verloren geht. Den Vögeln bleibt nichts, weder den Tauben noch den Saatkrähen. Und die vielen kleinen Vogelarten gehen erst recht leer aus.
Die Auswirkungen des unfreiwilligen Brotverzichtes merken die Menschen zuerst am veränderten Stuhlgang. Er ist nicht mehr so fest und riecht auch stärker als gewohnt. Die veränderte Ernährung wirkt sich auf die Därme aus, Blähungen nehmen zu, Durchfall auch. Unwohlsein, schlechte Stimmung, verlorene Feierlaune, sind Auswirkungen der abnehmenden Lebensqualität. Das Frühstück wird mit Unlust eingenommen und oft mit Alkohol aufgewertet.
Im Hebst werden Wintervorräte angelegt wie nie zuvor. Es ist das geschäftigste Spätjahr aller. Nie wurde so sehr auf die Qualität des Heus geachtet, um die Pferde einigermaßen zufrieden zu stellen. An Obst und Gemüse wird eingemacht was geht, die kleinste Kartoffel und die mickrigste Rübe werden geerntet und eingelagert. Es wird doppelt so viel Käse hergestellt als sonst und doppelt so viel Wurst geräuchert. Jede Traube wird geerntet, alles Fallobst zu Schnaps gebrannt, denn Wein und Schnaps aus Zoratom sind begehrt. So begehrt, dass man dafür sogar Weizen bekommt.
In der folgenden Vollversammlung geben die Erfinderischen ihre Lieblingsrezepte Preis. Zum Beispiel: Welche Teige sich aus Soja, Linsen und Kartoffeln machen lassen. Manche Bürger reden über ihre Körperlichen Veränderungen. Viele leiden unter Kopfschmerzen, weil sie Brot durch Fleisch ersetzt haben. Carlina warnt vor zu vielem Tierischen. Dreiviertel der Ernährung sollte aus Gemüse und Obst bestehen, erklärt sie. Doch richtig satt werden die Leute nur von Fleisch, Wurst, Eiern und Käse.
An Weihnachten dann die Überraschung. In den meisten Haushalten gibt es Gebäck und Kuchen. Von Mehl, das man sich am Munde abgespart oder teuer erstanden hat. Man lädt nun seine Freunde nicht mehr zu einem leckeren Braten ein, sondern zu Gebäck und Kuchen. Einige bieten üppige Butterbrote an, die die Gäste wahlweise mit Wurst, Käse, Ei oder Marmelade garnieren dürfen. Das sind Festessen. Für zwei Tage sind die Leute guter Stimmung. Danach folgt wieder die ungewollte triste Ernährung. Carlina lehnt alle Einladungen ab. Will niemandem etwas wegessen, schließlich ist sie maßgeblich mitverantwortlich, dass es kein Mehl gibt.
Im neuen Jahr werden längst verwilderte Terrassen gerodet. Die Wildtierherden weiden zwar alles ab was hoch wachsen will. Aber im Bereich der Grasnarbe ist der Boden furchtbar verwurzelt und verfilzt. Um lockeren Ackerboden zu bekommen, müssen die Landwirte die oberen zwanzig Zentimeter umstechen und zerkleinern. Auf diese neuen Grundstücke fahren sie noch Kuh- und Pferdemist und schaffen so beste Wachstumsbedingungen. Im Frühjahr soll ein neuer Versuch mit Getreide und Mais gestartet werden. Vielleicht steckt die Getreideseuche nur in den alten Böden.
Im Winter kommt sehr viel Kohl auf den Tisch. Weißkohl, Grünkohl, Blumenkohl, Rosenkohl und Brokkoli. Und viele Hülsenfrüchte. Von jeder Hülsenfrucht gibt es gleich mehrere Sorten. Sie werden zusammen mit Kartoffeln und Fleisch serviert. Oft gibt es nachmittags und abends dasselbe. Fleisch gibt es immer. Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Geflügel, Wildschwein, Hirsch, Reh, Wisent, Gämse, Lama, Antilope, Strauß und manchmal sogar Pferdefleisch. Als Nachtisch, eingemachtes Obst. Nudeln aus Linsen werden in Ermangelung richtiger Nudeln immer beliebter. Brotersatz aus Sojamehl auch. Jede Hausfrau probiert ihre eigene Mischung. Salz ist am wichtigsten, und Eier und Milch. Was ein bekömmliches Sojabrot ausmacht, bestimmen diverse Kräuter und oft geheime Zutaten. Ein richtiger Wettkampf entsteht.
Zu Ostern will Grissly für den besten Brotersatz einen Preis verleihen. Erster Preis, ein Kilo Mehl. Über fünfzig Hausfrauen und Hausmänner melden sich an, der Alte ist total überfordert. Letztlich kommen die Laibe auf eine Liste, werden mit einer Nummer versehen und im Sportheim auf Tischen präsentiert. Die Bevölkerung darf probieren und bis zu drei Punkte in Form von Strichen verleihen. Drei Striche für sehr gute Brote. Was nicht schmeckt soll strichlos bleiben. Es entsteht ein unübersichtliches Gerangel. Richard stellt fest, dass immer wieder die gleichen zum selben Brot gehen und die Strichliste vollkritzeln. Grissly sieht sich gezwungen den Wettbewerb, obwohl alle Brote schon deutlich angeknabbert sind, neu zu beginnen. Er postiert Saalordner, die das Abstimmungsverhalten überwachen. Und den Ablauf regeln. Zudem müssen sie sich merken, wer schon im Sportheim gewesen war. Gerade Kinder benutzen den Wettbewerb auch, um sich satt zu essen. Am Abend ist fast alles aufgegessen und es kommt zum Chaos. Angeblich wurden Strichlisten vertauscht, Nummern verändert. Als die Verwirrung ihr größtes Ausmaß erreicht hat, sammelt Carlina alle Listen ein und geht in die Küche des Sportheims. Dort untersucht sie die Handschriften. Alle Listen die ihr verdächtig erscheinen, lässt sie gleich verschwinden. Von den Restlichen nimmt sie die drei mit den meisten Strichen und geht wieder in die Halle.
Bei der Preisverleihung kommt es zum Eklat. Das Kilo Mehl soll eine Joana bekommen, eine energische, kräftige und dunkelhaarige Frau, die sich zu wehren weiß. Als sie ihre Hände nach dem Kilo austreckt meint Grissly: „Nun wollen wir aber auch dein Rezept wissen.“
„Das war so nicht abgemacht“, behauptet sie. „Das ist mein Rezept und geht keinen was an.“
„Das war aber der Sinn des Wettbewerbs, damit sich alle köstliches Ersatzbrot backen können“, meint der Alte entrüstet.
„Das hättest du vorher bekannt machen sollen. Ich will doch nicht, dass nun alle mein Brot essen. Wer will das schon.“
Völlig betreten sucht Grisslys Blick Hilfe bei Carlina. Die Situation ist mehr als ärgerlich. Man kann der Frau schlecht den Preis vorenthalten, das würde sie und ihre Sippschaft gegen den Rat aufbringen. Vielleicht wäre es besser, an ihren Gemeinschaftssinn zu appellieren.
„Du willst tatsächlich das Rezept für dich behalten?“, tut Carlina erstaunt. „Schau dich doch mal um, wie erwartungsvoll dich alle anstarren. Du kannst ruhig großzügig sein und dein Wissen mit der Gemeinschaft teilen.“
„Tut mir furchtbar leid“, sagt Joana ungerührt, „aber ich will auch mal etwas, was andere nicht haben.“
Carlina versucht es nochmal. „Bislang ließ man an seinen Erfindungen alle teilhaben. Du weißt schon, dass wir immer füreinander arbeiten, damit es mit der Menschheit vorwärts geht. Wer Nutzen aus der Gemeinschaft zieht, muss auch liefern.“
„Sobald es wieder richtiges Brot gibt, verrate ich euch mein Geheimnis für die nächste Krise“, zischt sie, nimmt das Mehl und verlässt den Saal.
Bald darauf machen sich erste Fehlernährungen und Mangelerscheinungen bemerkbar. Viele Leute fühlen sich unwohl, schlapp, energie- und antriebslos. Gerade die Leute, die oft auf die überflüssigen Faulenzer im Hospital schimpfen, wobei sie nicht die Ärzte sondern die Krankenschwestern- und Pfleger meinen, benötigen zuerst Hilfe. Nicht wenige Bürger nehmen jetzt auch zu. Gewichtsprobleme gab es in der Vergangenheit bislang nicht, denn jeder geht einer körperlichen Tätigkeit nach. Und die Schüler klagen über Konzentrationsmangel. Die Ärzte verabreichen selbst hergestellte Vitamin- und Mineraltabletten, die auch helfen. Leider ist der Vorrat schnell erschöpf, die Herstellung neuer Tabletten ist aufwändig und langwierig. Deshalb bekommen die Patienten eine Ernährungsberatung, doch das Dilemma bleibt. Kim berät sich mit Carlina.
„Das Volk ist für eine ausgewogene Ernährung zu bequem“, stellt diese fest. „Da müssen wir einmal Tacheles reden.“ Der Rat bittet zur Vollversammlung.
Nachdem allgemeine Themen abgehandelt sind, erhebt sich die größte aller Frauen. „Viele bilden sich ein, wir hätten ein Ernährungsproblem, weil es kein Mehl mehr gibt. Dem ist aber nicht so. Angebliche Mangelerscheinungen gibt es nur, weil ihr nicht alle Ressourcen ausschöpft. Als Frühstück immer Wurst, Käse und Eier, ist einfach zu ungesund. Ihr habt für den Winter Obst eingemacht und getrocknet, das reicht als Frühstück. Nachmittags esst ihr ja Fleisch. Meistens mit irgendeinem Kohl und Kartoffeln, oder Bohnen, Erbsen, Linsen. Wie wäre es mal mit Zwiebeln oder Lauch. Oder eingelegten Zucchini, Paprika und Auberginen. Ihr alle esst auch viel zu wenige Rüben, egal welche. Roh, gekocht, als Püree können sie getrost ohne Fleisch gegessen werden.
Und auch abends geht es nicht ohne Wurst und Käse. Wir haben hier jede Menge Gewässer. Ihr müsst auch Fische, Muscheln und Krebse essen. Jede Familie sollte für ein abwechslungsreiches Essen sorgen. Da darf man nicht bequem sein. Es gibt Familien, die essen unter der Woche nur Schweinefleisch und Sauerkraut. Diese Eintönigkeit muss ja krank machen. Nur Vielfalt hält gesund. Und vergesst nicht das eingemachte Obst und die Beeren zu verzerren. Esst was ihr kriegen könnt, aber wenig Fett aus Fleisch, Käse und Eiern. Trinkt Säfte. Wir haben alles was wir brauchen um gesund zu bleiben.“
Der Winter ist kälter als in den Vorjahren. Im Januar gibt es eine richtig kalte Woche mit minus elf Grad. Das müsste die Sporen killen.
Kurz vor der Aussaat kommen italienische Händler nach Zoratom. Vor der Kirche bauen sie einen Stand auf und beginnen, auf einem mitgebrachten Holz- Herd, in zwei Töpfen zu kochen. Das Publikum lässt nicht lange auf sich warten. Es gibt einen Haken. Die drei Händler haben von deutscher Sprache keine Ahnung. Einer spricht französisch, Carlina wird gesucht. Sie, Kim, Richard und einige andere, hatten sich den Spaß gemacht eine Fremdsprache zu lernen. Da Frankreich in greifbarer Nähe liegt, kam nichts anderes in Frage. Auch, um sich mit den Franzosen beim AKW Fessenheim unterhalten zu können. Man will schließlich wissen, wie es um dieses Erbe der Menschheit bestellt ist. Italien und England sind einfach zu weit weg. Nach einer Weile kommt sie auf einem Fahrrad Marke Eigenbau angebraust. Stellt es ab und sich vor die Italiener. Das Dauergrinsen der Händler verschwindet. Vermutlich sind sie plötzlich innerlich geschrumpft und fühlen sich nur halb so groß, wie Carlina vor ihnen steht.
„Was habt ihr uns denn Gutes mitgebracht?“, beginnt sie das Gespräch.
Als sie das Französisch vernehmen, wird einer der Drei sofort wieder lebendig. „Wir haben von euren Problemen mit dem Weizen gehört. Deshalb haben wir euch eine Alternative mitgebracht, die in unserer Heimat gedeiht. Wir nennen es Riso. Wir haben euch, zum Probieren, einen Topf voll gekocht. Mit Soße schmeckt der Riso am besten. Gleich ist die Soße fertig.“
Carlina übersetzt. Niemand, auch sie nicht, hat jemals von Riso gehört. Der Sprecher hebt einen Deckel, holt mit einem großen Holzlöffel schneeweiße Körner aus dem Topf. Weiße Körner sind in Zoratom gänzlich unbekannt. Pustend kühlt er die Körner. Hält Carlina den Löffel hin. Sie probiert. Der Riso schmeckt fremd. Total fremd. Und fade. Weit entfernt von allen jemals hier angebauten Getreiden. Viele andere probieren auch, verziehen das Gesicht. Dann taucht der Mann den Löffel in den zweiten Topf, holt rote Soße heraus. Auf die gibt er mit einer Gabel Risokörner und lässt Carlina wieder probieren. Es schmeckt sehr würzig, fast scharf, aber nicht unangenehm.
„Ihr könnt den Riso anbauen wie euer Getreide. Der Pilz wird ihm aber nichts anhaben“, versucht der Händler sein Produkt anzupreisen.
„Du hast unser Problem nicht erkannt“, antwortet sie. „Dein Riso wird uns vielleicht Abwechslung verschaffen und satt machen. Leider kann man mit ihm unser geliebtes Brot und unsere leckere Nudeln nicht herstellen, weil er ganz anders schmeckt. Was soll das Kilo denn kosten?“
Der verlangte Preis ist einer einzigartigen Delikatesse würdig.
Grissly kommt vorbei. Schaut in den Topf. Sagt: „Tatsächlich. Reis.“
„Du kennst das Zeug?“ fragt Carlina verwundert, weil er etwas kennt was sie nicht kennt.
„In Papas Vorratskammer habe ich, als ich klein war, zwei, drei Tüten davon gefunden. Mit Fisch zusammen schmeckt er am besten.“
Es kommen noch einige leidenschaftliche Köchinnen und Köche vorbei, die den Reis aus Büchern kennen. Alle probieren, halten das Zeug für essbar, winken aber sofort ab, als sie den Preis hören.
„Habt ihr eigentlich eine Ahnung was es bedeutet von Italien über die Alpen hierher zu reisen?“, verteidigt sich der Händler. „Diese Mühen machen den Reis so teuer.“
„Für ein Kilo Reis biete ich dir einen halben Liter Kirschwasser. Beste Qualität“, muss Carlina für Grissly übersetzen.
„Er will fünf Liter für ein Kilo“, gibt sie zurück.
„Verlange doch gleich ein Kilo Gold“, sagt Grissly hämisch. „Ich biete einen Liter. Ein Liter Schnaps für einen Kilo Reis ist unverschämt genug. Sonst könnt ihr ohne Verkauf weiterfahren.“
Der Italiener berät sich mit seinen Partnern, schüttelt dann den Kopf. So kurz vor der Aussaat will aus Zoratom niemand auf fremde Körner setzen. Dieses Jahr könnte es mit dem Weizen klappen. Grissly geht, Carlina geht und nach ihr auch alle anderen Neugierigen. Bevor sie den Ort verlassen, fahren die Italiener heimlich bei Grissly vorbei, tauschen drei Kilo Reis gegen drei Flaschen Obstler und fahren zur nächsten Siedlung.
Das ertragreichste Grundstück gebührt dem Emmer. Ralf vertraut seiner Zucht und sät alle seine eingelagerten Körner aus. Von den anderen Getreiden wird nicht viel riskiert, der Rat ist vorsichtig. Geht es gut, gibt es zumindest etwas Mehl, das man an Festen, Geburtstagen und Weihnachten verbrauchen kann. Viele Familien haben sich noch immer nicht daran gewöhnt, dass es das Getreide, das man bei Grissly holen konnte wie man es brauchte, nicht mehr gibt. Die Gregorhöfe bauen kein Getreide mehr an. Nur noch Gewächse von denen man weiß, dass sie unverwüstlich sind. Auch die Insulaner bauen kein Getreide mehr an. Von was sie leben, wissen die Fliegen. Voller Hoffnung reiten die Landwirte bald täglich zu ihren Feldern. Überwachen mit Argusaugen die Blätter und Stängel ihrer Getreidepflanzen. Wünschen sich nicht zu viel und nicht zu wenig Regen und vor allem, keine Getreideseuche.
Doch sie kommt. Alles wird wieder befallen, bis auf den Emmer, der scheint tatsächlich resistent zu sein. Es wird darauf hinauslaufen, dass sich die Gemeinschaft, wenn es einmal genug davon gibt, von Emmer ernähren muss. Der aber leider weder schmackhaftes Weizenbrot noch die beliebten Nudeln ersetzen kann. Manchem kommt es schon so vor, als ob die letzte Getreideernte eine Ewigkeit zurückliegen würde und das Leben ohne Brot, Nudeln und Kuchen eine für immer beschlossene Sache wäre.
Auch andere Gemeinschaften müssen nun ohne Getreide leben. Es scheint ein richtiges mitteleuropäisches Problem zu sein. Das jährliche Fußballturnier wird abgesagt, weil sich zu viele selbst eingeladen haben. Die Fußballfans dachten sich, wir fressen uns im reichen Zoratom mal so richtig durch. Doch der Reichtum schwindet. Werte und Besitz werden manchmal für ein Bisschen fremdes Mehl geopfert, weil die Frau gerade Geburtstag hat oder man den Kindern eine Freude machen will. Während früher der Reichtum in den Ort floss, fließt er nun auf den Wagen und in den Taschen der Händler hinaus. Monatlich wird Getreide teurer. Wir verlernen noch das Brotbacken und Nudeln machen, befürchten die Bäcker und Hausfrauen.
Einen Lichtblick gibt es. Die Forscher im Hospital haben ein Mittel gegen den Pilzbefall gefunden. Gewonnen, welche Ironie, aus einem anderen Schimmelpilz. Nur, um das Mittel anwenden zu können, muss dieser Pilz in Masse gezüchtet werden. Carlina versucht das Mittel mit Brennnesselsud zu strecken. Bei allem Aufwand reicht die Flüssigkeit nur für ein kleines Maisfeld. Das sogar geerntet werden kann.
Auch im Jahr darauf wird die Aussaat von der Getreideseuche zerstört. Keiner rechnet damit, jemals wieder ein Weizen-Roggen-Dinkel-oder Maisbrot auf den Tisch zu bekommen. Der Emmer wächst wie gewohnt prächtig, egal ob es zu feucht ist oder zu trocken, es scheint ihm nichts zu machen. Das Getreide der Zukunft. Das Antipilzmittel wirkt, aber nur auf den Maispflanzen und kann nicht in großen Mengen hergestellt werden.
Dann kommt es zum Gau. Grissly macht im Getreidelager Mäusekontrolle, hebt die schwarze Folie an und, sieht Schimmel. Wo er auch unter die Folie schaut, Getreideseuche. Heftig nießend verlässt er die Halle, lässt das Tor offen stehen. Umgehend spricht sich das herum, niemand fragt nach, alle wissen was das bedeutet. Die Halle wird ausgeräumt. Es ist zu traurig. Die Körner, die Mehl für unzählige Brote geliefert hätten, wenn sie wie gefordert verarbeitet worden wären, werden verbrannt.
Nachdem das Saatgut in der Halle verfault ist, kommt endlich ein richtig harter Winter. Es wird Holz verheizt wie nie zuvor. Der Boden ist Beton, man kommt überhaupt nicht mehr an die vergrabenen Kartoffeln, Karotten und Runkelrüben. Vögel fallen tot vom Himmel. Wie es der Zufall so will, wird aus Bayern eine Patientin gebracht, die auf die Künste des hiesigen Hospitals hofft. In Bayern gedeihen noch Weizen, Roggen, Hafer und Dinkel. Nur rücken die Bayern, wegen der europaweiten Krise, nichts heraus. Kim ist rigoros. In Bayern gäbe es auch Ärzte, behauptet sie frech. Bayern würden hier nur behandelt, wenn sie mit Getreide bezahlen. Die Frau verspricht Weizen, es wird eine wöchentliche Bezahlung ausgehandelt. Als die Frau nach drei Wochen heimfährt, ist das Dorf im Besitzt dreier Säcke. Einer ist voller Weizenkörner, der zweite voller Roggen und der dritte voller Hafer. Ohne etwas zurückzulegen wird der Inhalt der Säcke ausgesät. Entweder ist die Seuche überstanden oder der Getreideanbau für immer gestorben.
Nach langer Zeit interessiert sich die Gemeinschaft wieder für die Insulaner. Doch dort drüben tut sich nichts, die Felder werden nicht bestellt. Irgendwann geht Fritzi auf, dass sie drüben seit Monaten keinen Rauch mehr gesehen hat. Eine kleine Expedition reitet über das Floß und zum Dorf und findet nur verlassene Häuser. Nicht ein Tier ist zurückgeblieben. Der Winter war für sie wohl zu kalt gewesen.
Was dem einen sein Leid, ist dem anderen seine Freud. Das Getreide aus Bayern gedeiht hervorragend, auch kurz vor der Ernte ist von der Getreideseuche keine Spur zu sehen. Die Felder werden säuberlichst abgeerntet und die Körner für das nächste Jahr gelagert. Die Emmer Ernte ist so üppig, dass die Hälfte zu Mehl verarbeitet wird, von dem jede Familie ein wenig bekommt. Nun können sie probieren, ob sie das Brotbacken tatsächlich verlernt haben. Der Emmer schmeckt nur als Brötchen, finden alle. Mangels anderen Mehls, werden Emmer Brötchen auf Jahre zum Brotbegriff.
Schon in wenigen Jahren wird es wieder Weizen-und Roggenbrot geben, an dessen Geschmack sich die Emmer verwöhnten Zungen nicht mehr erinnern können. Werden die Pferde wieder Hafer bekommen, woran sie sich auch nicht mehr erinnern können, und noch einige Jahre später wird es wieder so viele Körner geben, dass auch für die Hühner genug abfällt. Dann werden die Eier wieder anders schmecken und die Kinder vielleicht enttäuscht sein und ihre gewohnten Eier verlangen.