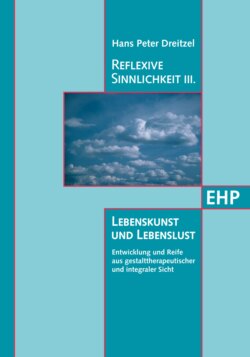Читать книгу Reflexive Sinnlichkeit III: Lebenskunst und Lebenslust - Hans Peter Dreitzel - Страница 10
1. Sich in das Abenteuer des Lebens stürzen
ОглавлениеTo expect the unexpected shows
a thoroughly modern intellect.
Oscar Wilde
Dass unser Leben ein Abenteuer ist, soll zunächst einfach heißen: unser Leben ist ein Ereignis, das wir nicht geplant haben und das von einer Serie von schicksalhaften Ereignissen bestimmt wird, die immer wieder alle Lebensplanung durcheinander werfen. Die Zukunft bleibt stets ungewiss, sodass alle Sicherheit höchstens Wahrscheinlichkeitswert besitzt. »Der Mensch denkt und Gott lenkt« ist ein altes Sprichwort, das diese Erfahrung auf den Punkt bringt. In ihm steckt freilich noch der Hinweis auf ein vor-modernes Gottvertrauen, das Heil und Trost zu bringen versprach, zumindest aber etwas Halt inmitten der Lebensstürme bot. Diesem Versprechen noch zu glauben, wurde in der Moderne zunehmend schwieriger. Der Mensch der frühen Neuzeit wird immer mehr von Glaubenszweifeln gequält, die in den Reformationen des 16. Jahrhunderts ihren theologischen und sozialen Ausdruck fanden. Zugleich beginnt mit der Renaissance und dem Humanismus eine Rückbesinnung auf die dem Menschen eigenen Potenziale, die ungeheure Kräfte freisetzt: Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert wird die Welt von Europa aus mit einem zuvor undenkbaren Elan und Eifer erkundet, besetzt und kolonisiert. Dieses »Zeitalter der Entdeckungen« ist geprägt von abenteuerlichen Reisen, die die politische und soziale Welt tiefgreifend verändert haben. Während aber in der Antike und im Mittelalter die Abenteuer des Lebens zumeist passiv als gottgewolltes oder teuflisch inszeniertes Schicksal erlitten wurden, entwickelt sich in der Neuzeit immer häufiger auch eine Haltung, in der das Abenteuer positiv gewertet und oft sogar ersehnt wird als notwendiger Bestandteil einer Suche nach individuellem Glück. Das ist bereits der Fall bei Parzivals Suche nach dem Gral, während die Reisen des Odysseus noch schiere Irrfahrten sind, die die Götter dem Helden schicksalhaft auferlegen.
Ähnliches gilt auch für die Abenteuer des Geistes in den Wissenschaften, die unser Weltbild wie auch unser Bild vom Menschen selbst vollständig verwandelt haben; mit Galileo und Kepler verlor die Erde ihren Status als Mittelpunkt des Universums; mit Darwin verlor der Mensch seine Rolle als Krone der Schöpfung; mit Freud verlor der Mensch seine vollständige Kontrolle über sich selbst. Seitdem haben die Atomphysik und die Quantenphysik unsere Vorstellung von der Substanzhaftigkeit der Erde aufgelöst, und jetzt stellen die Neurowissenschaften sogar unsere Willensfreiheit infrage und halten unser Ich-Bewusstsein für eine Illusion.
■ Nach dem inneren Halt des Gottvertrauens in einem theologischen Weltbild geht auch der Halt an dem äußeren Bild der Welt, wie es die klassischen Naturwissenschaften entworfen hatten, nun immer mehr verloren. Die These, dass das Leben ein Abenteuer sei, bekommt jetzt einen neuen Sinn: Es geht nicht mehr nur um unvorhersehbare Ereignisse und Bedrohungen, die es zu bewältigen gilt, und um das Bestehen von überraschenden Herausforderungen, sondern das Leben als ganzes erscheint von vornherein als ein Abenteuer, so als wären wir hineingeworfen in ein Leben, für das uns die Betriebsanleitung fehlt. Lange bevor der Existenzialismus des 20. Jahrhunderts von der »Geworfenheit« des Menschen in die Existenz sprach, hat der berühmte Mathematiker und Theologe des 17. Jahrhunderts Blaise Pascal diese verzweifelte Lage des modernen Menschen so beschrieben:
»Weder weiß ich, wer mich in die Welt setzte, noch was die Welt ist, noch was ich selbst bin. In einer furchtbaren Ungewissheit was meine Sinne sind, noch was meine Seele ist, und der Teil meines Ichs sogar, der in mir denkt, was ich sage, der über alles und über mich nachdenkt, kennt sich selbst nicht besser als das Übrige. Ich schaue diese grauenvollen Räume des Universums, die mich einschließen, und ich finde mich an einer Ecke dieses weiten Weltraums gefesselt, ohne dass ich wüsste, weshalb ich hier und nicht etwa dort bin, noch weshalb ich die wenige Zeit, die mir zum Leben gegeben ist, jetzt erhielt und zu keinem anderen Zeitpunkt der Ewigkeit, die vor mir war und nach mir sein wird. Ringsum sehe ich nichts als Unendlichkeiten, die mich wie ein Atom, wie einen Schatten umschließen, der nur einen Augenblick dauert ohne Wiederkehr. (P. Blaise 1956, 90).
Das scheint mir noch immer, und jetzt am Ende der Neuzeit erst recht, eine realistische Beschreibung unserer Situation. Für Pascal ergab sich die Erlösung aus dieser Situation nur aus der tragischen Religiosität eines credo quia absurdum est (Ich glaube, weil es absurd ist.). Obgleich ein solcher Glaube fast schon existenzialistisch anmutet, bleibt darin doch viel Platz für kirchlich vorgegebene Ordnungen und Wertsetzungen. Pascal jedenfalls führte ein so asketisches Leben, dass er seine ohnehin schwache Gesundheit damit vollends ruinierte. Diese Askese aber ist eine Negation des Körpers und kann deshalb niemals Bestandteil einer humanistischen Idee vom »guten Leben« sein.
Statt auf den Glauben setzt die Gestalttherapie dagegen immer auf die Erfahrung. Sie ermutigt den Menschen, das Abenteuer seines Lebens nicht bloß passiv zu erleiden, sondern es aktiv anzupacken und uns mit all unseren Sinnen in das Ungewisse zu stürzen und das, was wir dabei entdecken, mit kreativer Lust zu gestalten. Dabei setzt sie auf das Potenzial des Lebens, sich in schöpferischer Anpassung mit denjenigen Elementen der Umwelt zu identifizieren, die es zu seinem Wachstum braucht, und sich von denjenigen zu entfernen, die diesem Austauschprozess im Wege stehen.
■ Unsere erste und wohl auch letzte Erfahrung ist, dass wir am Leben sind. Deshalb steht in der Gestalttherapie das Bewusstsein zu atmen bei den sehr bedrohlichen psychosomatischen Störungen so sehr im Mittelpunkt. Vergegenwärtigen wir uns also: was wissen wir heute über die Frage: Was ist Leben? (Das Folgende stützt sich auf Formulierungen von F. Cramer, 1997). Leben ist Materie, die sich selbst reproduziert. Leben vermehrt sich so lange, wie die äußeren Bedingungen, vornehmlich die Nahrungsquellen, ausreichend und förderlich sind. Da die Bedingungen niemals nur günstig sind, stößt Leben immer auf Grenzen: »Das Lebendige explodiert und droht sich selbst zu ersticken.« (49) Leben muss sich an die sich ständig verändernde Umwelt anpassen. Deshalb entwickelt sich Leben, es evolviert durch eine Folge von erfolgreichen Mutationen, die die Anpassung an neue Umweltbedingungen gewährleisten. Leben ist bestimmt durch das Gesetz der Entropie, nach dem alle dynamischen Prozesse auf die Dauer einen Energieverlust erleiden; das heißt, alles Leben verschwindet wieder, stirbt ab. Die meisten Gattungen von Lebewesen, die die Natur hervorgebraucht hat, sind bereits ausgestorben; das gilt auch für die verschiedenen Menschengattungen vor dem homo sapiens, also uns.
Das individuelle Leben wird zeitlich strukturiert durch den Zyklus von Geburt, Wachstum, Siechtum und Tod. Schon rein biologisch ist also das Leben ein Abenteuer. Es ist eine »Bergbesteigung unter hohem Aufwand von Energie und Können mit einer anschließenden Gratwanderung … Mit Vorsicht, Intelligenz und bergsteigerischem Können (kann man) auf einem schmalen, unter Umständen gefährlichen Grat entlang wandern« – solange die aus der Umwelt bezogene Energie reicht (52). Leben ist also nicht im Gleichgewicht, es ist energetisch äußerst kostspielig und daher physikalisch unwahrscheinlich.
So einleuchtend und überzeugend die Klage von Pascal auch heute noch erscheint, so einseitig ist doch ihre Perspektive. Denn sie bezieht sich allein auf unsere unbestreitbare Unwissenheit. Er sagte nichts über die Kräfte und Begabungen, mit denen wir Menschen bereits auf die Welt kommen. Menschliches Leben verfügt über reiche Ressourcen der Orientierung in einer unbekannten Umwelt, welche Lebens- und Überlebenschancen enthält, die angesichts unserer Ignoranz höchst erstaunlich sind. Damit dieser Schatz zum Tragen kommen kann, muss allerdings das Überleben in den ersten Jahren nach der Geburt in einer sozialen Umgebung gewährleistet sein, die zugleich sicher und stimulierend ist. Menschen sind gemessen an vergleichbaren Säugetieren Frühgeburten, weil ihr mächtiger, das große Gehirn schützender Schädel eine spätere Geburt, für die der Geburtskanal zu eng wäre, unmöglich macht. Sie verbringen das sogenannte »extra-uterine Frühjahr« (A. Portmann, 1991) in vollkommener Abhängigkeit von den Eltern und nahen Bezugspersonen, was sie zugleich offen macht für ungewöhnlich frühe soziale Einflüsse – Anregungen wie Behinderungen.
Die Natur beziehungsweise die Evolution hat uns ausgestattet mit dem Neocortex, einer Gehirnregion, die uns rationales Denken, Planen und Abwägen ermöglicht. Der Neokortex ergänzt unseren Sinnesapparat, der zwar bei manchen Tieren im Einzelnen schärfer ausgebildet ist, aber ohne diese von unserem Gehirn ermöglichte Einheit der Sinne (H. Plessner, 1923) zu erreichen, aus der unsere hoch komplexe Weltsicht erwächst. Wir verfügen über ein evolutionär altes, aber zu erstaunlicher Differenzierung und Ausprägung fähiges emotionales Sensorium, das unsere kognitiven Kräfte motivational unterstützt. Und wir besitzen die Fähigkeit der Sprache, auch sie ist ein Wunder, das die Forschung bisher nicht wirklich entschlüsseln konnte. Diese Potenziale zusammengenommen machen die evolutionär neueste Ausgabe des Menschen, den homo sapiens, zu einem Lebewesen, dessen größte Bedrohung nunmehr die Zerstörung der ihn tragenden Umwelt durch seine eigene Überlebenskompetenz ist.
■ Das ist ein ganz anderes Bild des Menschen als das von Pascal entworfene, ohne dass dieses darum falsch wäre. Manche würden vielleicht an dieser Stelle sagen, dass es besser gewesen wäre, erst einmal die von Pascal aufgezählten Grundfragen zu klären, bevor sich die Menschheit in das Abenteuer einer Wissenschaft stürzte, in deren Folge sie ihren inneren Halt verloren und zugleich ihre eigene Umwelt vergiftet hat. Aber das wäre ein kurzsichtiger Blick: Es ist derselbe Prozess der wissenschaftlich-mathematischen Suche nach der Antwort auf diese Fragen, den Pascal und andere Denker des 16. und 17. Jahrhunderts angestoßen haben, der zu den Problemen unserer Gegenwart geführt hat. Nur haben sich die Prioritäten etwas verschoben: langsam – zu langsam! – schiebt sich die Umweltproblematik immer mehr in den Vordergrund, einfach weil es hier um unser aller Überleben geht.
Auf andere und neue Weise wird gegenwärtig deutlich, wie sehr das Leben ein Abenteuer ist: Indem wir unsere Fähigkeiten nutzend die vorgefundene Umwelt zur Befriedigung unserer Bedürfnisse umgestalten und uns verfügbar machen, greifen wir in die homöostatischen Rückkoppelungsprozesse der Natur ein und stören deren Systemzusammenhänge dergestalt, dass sie uns feindlich gegenüber tritt und unsere Sicherheit bedroht. Um Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wärme, Gesundheit und Mobilität zu befriedigen, vergiften wir andere lebenswichtige Ressourcen der Umwelt wie die Luft, das Wasser, die Erde und die von ihr getragenen Biotope. Es zeigt sich, dass die Suche nach dem guten Leben, wenn sie allein im Dienst einer immer besseren Befriedigung unserer materiellen Bedürfnisse gestellt wird, umschlägt in das Gegenteil dessen, was sie erreichen wollte. Die Dialektik von Steigerung des Lebensstandards und Zerstörung der Umwelt hat sich überraschend als das Abenteuer der Moderne erwiesen.
■ Dieses Abenteuer ist offenbar dafür verantwortlich, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die geradezu besessen von Sicherheitsbedürfnissen und Sicherheitserwartungen ist. Nie zuvor in der Geschichte haben sich Menschen gegen so viele Risiken des Lebens versichern lassen und gleichzeitig ist nie zuvor ein derart großer Aufwand für Sicherheitsvorkehrungen getrieben worden. Die Angst vor Terrorismus hat zur Entwicklung digitaler Überwachungssysteme geführt, die auf die Dauer die Privatsphäre als solche zu zerstören drohen – schließlich stehen wir erst am Beginn der digitalen Revolution.
Dabei ist das Leben tatsächlich unvergleichlich viel sicherer geworden als es in vormodernen Zeiten war. Wie Steven Pinker in seiner großen Untersuchung zur Geschichte der Gewalt gezeigt hat (Pinker, 2011), ist die Chance, durch menschliche Gewalt oder durch einen Unfall zu Tode zu kommen, trotz der großen Kriege und Völkermorde des 20. Jahrhundert sehr viel geringer geworden, als sie noch im 19. Jahrhundert war. Trotz internationalem Terror, trotz schreckenerregender Unfälle bei der Großtechnik vom Untergang der Titanic bis zu Tschernobyl und Fukushima: Wir fahren täglich mit dem Auto und wir reisen in entfernte Gegenden (sofern uns nicht das Außenministerium davon abrät) weitgehend ohne Furcht vor Unfällen, Überfällen und Mordattacken. Die Selbstverständlichkeit unserer Mobilität ist das beste Indiz dafür, wie sicher wir uns tatsächlich fühlen.
Allerdings lässt sich dieses Sicherheitsgefühl nur durch die neurotische Verdrängung der großen Umweltgefahren aufrechterhalten. Nur so lässt sich der Widerspruch zwischen Risikobereitschaft beim Betrieb von Atomkraftwerken und vorläufigen »Endlagern« des anfallenden Atommülls und den zum Teil schon wahnhaften Sicherheitsbedürfnissen, z. B. beim Autobau oder im Haushalt, erklären. Diese haben auch etwas damit zu tun, dass uns die globalisierten Medien ständig die meist eher punktuelle Gewalt aus aller Welt vor Augen führen und wir uns in zahllosen Filmen Gewaltszenen anschauen, die uns teils mit schauderndem Warnen, teils mit voyeuristischem Blick im Detail vorgeführt werden. Auf jeden Fall erleben wir heute ein paradoxes Nebeneinander von Risikoverhalten und Risikovermeidung. Während im öffentlichen Bereich die staatlichen und wirtschaftlichen Systeme bei der Förderung und Benutzung von Großtechnologien gigantische Risiken auf sich nehmen, um die weltweiten Handelsketten in Fluss zu halten und die Profite zu sichern, wird der Bürger von Seiten eines paternalistischen Staates mit oft absurden Sicherheitsvorschriften gegängelt. Dabei sind dessen eigene Sicherheitsbedürfnisse schon reichlich genug ausgeprägt, wo nicht Gruppen von Jugendlichen und einzelne Extremsportler vorübergehend aus diesem subtilen Zwangssystem aussteigen.
Paradoxerweise ist es gerade der private und staatliche Sicherheitswahn, der der Verdrängung der wahren Risiken Vorschub leistet. Das wird durch zwei Faktoren begünstigt: die abstrakte Größe der Gefahren und zum Teil auch ihre abstrakte Qualität wie bei der sinnlich nicht erfahrbaren nuklearen Strahlung einerseits, und dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber den großen und als abstrakt erlebten Systemen der Politik und der Wirtschaft andererseits. Was als unmittelbar erlebbar erfahren wird, ist dagegen weniger Verdrängungen ausgesetzt: Übereinstimmend zeigen alle entsprechenden Untersuchungen, dass die Hauptsorge der meisten Menschen ihrer Gesundheit gilt – obwohl wir so gesund sind und so lange leben wie nie zuvor, weshalb sie als Glücksfaktor fast nur von alten Menschen wahrgenommen wird.
In der Tat ist also gesellschaftlich gesehen das Leben nicht nur abenteuerlich im Sinne von reich an Überraschungen, sondern auch im Sinne von ungewiss und gefährlich – auch wenn die wirklichen Gefahren vielfach verdrängt werden. Im Bewusstsein des Einzelnen aber stehen die Gefährdungen des »normalen« Lebens im Vordergrund: Bleibt mir meine Gesundheit erhalten? Werde ich diese Prüfung bestehen? Schaffen meine Kinder den Hauptschulabschluss, das Gymnasium, das Abitur, die Gesellenprüfung, die Fahrprüfung usw.? Werde ich meine Arbeit verlieren? Habe ich noch Aufstiegschancen? Bleibt mir meine Frau / mein Mann treu? Übernehme ich mich bei diesem Kredit für den Hausbau? Komme ich ohne Stau durch? Es sind die vielen privaten alltäglichen Ängste, an denen sich die starken Sicherheitsbedürfnisse entzünden, und es ist die außerordentliche Komplexität und Unübersichtlichkeit des modernen Lebens, die sie schüren.
■ Das ist dann der Punkt, an dem der Satz »Sich in das Abenteuer des Lebens stürzen« einen normativen Gehalt bekommt. Gestalttherapie lehrt, dass es sich lohnt, dass es uns inneren Reichtum und innere Reife schenkt, wenn wir uns auf das Leben voll einlassen, nämlich
– mit Leidenschaft,
– ohne Rücksicht auf verinnerlichte Normen und Lebensskripte,
– unseren Gefühlen ebenso folgend wie unserem Verstand,
– immer auf das Leben selbst setzend,
– nicht auf bürokratische oder ökonomische Sicherheit bauend,
– sondern stattdessen den eigenen schöpferischen Kräften vertrauend.
Von solcher Art ist das Selbstvertrauen, das in der Gestalttherapie aufgebaut und geübt wird. Jede »Gestaltarbeit«, d. h. jede therapeutische Begegnung zwischen Gestalttherapeut und Klient, ist ein Abenteuer in dem Sinn, dass keiner von beiden weiß, wohin diese Begegnung, dieser Tanz, sie führen wird. Es ist immer ein Sich-Einlassen auf das Unbekannte. Oft führt dieses Abenteuer zunächst in eine Sackgasse, in der der Patient das Gefühl hat, dass es nicht weitergeht. Seine Energie implodiert und steht als Kraft für den Kontaktprozess nicht mehr zur Verfügung, weil er sie »retroflektiert«, d. h. auf sich selbst zurückwendet, so als würde er mit sich selbst Fingerhakeln spielen. Das Haupthindernis, aus der Sackgasse herauszukommen, sind seine Katastrophenängste. Klinische Beobachtung zeigt, dass diese Katastrophenängste umso stärker und unrealistischer werden, je stärker ein Mensch »retroflektiert«. Gestalttherapie setzt hier auf die verändernde Kraft des Gewahrseins. In den Worten von Fritz Perls: »Ich bin überzeugt, dass wir die Sackgasse überwinden können, vorausgesetzt wir widmen der Art und Weise, wie wir fest hängen, unsere volle Aufmerksamkeit.« (PHG, 174). Dann entdeckt und erfindet der Patient eine neue Lösung, einen Weg aus der Sackgasse, und entdeckt dabei Kräfte in sich selbst, die sein Selbstvertrauen, seinen Lebensmut, stärken.
Angst ist ein sehr unangenehmes Gefühl, auch wenn es sich nicht um die Furcht vor einer konkreten gegenwärtigen Bedrohung handelt, sondern um das Gefühl einer unbestimmten Angst vor nur vage vorgestellten, unklaren, eventuell nur eingebildeten Gefahren. Und das ist eben genau dann der Fall, wenn wir stark »retroflektieren«, denn dann fehlt uns die lebendige Erfahrung mit dem Teil unserer Umwelt, den wir vermeiden. Wird der Chef, mit dem ich noch nie gesprochen habe, mir wirklich demnächst kündigen, wenn ich ihn um ein paar Tage zusätzlichen Urlaub bitte, um mich um meine kranke Mutter zu kümmern? Konzentrieren wir uns auf die Lähmung des Handlungsimpulses, dann wird das Erfahrungsfeld, (die »Kontaktgrenze«) zwischen mir und dem jeweils relevanten Umfeld sofort differenzierter und lässt nun Platz für unsere kontra-phobischen Kräfte. Die (schmerzvolle) Konzentration darauf, wie wir uns blockieren, mobilisiert die Energie des unterdrückten Lebensmuts und macht uns frei für schöpferische Lösungen (für die »kreative Anpassung«). Dabei helfen uns in der Gestalttherapie die sogenannten Gestalt-Experimente; und im Leben ein risikofreudiges, aber nicht leichtsinniges, in einer Haltung von Versuch und Irrtum lustvolles Ausprobieren – kurz: ein abenteuerfreudiges und zugleich leidenschaftliches Herangehen an die aktuell vorliegenden Aufgaben.
Gehen wir also in das Abenteuer des Lebens hinein
– mit dem Mut des Vertrauens auf die eigenen Kräfte,
– mit Vorsicht im Hinblick auf unsere Schwächen,
– mit Umsicht im Hinblick auf die Ressourcen in unserer Umwelt,
– mit Rücksicht auf unsere Mitmenschen
– mit Nachsicht gegenüber unseren Feinden, denn sie sind uns ähnlicher als wir glauben,
– und mit der lebendigen Leidenschaft, die uns zum Risiko befähigt.