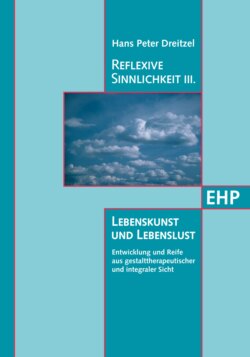Читать книгу Reflexive Sinnlichkeit III: Lebenskunst und Lebenslust - Hans Peter Dreitzel - Страница 8
Das gute Leben im schlechten gesellschaftlichen System ist der schöpferische Widerstand gegen die schlechten herrschenden Zustände; ein gesundes Leben ist ein rebellisches Leben.
Оглавление■ Tatsächlich ist die Frage berechtigt, ob es unter den Bedingungen der großen globalen Krise der kapitalistischen Gesellschaften, in der wir heute leben, ein gutes Leben überhaupt geben kann (H. P. Dreitzel 2009). Hier ist die Beobachtung von Bedeutung, dass Menschen, die sich in praktischer Arbeit und eigenem Engagement gegen die Verwüstungen stemmen, die der unkontrollierte Kapitalismus an der Natur und an den Menschen anrichtet, durchweg glücklicher und zufriedener in ihrem Leben zu sein scheinen, als diejenigen, die resigniert aufgegeben haben oder die immer gleichgültig gegenüber dem Leid anderer geblieben sind. Es geht hier also nicht um ein moralisches Argument, sondern um ein pragmatisches: Es lebt sich besser und gesünder, wenn man im Widerstand lebt. Dies ist jedenfalls der Fall, wenn der Widerstand als sinnvoll erlebt wird. Und damit dies der Fall sein kann, müssen die Ziele als prinzipiell realisierbar erlebt werden, und darüber hinaus auf die Kräfte und Ressourcen der Betroffenen abgestimmt sein. Eine wichtige, oft unabdingbare Hilfe dabei ist die Solidarität einer Aktionsgruppe: Man ist nicht allein, nutzt die Kräfte der wechselseitigen Unterstützung und der Intelligenz der Organisation.
Es lässt sich dies auch umgekehrt sagen: unter den Bedingungen der Welt-Krise kann man ein gutes, das heißt ein einigermaßen zufriedenes und als sinnvoll erlebtes Leben nur führen, wenn die eigene Vitalität, die individuelle Lebenskraft, auch in einen kreativen Zorn einfließt, der sich auf die Veränderung der lebensfeindlichen ökonomischen Systeme und der verholzten soziobürokratischen Strukturen richtet. Das ist, was die Gestalttherapie gesunde Aggression nennt.
Allerdings muss dazu erst einmal die Vitalität freigesetzt werden, die durch die Verhakung in neurotische Prozesse ständig energetisch geschwächt wird.
Je weniger dies der Fall ist, desto eher – so das »Kriterium« von Perls und Goodman –
– »verringert sich die Erregung nicht, sobald Hindernisse gegenüber dem schöpferischen Prozess auftauchen;
– bleibt die Gestaltbildung nicht stecken, sondern man erlebt spontan neue aggressive Gefühle und aktiviert neue Ich-Funktionen der Vorsicht, Besonnenheit oder Aufmerksamkeit, wie es die Hindernisse erfordern.
– verliert man dabei nicht das Gefühl für sich selbst als synthetische Einheit, sondern es wird immer schärfer; man identifiziert sich damit immer mehr und sortiert das aus, was nicht zu einem gehört.
Im Gegensatz dazu schwankt die Erregung bei einer Neurose an dieser Stelle hin und her,
– die Aggression wird nicht erlebt,
– man verliert das Empfinden für sich selbst,
– man wird verwirrt, gespalten, abgestumpft.
Dieser faktische Unterschied, der in einem fortgesetzten, ununterbrochenen schöpferischen Prozess besteht, ist das entscheidende Kriterium für Vitalität oder Neurose.« (PHG 333/334, Kursivierungen und Einrückungen von HPD).
Es gibt also sehr wohl ein Kriterium dafür, wie ein psychisch gesundes Leben auch unter den Lebensbedingungen möglich ist, die uns der globalisierte, digitale Kapitalismus auferlegt – jedenfalls in den Gesellschaften, in denen die Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse nach Nahrung, Trinkwasser und Obdach gesichert ist. Und nur in einem solchen gesellschaftlichen Kontext sind meine weiteren Überlegungen zu verstehen.
■ Aber ist ein psychisch gesundes Leben auch ein glückliches oder gar ein »gutes« Leben? Ein solches gehörte freilich niemals zu den Versprechen der Psychotherapie, jedenfalls nicht der tiefenpsychologisch orientierten. Freud war da ja eher pessimistisch: Die berühmte Formel »Aus Es muss Ich werden« bedeutete für ihn ja nicht etwa die Befreiung zu einem hedonistischen, rein lustvollen Leben, sondern die Anerkennung des »Realitätsprinzips«, nach welchem es ohne Anpassung an die gesellschaftlichen Normen kein befriedetes Leben geben kann. Das war bei Freud (auch angesichts der Katastrophe des Ersten Weltkriegs) bereits das Höchste des Erreichbaren. Das erwachsene Leben kann nicht einfach dem »Lustprinzip« folgen, menschliche Reife erweist sich für Freud in der Fähigkeit zu Triebaufschub, Triebunterdrückung und Sublimation.
Die Katastrophe erwies sich in der Folge als noch steigerbar: Adorno formulierte seinen berühmt-berüchtigten Satz »Es gibt kein gutes Leben im schlechten« angesichts der Erfahrung von Auschwitz. Dieser Satz aber lebt heimlich von der Utopie, deren Scheitern er sich verdankt – der Vorstellung nämlich, menschliches Leben könnte irgendwann und irgendwie einfach »heil« werden, also ohne selbst gemachtes Leid. Diese Illusion ist freilich erst mit der Säkularisierung christlicher Erlösungsvorstellungen in der Philosophie des deutschen Idealismus, vor allem bei Hegel, in die Welt gekommen. Das Projekt des guten Lebens aber ist eine vorchristliche Idee der Antike, die vor allem mit den Namen Epikur und Seneca verbunden ist.
■ Gestalttherapie setzt allerdings nicht darauf, die Menschen »glücklich« zu machen im Sinne von bloßer Zufriedenheit oder gar Erlösung vom Leid. Sie glaubt aber, dass der Entfaltung des Lebens mit allen seinen Potenzialen ein Gutes innewohnt. Fritz Perls setzte, angeregt von dem Philosophen Jan Christiaan Smuts und dem Gestaltpsychologen Kurt Goldstein, an die scheinbar dem Leben selbst innewohnende Tendenz zum Ausgleich der Widersprüche zum Gleichgewicht an. Während der anarchistische Zug in Paul Goodmans Denken ihn zu der Überzeugung brachte, dass die unterschiedlichen individuellen und gesellschaftlichen Kräfte und Bestrebungen sich am besten selbst regulieren. So waren diese beiden bedeutendsten Begründer der Gestalttherapie auf unterschiedlichen Wegen zu der gemeinsam vertretenen Ansicht gelangt, dass das Leben, wenn sein Wachstum weder von außen noch von innen gestört wird, von allein zu einem befriedigenden, reifen Gleichgewicht tendiert. Dieser Gedanke von Wachstum enthält jedoch noch keine Idee von Entwicklung!
Aber »jede Störung des organismischen Gleichgewichts verursacht eine unvollständige Gestalt, eine unvollendete Situation, die den Organismus zwingt, kreativ zu werden, um die Balance wieder herzustellen« (F. Perls 1980, 84). Solche Störungen können von außen kommen (selbst wenn sie wie bei Introjekten so erlebt werden, als ob sie innen seien), dann handelt es sich – in der saloppen Sprache von Perls – um »unfinished business«, eine offene Gestalt, die geschlossen werden muss; oder sie können von innerhalb des Organismus kommen, dann handelt sich um die Es-Funktionen des Selbst, d. h. um Triebe, Bedürfnisse und Interessen, die befriedigt sein wollen. Ist der Hunger gestillt, der Trieb befriedigt, die Gestalt geschlossen, dann befindet sich der Organismus in einem Zustand des relativen Gleichgewichts, der Homöostase, der lustvoll als Sättigung, Befriedigung oder Erfüllung erlebt wird, auch wenn dieser Zustand nie anhält, stets nur von relativ kurzer Dauer ist. Gelingt es uns, unsere Triebe, Bedürfnisse und Interessen immer wieder ausreichend zu befriedigen, dann werden wir uns vorübergehend zufrieden und glücklich fühlen. Für Friedrich Perls war der Gedanke der Homöostase, nach welchem »offene Gestalten« sich durch eine Tendenz zu ihrer Schließung auszeichnen, zentral, denn er passte zu der Entdeckung der Gestalt-Psychologie.
Bei PHG aber taucht der Gedanke des Gleichgewichts nicht mehr auf; hier wird das Leben implizit bereits realistischer als ein Fluss aufgefasst, in der jedes Gleichgewicht sich sofort wieder auflöst. Das war hellsichtig, denn inzwischen hat sich das Verständnis, das die Biologie vom Leben hat, deutlich verändert: Heute ist klar, dass Leben aus einer immer prekären, ständig sich konfliktreich austarierenden Balance zwischen Chaos und Ordnung entsteht. »Das Miteinander von Chaos und Ordnung bildet das eigentliche Schöpfungspotenzial der Natur«, sagt der Medizin-Forscher Friedrich Cramer. Leben wächst – und vergeht auch; und es entwickelt sich (F. Cramer, 1997; vgl. dazu auch Teil I, 1, »Die Erfahrung am Leben zu sein«). Aber es war wohl nicht einem moderneren Verständnis von der Natur des Lebens geschuldet, dass der Gedanke des Gleichgewichts keine Rolle mehr spielte. Vielmehr lag es einfach daran, dass Paul Goodman hier die bei Perls noch fehlende soziologische Perspektive mit einbrachte. Er wusste, dass befriedigende Kontaktprozesse ohne Scham nur in einer freien Gesellschaft gelingen können, und ohne Schuldgefühle nur, wenn wir unsere Mitmenschen auf diesem Weg mitnehmen. Die »sättigende Erfahrung«, wie ich in Reflexive Sinnlichkeit I das gestalttherapeutische Modell der gelingenden Kontaktprozesse zwischen Mensch und Umwelt genannt habe (H. P. Dreitzel, 2007a, Kapitel II), ist also die Grundlage jedes befriedigenden, zum Glück tendierenden Lebens. Es muss aber, um als ein »gutes Leben« bestimmt werden zu können, noch zweierlei hinzukommen:
– der Kampf gegen das, was unsere Lebenskräfte fesselt und erstickt, und
– das Teilen der »Lebens-Mittel«, wie Karl Marx sie so treffend genannt hat, die wir für die sättigenden Prozesse brauchen, mit anderen Menschen.
■ Beides verschafft uns eine eigene, zusätzliche Freude: Es gibt eine Lust, die im Bemühen um den Abbau überholter Vorstellungen von Charakter und von unnötigen Tabus entsteht, und eine Lust an der Gemeinsamkeit des Kampfes und am Verschenken des Überflusses – geteilte Freude ist doppelte Freude. Und es ist die Erfahrung von Sinnhaftigkeit unseres Handelns, die unseren Tätigkeiten, selbst wenn sie mühevoll und anstrengend sind, ihr eigenes Glück verleiht. Diese Erfahrung muss zur Erfahrung der Befriedigung unserer Bedürfnisse hinzukommen, um von einem »guten Leben« sprechen zu können, denn in ihr löst sich das Individuum aus seiner egozentrischen Vereinzelung und öffnet sich zu einer Verantwortung für seine Mitmenschen.
Wie das im Einzelnen aussehen könnte, hat zur Zeit am besten der »Transformationsdesigner« Harald Welzer in seinem Buch »Selbst denken – Eine Anleitung zum Widerstand« beschrieben (H. Welzer, 2013). Dieser Autor hat sich wie kein anderer im deutschen Sprachraum mit der Frage beschäftigt, welche individuellen und gemeinschaftlichen Handlungsspielräume uns in der gegenwärtigen Situation bleiben, welche Möglichkeiten des Widerstands es heute gegen die scheinbar unaufhaltsame Wachstumsdynamik der kapitalistischen Märkte gibt, wie überhaupt die ethische Dimension eines guten Lebens praktisch gestaltet werden kann.
Die Antworten, die die Philosophie auf die Frage danach, was ein »gutes Leben« sein könnte, entwickelt hat, haben sich von Anfang an in diesem Spannungsbogen zwischen individuellem Glück und mitmenschlicher Verantwortung bewegt. In der Antike ist es die Schule der Epikuräer, die sich am meisten um die Frage nach dem menschlichen Wohlbefinden gekümmert hat. Für Epikuros (im Folgenden nach L. Marcuse 1972 zitiert), den griechischen Begründer dieser Schule, war das höchste Gut das Glück. Und dieses Glück bestand für ihn nur aus zwei Elementen. Erstens lehrte er: »Jede Erregung körperlichen Vergnügens lässt eine Lust und Freude der Seele aus sich hervorgehen.« (85). Da ist er schon, der sättigende Prozess als Grundlage des Glücks! Zweitens aber lehrte er: »Ohne Freundschaft gibt es kein vollkommenes Glück.« Ja, er meinte sogar: »Ohne die Gesellschaft eines Freundes zu essen ist bestialisch.« (74). Seine Wertschätzung der Freundschaft geht schließlich so weit, dass er, dreihundert Jahre vor Jesus, zu dem Schluss kam: »Geben ist seliger denn nehmen.« (74)
Epikur lebte zurückgezogen in einem Garten bei Athen, der aber stets für alle unabhängig von Stand und Religion geöffnet war, die ihn besuchen oder/ und von ihm lernen und mit ihm dort leben wollten. Trotz seiner Betonung der Lust lebte er bescheiden und maßvoll, aber er teilte, was er hatte, mit jedem. Da er öffentliche Ämter verschmähte und das politische Leben mied, ließ man ihn in Ruhe. Wie leicht hätte er sonst wegen seiner Lehre wie Sokrates als Verführer der Jugend zum Tode verurteilt werden können! Dafür wurden dann aber die Epikuräer, die bei den Römern noch hohes Ansehen genossen, reichlich kritisiert, verfolgt und geschmäht, als das Christentum zur Staatsreligion geworden war. Es waren diese christlichen Kritiker, die nun die andere, die moralische Seite der Idee des »guten Lebens« besetzten, während auf der anderen Seite die Lust immer mehr als Sünde verdammt und der Körper immer mehr zu einem Ort innerer und äußerer Kasteiung wurde. Wo für das Christentum ein gutes Leben ein gottgefälliges Leben in der Perspektive einer Erlösung im kommenden Reich Gottes war, ging es den Epikuräern der Antike bis hin zu Seneca um bescheidenere Ziele als Erlösung, nämlich um
– Zufriedenheit durch maßvolle Bedürfnisbefriedigung,
– Gelassenheit im Umgang mit Schicksalsschlägen (Epikur wie Seneca wurden ins Exil getrieben) und im Ertragen von Schmerzen,
– Ausgleich der Interessen zwischen den Menschen und
– Pflege der Freundschaft, also der persönlichen Seite dessen, was wir heute Solidarität nennen, die in den Sklavengesellschaften der Antike noch nicht Thema werden konnte.
Was man von Epikur auf jeden Fall lernen sollte ist, dass ein gutes Leben stets ein sättigendes, vor allem lustvolles Leben sein muss, um ein befriedigendes Leben zu sein.
Gewiss muss man fragen, ob die Wertschätzung der Freundschaft bei den Epikuräern ausreicht, um das ganze Gewicht der sozialen Verantwortung und des Gemeinsinnes philosophisch zu tragen. Darauf antworten viele der Philosophen, die sich heute mit der Idee des guten Lebens befassen, mit dem Versuch, objektive, von individuellen Lebensentwürfen unabhängige Werte zu etablieren, die am Gemeinwohl orientiert sind und die ähnlich den Grundrechten situationsunabhängig Geltung haben.
■ Werfen wir also noch einen Blick auf den Stand der Frage nach dem guten Leben in unserer Gegenwart (H. Steifath, 1998) und schauen, ob und wieweit wir inzwischen über Epikurs einfache und vielfach geschmähte Lösung hinausgekommen sind. Zunächst ist die philosophische Entwicklung so verlaufen, dass die Idee des guten Lebens die strenge rationalistische Kritik der Aufklärung nicht überstanden hat. In einer strikten Trennung von Moral und Glück kristallisierte sich die von alters her bekannte, sprichwörtlich gewordene goldene Regel »Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg’ auch keinem anderen zu!« bei Kant zu seinem Kategorischem Imperativ, nach dem individuelles Handeln sich stets an der Maxime zu orientieren hat, dass es auch zum Maßstab der allgemeinen Gesetzgebung werden könnte. Umgekehrt wurde das Glück (»Glückseligkeit« bei Kant) von Kant nun aller Tugend beraubt und definiert als »die Befriedigung aller unserer Neigungen [sowohl extensive, der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive, dem Grade, als auch protensive, der Dauer nach]« (I. Kant, 1998, 677) und wurde damit auf das rein Subjektive beschränkt. Hier ist der alte Spannungsbogen zerschlagen, nunmehr stehen sich Glück (als Lust) und Moral (als Pflicht) unversöhnlich gegenüber.
Nach diesem Kahlschlag, der dem Individuum zu seiner vollen und alleinigen Selbstbestimmung verhelfen sollte, gab es für lange Zeit nur noch die eher bemühten sozialphilosophisch-utilitaristischen Versuche, den Wert des egoistischen individuellen Glücksstrebens für das Gemeinwohl durch Tauschtheorien zu retten: Wenn alle ihren eigenen Interessen nachgingen, so würde im Austausch ihrer Güter und Handlungen eine »unsichtbare Hand« (Adam Smith) dafür sorgen, dass der Wohlstand und das Wohl der Allgemeinheit dabei vermehrt würde. Wie wenig dieser Optimismus noch berechtigt ist, wie sehr die »unsichtbare Hand« des Marktes statt das Glück eher das Elend zu mehren imstande ist, das hat zuletzt die Krise der globalisierten Finanzmärkte von 2007 gezeigt. Immerhin aber wird seit Kant die individuelle Selbstbestimmung als ein wichtiges Kriterium für das Glück des einzelnen angesehen.
Erst in jüngerer Zeit ist parallel zur Entwicklung der Grundrechte die Diskussion um das gute Leben wieder in die Philosophie zurückgekehrt. Dabei stehen sich zwei Lager gegenüber, die beide auf ihre Weise wieder versuchen, das Glücksmoment der individuellen Bedürfnisbefriedigung mit den Tugenden der Sorge um das Gemeinwohl zu versöhnen. Der kritische Subjektivismus versucht, ein Moment des Objektiven im rein subjektiven Glücksempfinden dadurch zu retten, dass er die Handlungsstrategien des Strebens nach Glück einer peniblen Kritik unterzieht. Die Gegenposition des Objektivismus sucht dagegen nach allgemeinen Werten, die neben den individuellen Interessen mit zu verwirklichen erst das gute Leben ausmache. Beiden Positionen geht es dabei natürlich nicht um das episodische Glück momentaner Stimmungen und Affekte, sondern um das Glück eines Lebens als Ganzes. Dennoch bleibt bei dieser Diskussion in der Regel offen, ob es um das gute Leben als einzige Möglichkeit geht, oder um ein gutes Leben, von dem es verschiedene Spielarten geben kann.
Die Positionen des kritischen Subjektivismus kommen meines Erachtens aus dem Dilemma des Gegensatzes zwischen Moral und Glück nicht wirklich heraus. Die objektivistischen Positionen dagegen haben natürlich immer das Problem, dass jede Auswahl der zu erstrebenden Werte schwer zu begründen ist. Man muss nicht gleich an die Probleme denken, die die Frage nach der moralischen Berechtigung eines Tyrannenmords aufwirft (die in ihrer neuesten Version als Frage nach der ethischen Berechtigung der Eliminierung von Terroristen durch Drohnen auftritt). Wie z. B. lässt sich die Forderung nach einer Mehrbesteuerung kinderloser Paare oder allein lebender Personen ethisch begründen? Gehört es zu einem guten Leben, Kinder zu bekommen und aufzuziehen, oder kann man auch als Kinderloser ein »gutes Leben« führen? (Weitere solcher Fragen werden von M. J. Sandel, 2008, behandelt.)
■ Die Gestalttherapie hat sich solchen philosophischen Fragen versagt und sich stattdessen an die Empirie der klinisch-psychologischen Erfahrung gehalten. Und da stellt sich heraus, dass es einen lustvollen Aspekt in der »Moral« gibt und einen moralischen Aspekt im Glück des Lustvollen. Man darf unter Moral allerdings nicht eine nur metaphysisch begründbare Pflicht verstehen, wie es Kant getan hat, sondern eine spontane Haltung des Mitgefühls, deren Bedeutung unter den Philosophen am meisten Spinoza und Schopenhauer betont haben und wie sie bekanntlich zentral in den Lehren des Buddhismus ist (Dalai Lama, P. Ekman, 2008), auf den sich Schopenhauer auch bezieht. Aber es bedarf hier gar nicht der Philosophie, denn dass das Geben beglückender ist als das Nehmen, das ist eine empirisch beobachtbare Tatsache, die jeder Mensch an sich selbst erfahren kann.
Eine ebenfalls beobachtbare Tatsache ist, dass derjenige, der mit seinem Leben zufrieden ist, weil viele seiner Bedürfnisse und Interessen befriedigt sind, dieses Lebensglück auch ausstrahlt und damit seine ganze Umgebung aufhellt. In dieser Hinsicht kann die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse auch ihr Gutes für andere Menschen haben. Gewiss, diese Ausstrahlung kann auch Neid auslösen, vor allem in Gesellschaften, die stark leistungsund erfolgsorientiert sind. In der Wirkung, die glückliche Menschen auf andere haben, erweist sich bei genauerem Hinsehen, ob ihr Lebensglück eher oberflächlich, illusionär und nur der Fortuna glücklicher Umstände zu verdanken ist. Denn auch das gehört ja zur Problematik des guten Lebens, dass das Glück illusionär sein kann. Oder ob ihr Glück auf der Sinnhaftigkeit von Zielsetzungen beruht und auf der Gelassenheit im Umgang mit Krisen und Scheitern. Ich vermute, dass es Unterschiede bei der Ausstrahlung gibt: Negative Gefühle wie Neid und Konkurrenz werden wohl eher beim ersteren Fall ausgelöst, während im zweiten Fall solche Menschen auch zu Vorbildern werden können, die zu mehr eigener Kreativität ermutigen: Lebensfreude kann auch ansteckend wirken.
Es ist hilfreich, neben den empirischen Erfahrungen der Psychotherapie auch den empirischen Ergebnissen der Sozialforschung Beachtung zu schenken, wenn es um die Frage geht, was Menschen glücklich macht. Eine solche Forschung gibt es inzwischen (eine erste Zusammenfassung findet sich bei A. Bellebaum, 2011) und ihre Ergebnisse fördern auch Überraschendes zutage. So gibt es z. B. kaum einen Zusammenhang zwischen dem Gefühl, glücklich zu sein, und dem Besitz von Geld oder Schönheit oder Gesundheit! In der Tat scheinen viele der sehr reichen Menschen ziemlich unglücklich zu sein. Aber da muss gefragt werden: Sind wirklich ihre Bedürfnisse und Interessen ganz und gar befriedigt, nur weil sie viel Geld haben? Einige gehen ihren Interessen dadurch nach, dass sie ihr Geld in Stiftungen geben und oft diese auch selbst leiten. Offenbar macht sie das glücklicher. Aber entscheidend ist hier die Erkenntnis, das Geld im Überfluss als solches eben nicht glücklich macht. Eine neuere Untersuchung in den USA fand heraus, dass die Grenze bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro liegt – bis dahin macht jeder Anstieg des Einkommens glücklicher, danach geht es langsam bergab mit den wohlstandsbedingten Glücksgefühlen – eine überraschend niedrige Grenze, wenn man den Kampf um Boni und ähnliche Perversitäten in der Finanzwirtschaft beobachtet. Reichtum als solcher ist in sich kein als sinnvoll erlebbares Ziel. Das zeigt auch die sogenannte Reichtum-Studie (SPIEGEL-ONLINE, Wirtschaft, 7.9.2010). Die beste Quelle, wenn man fragt, was die empirische Wissenschaft bisher über die Faktoren herausgefunden hat, die ein langes Leben gelingen lassen, ist aber die sogenannte »Grant-Studie«. In dieser Langzeituntersuchung wurden zwei Kohorten von privilegierten und unterprivilegierten Männern 75 (!) Jahre lang in zweijährigen Abständen auf die Glücks- und Unglücksmomente in ihrem Leben hin untersucht. In einem Interview sagt der langjährige Leiter dieser Studie (G. E. Vaillant, 2013): »Reich zu sein ist kein Garant für Glück. Geld kann zweifellos Freude bereiten, doch an Reichtum gewöhnt man sich schnell. Dann wird er unbedeutend.«
Dass körperliche Schönheit ein sehr zwiespältiges Geschenk der Natur ist, belegen unzählige leidvolle und unglückliche Geschichten von schönen Menschen, die mit der Last der übergroßen Aufmerksamkeit, die ihnen oft schon in der Kindheit zuteil geworden ist, nicht umgehen konnten. Überraschend dagegen scheint die Aussage; dass auch Gesundheit für unser Lebensglück nur eine geringe Rolle spielen soll. Ich erkläre das vor allem damit, dass wir den gesunden Zustand unseres Körpers als den normalen erleben – der nicht vorhandene Schmerz wird nicht gespürt und leicht vergessen. Der gesunde Körper steht nur bei mehr oder weniger starken Lustgefühlen im Vordergrund unseres Erlebens – oder wenn wir ihm in erhöhtem Gewahrsein, etwa bei einer Meditation, besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Im Übrigen steht dieses Ergebnis auch im Gegensatz zu dem hohen Stellenwert, die die Sorge um die Gesundheit in vielen Studien erreicht.
Darüber hinaus gibt es zwei eindeutige Ergebnisse der empirischen Glückforschung, die beide den in der Philosophie des guten Lebens aufgespannten Bogen zwischen subjektiv-individuellen Faktoren und objektiv an Werten orientierten Faktoren bestätigen: Offensichtlich ist die Art und Weise, wie Menschen die Welt erleben, ihre persönliche Sichtweise, wichtiger als die objektiven Umstände ihres Lebens. Das bestätigt auch die therapeutische Erfahrung, dass Veränderung, Linderung des Leidens also, oft schon durch einen bloßen Perspektivwechsel erreicht werden kann – entsprechend dem nach dem amerikanischen Soziologen William Issac Thomas benannten Thomas-Theorem: »Wenn Menschen eine Situation als real definieren, dann ist sie auch real in ihren Wirkungen«. Das andere wichtige Ergebnis der Glücksforschung ist die große Bedeutung, die die eigenen Lebensziele für die Erfahrung von Sinn und Glück im eigenen Leben besitzen.
■ Beides aber reicht noch nicht aus, um allein schon das Gefühl eines glücklichen Lebens zu vermitteln. Zweierlei muss noch hinzukommen: Zum einen der Blick auf die Gesamtheit des Lebens. Akzidentelle Glücksmomente versinken schnell in eine vergangenheits- und zukunftslose Gegenwart. Werden sie auf Dauer gesucht, so kommt es zu einer bloßen Aneinanderreihung solcher Momente, die früher oder später als schal erlebt wird. Ein hedonistisches Leben macht nicht glücklich. Gunter Sachs, dessen Lebensstil stets als Inbegriff des Hedonismus galt, war nichtsdestoweniger ständig mit Tätigkeiten als Fotograf, Astrologe, Kunstsammler und Finanzjongleur u. a. beschäftigt, um seinem Leben einen Sinn zu verleihen, und schied aus dem Leben, als ihm im Alter die Projekte ausgingen (vgl. SPIEGEL Nr. 15, 8.4.2013). Mit zunehmender Reife leben wir mehr und mehr auf ein als Ganzes erfahrbares Leben hin, das bei allem Auf und Ab des Erfolges und des Scheiterns insgesamt auf ein Gelingen angelegt ist. Darauf verweist ja eben der von manchen alternativ zum Begriff des guten Lebens verwendete Begriff eines gelingenden Lebens.
Zum anderen muss eine Erfahrung von Sinnhaftigkeit hinzukommen. Nur wird das, was wir als Sinn erleben, selten als Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens formulierbar sein. Diese Frage, die manchmal auch dem Therapeuten gestellt wird, ist letztlich nicht zu beantworten (und darf von diesem auch versuchsweise nicht beantwortet werden!). Dennoch gibt es ein klares Gefühl von Sinnhaftigkeit bestimmter Lebensvollzüge und zuweilen eben auch des ganzen Lebens, das sich einstellt, wenn es gelingt, das eigene Leben auf das Erreichen von Zielen auszurichten, die jenseits der eigenen Person liegen. Wenn sich dieses Gefühl paart mit dem Glücksgefühl der Befriedung der eigenen Bedürfnisse, dann kann wohl mit Recht von einem guten Leben gesprochen werden.
Der Philosoph Martin Seel hat als Kriterium für ein gutes, also befriedigtes, sinnhaft orientiertes, gelingendes Leben diese Formel vorgeschlagen: »Das gute Leben ist eines, das sich im Modus freier Weltbegegnung vollzieht.« (M. Seel, 1998, S. 280). Das könnte man auch als Fazit des Menschenbildes der Gestalttherapie so sagen. »Frei« hieße dabei sowohl selbstbestimmt als auch Spielräume für diese Selbstbestimmung gewährend, die natürlich häufig genug durch äußere Umstände oder innere Behinderungen eingeschränkt sind. »Weltbegegnung« kann man gestalttherapeutisch verstehen als den Kontakt zwischen Mensch und Umwelt, das heißt als den »sättigenden Prozess«, durch den sich jeder nährende, für das menschliche Wachstum notwendige Austauschprozess mit der Welt vollzieht. Und Begegnung ist dann in dieser Perspektive die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, zum »vollen Kontakt« zu gelangen, diesem vorübergehenden, aber sich potenziell in jedem Kontaktvorgang wiederholenden Zustand der Integration von Subjekt und Objekt im Verschmelzen von menschlichem Organismus und Umwelt am jeweiligen Punkt ihrer Berührung zu einer Einheit des Erlebens (vgl. S. 64/65).
■ Wir müssen nur noch das Kriterium des Gewahrseins hinzufügen, diese nur dem Menschen eigene Fähigkeit eines kognitiven Zustands des Bewusstseins der Leibhaftigkeit unserer Erfahrung von Welt, mit dem wir uns auf die »Kontaktgrenze«, den Berührungspunkt zwischen Subjekt und Objekt, konzentrieren können. Diesen Zustand werde ich im weiteren Verlauf meiner Überlegungen auch Bewusstheit oder reflexive Sinnlichkeit nennen. Das Gewahrsein ist in der Gestalttherapie, die von Friedrich und Lore Perls ursprünglich Konzentrationstherapie genannt wurde, das heilende Agens, das, was »gesund« macht. Dazu gehört auch,
dass, wenn diese »Weltbegegnung« mit erhöhtem Gewahrsein geschieht, wie von selbst ein eigentümliches Verantwortungsgefühl für die jeweilige Umwelt entsteht, eine Sorge für das Objekt unserer Begegnung, also insbesondere für unsere Mitmenschen, aus der längerfristig die Sinnhaftigkeit und Zielorientierung eines Lebens erwächst. So gesehen enthält das Menschenbild der Gestalttherapie in der Tat das Projekt eines guten Lebens, wie es eine jahrtausendealte philosophische Tradition vor und jenseits des Christentums im Abendland entwickelt hat.
Wie dieses Projekt im Einzelnen aussieht, soll nun im ersten Teil dieses Buches anhand ausgewählter Stichworte erläutert werden.