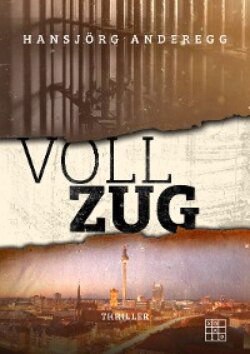Читать книгу Vollzug - Hansjörg Anderegg - Страница 10
ОглавлениеKapitel 6
Fos-sur-Mer bei Marseille, 13. Juni
Mohammed Hamidi beobachtete durch das Fernglas, wie die ›Baleine‹ an der Mole von Fos-sur-Mer anlegte. Aus seinem leicht erhöhten Versteck konnte er die Hafenanlage des riesigen Flüssiggasterminals fünfzig Kilometer westlich von Marseille gut überblicken. Keine Bewegung auf dem Schiff und am Kai entging seinen scharfen Augen. Die Gelenkarme der Entladestation schimmerten silbrig in der Abendsonne. Nahezu vollautomatisch dockten sie an die Stutzen der Tanks an, die wie gigantische Seifenblasen aus dem Bauch des Frachters ragten. Wenige Minuten nach dem Andocken öffneten Arbeiter die Ventile. Das flüssige, auf -160 °C gekühlte Methan begann in die Rohre zu strömen, die es in die nahen Vorratstanks leiteten. Über hunderttausend Kubikmeter fasste ein einziger dieser isolierten Behälter, die manches Hochhaus überragten.
Mohammed Hamidis Puls beschleunigte sich beim Gedanken an diese schier unerschöpflichen Brennstoffvorräte. Er richtete sein Fernglas auf die Gruppe der Verwaltungsgebäude und Werkstätten. Alles hing jetzt vom Insider ab. Wenn der Junkie versagte, konnten sie ihren Plan begraben. Die Zeit verrann zähflüssig wie die Melasse auf den Baklava seiner Schwester. Der Tag wollte nicht enden. In der hellen Dämmerung war es schwierig, das Licht in den Büros der Sicherheitszentrale überhaupt zu erkennen. Eine weitere unerträgliche Stunde verging, bevor das Licht in den Fenstern erlosch, wieder aufflammte, dreimal in kurzen Abständen.
»Das Zeichen!«, rief er seinen Leuten zu, die gelangweilt unter der alten Eiche Karten spielten und rauchten.
Kurz danach beobachtete er, wie ein weißer Van vom Gebäude wegfuhr, auf die Einfahrt zu, wo sie sich treffen wollten.
»Auf geht‘s, Brüder. Allah sei mit uns.«
Der Insider saß mit aschfahlem Gesicht am Steuer des Wagens.
»Hast du die Steine?«, fragte er mit zittriger Stimme.
Mohammed Hamidi legte das Päckchen mit dem Rauschgift ins Handschuhfach. Die Augen des Fahrers wollten aus den Höhlen treten. Seine Hand fuhr an den Knopf, um das Fach wieder zu öffnen.
»Ich brauche jetzt etwas!«, rief er mit rauer Stimme.
Sofort drückte ihm einer von Hamidis Männern den Lauf seiner Maschinenpistole in den Nacken. Der Insider fuhr los, an den Gebäuden vorbei, entlang den Pipelines zur Mole, wo die ›Baleine‹ angedockt war.
»Alles ausgeschaltet?«, fragte Hamidi beiläufig.
Er kannte die Antwort, aber die Frage sollte den Fahrer beruhigen, dessen Hände am Steuer merklich zitterten.
»Klar, wäre ich sonst hier?«, brummte der gereizt.
Ihr Vertrauensmann an Bord der ›Baleine‹ erwartete sie an der offenen Luke. Der Ladebaum schwenkte aus. Das Paket aus Algerien glitt nahezu lautlos am Flaschenzug zu Boden. Stumm hievten sie es in den Van, während sich die Luke über ihnen schloss. Kaum zehn Minuten, nachdem sie ins Auto gestiegen waren, fuhren sie mit der kostbaren Fracht Richtung Tank Nummer zwei, voll mit flüssigem Methan nach Angaben des Insiders. Mohammed Hamidi suchte die Umgebung mit dem Fernglas ab, bevor sie sich der Stelle näherten, wo das Flüssiggas vom Tank in die Pipelines zur Aufbereitungsanlage floss. Es war das schwächste Glied im Speichersystem, bestens für ihre Zwecke geeignet. Weit und breit war kein unerwünschter Zuschauer auszumachen. Niemand beobachtete, wie sie das Paket unmittelbar am Tank zwischen die Rohre schoben, denn auch die Überwachungskameras blieben ausgeschaltet.
Mohammed Hamidi nickte zufrieden. Bisher verlief die Aktion genau nach seinem Plan. Nun begann die letzte, heikelste Phase. Er kontrollierte die Uhr: 21:20 Uhr, perfekt. Basem Mansour, sein junger Vertrauter, kniete bereits neben dem Paket. Er öffnete das rote Kästchen an der Hülle, aus dem ein Kabel ins Innere führte.
»Welche Zeit soll ich einstellen?«, fragte er seinen Anführer.
»Punkt zehn Uhr wie geplant.«
Basem kannte sich mit Computern aus. Nichts anderes als ein kleiner Computer steuerte die Zündelektronik im roten Kästchen. Mit angehaltenem Atem sahen ihm die Brüder und der Fahrer zu, der jetzt am ganzen Leib zitterte. Das ist nicht der Schüttelfrost des Entzugs, dachte Mohammed Hamidi verächtlich. Der Insider hatte Angst, Angst um sein erbärmliches Leben. Nur ein Ungläubiger konnte ein solcher Feigling sein, war er überzeugt.
Basem Mansour erhob sich.
»22:00 Uhr ist eingestellt. Die Zeit läuft.«
»Gut.«
Mohammed nahm das Drogenpaket aus dem Handschuhfach und steckte es ein. Der Fahrer starrte ihn entsetzt an, wagte aber nichts zu sagen.
»Du bringst die Brüder zu ihrem Wagen, dann kehrst du mit dem Van hierher zurück«, wies Mohammed ihn an. »Sobald du zurück bist, gehört das Zeug dir.«
Die Männer sahen sich konsterniert an. Niemand begriff, was er vorhatte. Dieser letzte Akt war nicht so besprochen worden. Wie erwartet, kehrte der weiße Van rasch zurück. Er gab dem Fahrer den heiß ersehnten Lohn. Mit fiebrigen Händen riss der Junkie das Paket auf. Abgelenkt durch seine Sucht, bemerkte er die Bewegung hinter seinem Rücken nicht. Mohammeds Schlag traf in den Nacken und streckte ihn zu Boden. Noch einmal schlug Mohammed zu. Die Faust mit dem Schlagring hinterließ eine klaffende Wunde an der Schläfe des Fahrers. Er rührte sich nicht mehr. Mohammed Hamidi ließ ihn liegen. Es interessierte ihn nicht, ob der Ungläubige noch lebte. Spätestens in fünfzehn Minuten würde er sowieso den Tod des drogenabhängigen Verräters sterben. So jedenfalls würde sich der Tatort den Ermittlern präsentieren, sollte überhaupt etwas von ihm und dem Wagen übrig bleiben. Mohammed zog den Zündschlüssel ab und rannte, so schnell ihn seine Beine trugen, zur Einfahrt und weiter die Straße hinunter, die zum Versteck führte.
Basem Mansours Uhr zeigte 21:59 Uhr.
»Wo bleibt Mohammed?«, fragte er, Schlimmes ahnend. »Warum ist er nicht mit uns zurückgefahren?«
Der Bruder an der Videokamera war zehn Jahre älter und entsprechend erfahrener.
»Mohammed muss sich um l‘initié kümmern«, murmelte er zweideutig.
Im nächsten Augenblick zuckte ein gewaltiger Blitz durch die Nacht, der das ganze Gelände in grelles Licht tauchte. Ihm folgte ein ohrenbetäubender Donnerschlag. Eine Stichflamme schoss in den Himmel, als hätte Allah selbst seine Fackel am Tag des Gerichts entzündet. Gleichzeitig traf sie die Druckwelle. Die Wucht des durch die Explosion entfesselten Sturms schleuderte sie zu Boden und mit ihnen die Kamera. Der Druck erfasste ihren Wagen, drohte das tonnenschwere Geländefahrzeug zu kippen. Sekundenlang schwebte es auf zwei Rädern, bis es wieder auf den Boden krachte.
»Allahu akbar!«, riefen alle durcheinander.
Während die andern sich im Freudentaumel umarmten und lachend zu tanzen begannen, richtete der Kameramann seinen Apparat mit dem starken Teleobjektiv erneut auf das Inferno. Die Gewalt der Explosion hatte ein Loch in den Tank Nummer zwei gerissen. Das ausfließende Methan verdampfte sofort und entzündete sich. Der höllische Flammenwerfer versprühte sein Feuer in Sekunden über die ganze Industrieanlage. Pipelines barsten. Die Gebäude standen in hellen Flammen, bevor die erste Alarmsirene aufheulte. Hundert Meter lange Feuerzungen leckten an dürren Büschen. Bäume und trockenes Gras brannten wie Zunder. Als wäre das nicht Apokalypse genug, fachte der Scirocco die Höllenglut weiter an. Der trockene Südwind aus Nordafrika hatte kräftig zugelegt in den letzten Stunden. Die Böen trieben die Flammen mit rasender Geschwindigkeit ins Landesinnere. Bald würden die Hügel hinter Fos-sur-Mer und Richtung Marseille brennen wie Scheiterhaufen für die Ungläubigen.
»Wir können nicht länger warten«, drängte der Kameramann.
Auf der Zufahrtsstraße näherte sich eine blinkende Lichterkette. Feuerwehr und Gendarmerie rückten in Divisionsstärke an. Sie mussten über ihren Schleichweg verschwinden, bevor die Hubschrauber auftauchten und die Gegend mit ihren Suchscheinwerfern unpassierbar machten.
»Mohammed?«, rief Basem Mansour den Brüdern zu, die bereits einstiegen.
»Mohammed weiß, was er tut«, antwortete der Mann, der sich ans Steuer setzte. »Steig endlich ein!«
Kurz nach Erreichen der brennenden Steppe der Coussouls de Crau stand plötzlich Mohammeds bärtige Gestalt auf der Straße. Lachend, mit Schulterklopfen empfingen ihn die Gotteskrieger. Der Geländewagen beschleunigte und fuhr in halsbrecherischem Tempo Richtung Arles, von wo sie über Aix-en-Provence nach Marseille zurückkehren würden. Geschwindigkeitskontrollen mussten sie in dieser Nacht keine befürchten.
Marseille
Jochen Preuss murmelte etwas, das nur er verstand.
»Wie bitte?«, fragte Amira Saidi, ohne die Augen vom kleinen Fernseher im Haus am Boulevard de la Méditerranée zu lassen.
Beide starrten gebannt auf die Bilder, die seit dem frühen Morgen ganz Frankreich erschütterten. Alle Kanäle unterbrachen ihre normalen Sendungen, um über die verheerende Explosion im Flüssiggasterminal von Fos-sur-Mer zu berichten. Einsatzkräfte aus weiten Teilen des Landes waren vor Ort, um Verletzte und Todesopfer zu bergen. In der Industrieanlage hatte kaum jemand überlebt. Alles ging viel zu schnell. Die Leute hatten keine Chance. Viele verbrannten bei lebendigem Leib. Feuerwehr-Brigaden aus Marseille, Nizza, Toulon, Arles und Nîmes, ja sogar Lyon und Spezialisten aus Paris versuchten in fast aussichtslosem Kampf, die Waldbrände einzudämmen. Die kleine Gemeinde Fos-sur-Mer wurde unter schwierigen Umständen evakuiert. Die Bewohner mussten hilflos mit ansehen, wie die Flammen ein Haus nach dem andern verzehrten.
An der Pressekonferenz um zehn Uhr gab der Bürgermeister mit erstickter Stimme und Tränen in den Augen bekannt, dass man Fos-sur-Mer aufgeben musste. Die Einsatzkräfte waren überfordert. Es gab weder genug Leute noch Tankwagen und Löschflugzeuge. Man konzentrierte die Einsätze, um wenigstens Aix-en-Provence und die westlichen Vororte Marseilles zu schützen. Sechs Kompanien der Force Terrestre der französischen Truppen mit schwerem Gerät wurden aufgeboten, und der Präsident selbst war unterwegs ins Katastrophengebiet.
Der Lagebericht des verantwortlichen Kommandanten der Gendarmerie begann mit der nüchternen Feststellung:
»Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei der Explosion um einen gezielten Anschlag handelt.«
Amira schlug die Hände vors Gesicht und begann, leise vor sich hinzumurmeln. Preuss glaubte, den Namen Basim oder Basem zu vernehmen. Sie stand auf, um den Ton leiser zu drehen. Ihr Gesicht sah blass aus und um Jahre älter mit den Sorgenfalten auf der Stirn. Sie setzte sich wieder hin, trank einen Schluck Tee und hielt das Glas mit beiden Händen.
»Wer tut so etwas Schreckliches?«, fragte sie mit belegter Stimme.
Er nickte nachdenklich. »Und vor allem: weshalb?«
Das Attentat übertraf seine schlimmsten Befürchtungen. Nach den Gerüchten vom vergangenen Samstag war er auf vieles gefasst, aber nicht auf diese neue Dimension des Terrors. Er beobachtete Amira mit Sorge. Sie wich seinem Blick aus, sprach kaum ein Wort. Etwas lag auf ihrer Seele. Seine sanften Versuche, sie zum Reden zu bringen, fruchteten nicht. Schließlich ließ er den Namen fallen, den er gehört zu haben glaubte:
»Machen Sie sich Sorgen um Basim?«
Ihre großen, dunklen Augen schauten überrascht zu ihm auf. Er fürchtete, sie würde jeden Augenblick anfangen zu weinen.
»Basem«, korrigierte sie so leise, dass er es kaum verstand.
»Wer ist Basem, was ist mit ihm?«
Eine lange Pause entstand, bevor sie den Kopf schüttelte und seufzte:
»Ich kann nicht darüber reden.«
»Können Sie nicht oder wollen Sie nicht?«
»Beides«, sagte sie trotzig.
Wenn eine Frau so etwas behauptete, war es zwecklos, weiter zu fragen. Das hatte er in all den Jahren von Manon gelernt. Dennoch reizte es ihn, mehr über diesen Basem zu erfahren.
»Basem ist Ihr Freund, stimmt‘s?«, fragte er lächelnd.
Sie reagierte so heftig, dass er erschrak. Sie sprang auf, rannte aufgelöst zur Toilette und schloss sich ein. Durch die dünne Tür hörte er sie schluchzen. Er wartete, bis sie sich beruhigte, dann entschuldigte er sich:
»Es tut mir leid, Amira. Es geht mich alles nichts an, aber wenn Sie jemanden zum Reden brauchen – ich bin da, und ich schweige wie ein Grab.«
Es blieb eine Weile mäuschenstill, bis sich die Tür langsam öffnete. Amira trat mit verweinten Augen heraus. Sie hatte den Entschluss gefasst, ihn ins Vertrauen zu ziehen, denn sie begann:
»Was ich Ihnen jetzt sage, muss unter uns bleiben. Niemand darf erfahren, dass ich mit Ihnen darüber gesprochen habe.«
»Selbstverständlich«, antwortete er, verblüfft über diese fast flehend ausgesprochene Bitte.
Zögernd fuhr sie weiter:
»Basem Mansour und ich lieben uns seit Langem. Heimlich. Niemand sonst weiß etwas davon, am allerwenigsten meine Eltern. Vater traut ihm nicht. Er hat …«
Sie stockte, schüttelte den Kopf und meinte:
»Das ist nicht wichtig. Ich mache mir große Sorgen um Basem. Er hängt dauernd mit dem brutalen Mohammed herum.«
»Mohammed Hamidi, der Bärtige …«
Ein bitteres Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Schwarze Bärte tragen sie alle, aber es stimmt: Ich meine den Mann, der neulich gegen Ihre Bekannte gewettert hat. Der ist böse. Seine ganze Clique ist böse.«
Wieder entstand eine Pause, dann gab sie sich einen Ruck.
»Kommen Sie, ich zeige Ihnen, was ich herausgefunden habe.«
Sie führte ihn hinters Haus, ängstlich darauf bedacht, dass niemand sie beobachtete. Vor einem Schuppen blieb sie stehen. Sie tastete nach dem Schlüssel in einem Spalt unter dem Fenstersims und schloss auf. Da die meisten Holzläden zugezogen waren, drang nur wenig Licht ins Innere. Im Halbdunkel erkannte er einen Stapel Bretter, Drähte, Nägel und Schachteln voller Schrauben. Material, wie er es früher für seine Kunstprojekte benutzt hatte. Im Hintergrund stand ein großer Holztisch, darum herum Stühle. In der Ecke lagen dicke Lederkissen um eine Wasserpfeife verstreut, als hätten sich die Raucher eben vom Schwatz erhoben.
»Da halten sie ihre Versammlungen ab«, erklärte Amira.
»Wer sind sie?«
»Mohammed Hamidi, drei andere, die ich nicht kenne und Basem.«
»Sieht ziemlich harmlos aus.«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Ich habe zufällig gehört, wie Mohammed von einem Plan sprach, einer ganz großen Sache. Das hat mich neugierig gemacht.«
Sie ging zu einer Stelle, wo ein Stück Wellblech die morschen Dielen bedeckte.
»Sehen Sie, was ich gefunden habe«, sagte sie, während sie das Blech etwas anhob.
Das fahle Licht genügte, um auf Anhieb zu erkennen, was sich in der großen Vertiefung darunter befand. Die Plastiksäcke mit bunten Tabletten, braunem und weißem Pulver waren kaum zu verwechseln.
»Rauschgift«, murmelte er überrascht.
Rauschgift war tägliches Brot in den Banlieues, aber er hatte etwas anderes erwartet.
»Heroin, Crack, und wie das Dreckszeug noch heißen mag«, ereiferte sie sich. »Das macht mir Angst.«
Dazu hatte sie allen Grund, doch diesen Gedanken behielt er für sich. Schweigend betrachtete er das Drogenlager und fragte sich, wie viel Geld hier wohl liegen mochte. Das Gramm Heroin war auf der Straße für etwa dreißig Euros zu haben, falls er sich richtig erinnerte. Hier lagen mindestens zwanzig Kilogramm.
»Basem ist doch ein anständiger Mensch«, klagte Amira. »Was soll ich jetzt tun?«
Die Millionenfrage blieb unbeantwortet. Stimmen näherten sich dem Schuppen. Starr vor Schreck blickten sie sich an. Zwei Männer unterhielten sich an der Tür.
»Basem«, flüsterte Amira entsetzt. »Er kontrolliert das Lager. Verstecken Sie sich!«
Hastig schob sie das Blech an den ursprünglichen Platz und rannte zum Bretterstapel. Ihm blieb nur noch Zeit, unter den Tisch zu kriechen, bevor die Tür aufflog.
»Amira!«, rief einer der Männer.
»Was hat die hier zu suchen?«, fragte eine tiefere Stimme.
Jochen Preuss atmete auf unter dem Tisch. Keine der Stimmen gehörte dem unerbittlichen Mohammed Hamidi.
»Müsst ihr mich so erschrecken?«, fragte Amira scheinbar ruhig.
Preuss beobachtete, wie einer der Männer auf sie zutrat.
»Was tust du hier?«
Seine Stimme klang eher besorgt als misstrauisch.
»Das siehst du doch, Basem. Ich suche Material für eine Arbeit.«
Jochen Preuss konnte die Frau nur bewundern für ihren Mut und kühlen Verstand. Seine Erleichterung währte jedoch nicht lange. Die Beine des zweiten Mannes schritten schnell auf ihn zu. Neben den Beinen baumelte eine Hand. Sie umklammerte eine kompakte Maschinenpistole, als wäre sie angewachsen. Preuss hielt den Atem an. Der Mann stand keinen Meter entfernt, als er ausrief:
»Verfluchte Ratte!«
Auf Arabisch hörte sich der Fluch wie Peitschenhiebe an. Mit einem Satz sprang der Unbekannte weg und stampfte auf das Blech, dass die Dielen krachten.
»Lass das, wir räuchern sie aus«, rief Basem lachend.
Schimpfend trottete sein Kumpan zurück und verschwand zur Tür hinaus. Von diesem Tag an liebte Jochen Preuss die Ratten. Kaum war der Mann fürs Grobe außer Sichtweite, umschlangen sich Basem und Amira wie zwei ausgehungerte Teenager. Da ist guter Rat teuer, dachte er, auf ein schnelles Ende der Zärtlichkeiten hoffend. Sein Rücken rebellierte gegen die verkrampfte Haltung, und die Muskeln in den Beinen wollten endlich gestreckt werden.
Ein Ruf von draußen trieb die beiden auseinander.
»Geh nur, ich schließe dann zu«, sagte Amira.
Preuss wartete mit angehaltenem Atem, bis sich die Stimmen entfernten, bevor er sich aus dem Versteck wagte. Ächzend streckte er die Glieder, beglückwünschte Amira zu ihrer Geistesgegenwart und meinte mit schiefem Grinsen:
»Ich bin eindeutig zu alt für solche Späße.«
Sie sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren.
»Wenn Mohammed dabei gewesen wäre, hätten wir beide es nicht überlebt«, sagte sie mit bebender Stimme.
Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Wir wollen mal nicht übertreiben«, versuchte er zu beruhigen, obwohl er ahnte, dass sie nicht übertrieb.
Wie zwei Kinder mit schlechtem Gewissen in Nachbars Garten schlichen sie ins Haus zurück. Bevor er sich verabschiedete, erinnerte er sich an ihre Frage. Er drückte ihre Hand länger als üblich und sagte mit ernstem Gesicht:
»Sie müssen sich entscheiden, Amira. Basem ist in eine schlimme Sache geraten. Reden Sie ihm ins Gewissen. Versuchen Sie, ihn dem schlechten Einfluss Mohammed Hamidis zu entziehen, sonst reißt er sie eines Tages mit in den Abgrund.«
Sie senkte die Lider und flüsterte tonlos: »Ich weiß.«
»Keine Angst, ich werde schweigen wie ein Grab, wie versprochen«, versicherte er beim Verlassen des Hauses.
Er durfte den Kontakt zu Amira und den Jugendlichen in ihrer Einrichtung nicht aufs Spiel setzen, indem er die Drogenfahnder auf sie hetzte. Auch nicht bei zwanzig Kilo Heroin.