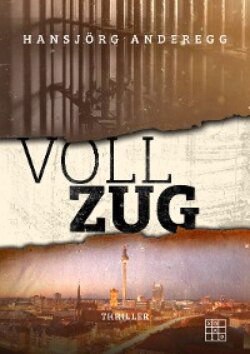Читать книгу Vollzug - Hansjörg Anderegg - Страница 7
ОглавлениеKapitel 3
Wadi Djedi, Algerien
Der sandfarbene Hummer passierte den Posten am Eingang zur Schlucht, ohne anzuhalten. Islam Bencherif hob kurz die Faust zum Gruß und als Zeichen, die zwei Kalaschnikows in der Grotte über der Wüstenpiste sehr wohl bemerkt zu haben. Ein paar Hundert Meter weiter stoppte er abrupt. Wie auf ein geheimes Zeichen füllte sich die felsige Einöde mit Leben. Ein flüchtiges Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes am Steuer. Sein Camp im Wadi Djedi war hervorragend getarnt, unmöglich aus der Luft zu entdecken, solang sich die Bewohner in den Höhlen beiderseits der Schlucht verbargen. Bärtige Männer umringten das staubige Gefährt. Fäuste flogen in die Luft und Hochrufe begrüßten den Anführer, stets begleitet vom begeisterten »Allahu akbar!« – »Allah ist groß!«.
Islam Bencherif stieg aus und überließ es wie üblich seinem Adjutanten, das Fahrzeug ins Versteck zu fahren und die Spuren zu beseitigen. Er nickte seinen Brüdern nur kurz zu und zog sich mit Sorgenfalten auf der Stirn in seine Höhle zurück. Die Unterredung mit dem Emir war nicht nach seinem Wunsch verlaufen, ganz und gar nicht. Mehr denn je war er überzeugt vom nahen Ende der Herrschaft des Weisen, wie die Anhänger den Emir ehrfürchtig nannten. Der alte Mann zeigte zu viele Schwächen. Unfähig, die immer zahlreicheren Splittergruppen der AQIM, der gefürchteten al-Qaida des Islamischen Maghreb, zusammenzuschweißen, ruhte er sich auf seinen Lorbeeren aus, sonnte sich in den Lobpreisungen der einfachen Kämpfer und lebte nur noch in der Vergangenheit. Es war Zeit für eine Erneuerung, drohte der Heilige Krieg doch buchstäblich im Sande zu verlaufen. Dafür hatten er und die Zehntausende ehemaliger Freiheitskämpfer des FLN und des GIA nicht die unzähligen Opfer gebracht. Dafür lebten sie nicht das harte Leben der Guerilla. Der Feind war näher denn je. Die algerische Armee bereitete ihm weniger Sorgen als die französischen Truppen und die Blauhelme im benachbarten Mali. Die verfluchten Franzosen hatten seine lukrativste Geldquelle praktisch zum Versiegen gebracht. Der ehemals florierende Schmuggel südamerikanischer Drogen durch den Maghreb in den Nahen Osten und nach Europa existierte praktisch nicht mehr. Sie brauchten neue, sichere Routen. Deshalb war die Unterstützung oder mindestens Toleranz und Zurückhaltung der Tuareg des ›Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA)‹ so wichtig, doch der Emir lehnte Verhandlungen mit den in seinen Augen säkularen Nationalisten rundweg ab.
Motorenlärm schreckte ihn aus den Gedanken. Er erkannte den Jeep seines Technikers am röhrenden Geräusch. Kurz danach erschien die hagere Gestalt des jungen Fahrid Saadi am Eingang. Er grüßte ihn mit freundlichem Lächeln. Sein Techniker gehörte einer neuen Generation von Dschihadisten an. Wie die alten Kämpfer hatte er sich mit Leib und Seele der Sache der Gläubigen verschrieben, aber im Unterschied zu den meisten seiner Leute verfügte Fahrid über umfangreiche technische Kenntnisse und kämpfte vor allem mit seinem scharfen Verstand. Ohne jemanden wie Fahrid wäre sein großer Plan nicht umzusetzen.
»As-salamu alaikum«, grüßte der Techniker. »Das Paket ist auf dem Weg zum Hafen.«
»Gut, Fahrid. Ich habe nichts anderes erwartet. Die Brüder sind instruiert, wie wir besprochen haben?«
Fahrid nickte. »Sie sind bereit.«
Er wandte sich zum Gehen.
Islam Bencherif hielt ihn zurück. Er reichte ihm ein Papier mit der Bemerkung:
»Der Text für die Botschaft.«
Er geleitete Fahrid bis vor die Höhle, eine Ehre, die er nur wenigen Freunden zuteil werden ließ. Sein Blick wanderte vom jungen Hoffnungsträger zum Felsvorsprung gegenüber. Zwei Knaben, keiner älter als zehn, traten mit hängenden Köpfen auf die Behausung des greisen Mohammed Mokdad zu, den alle ehrfürchtig Abu Jihad nannten, Vater des Heiligen Krieges. Der Geistliche verkörperte den heiligen Eifer der Gerechten im Kampf gegen die Ungläubigen wie kein Zweiter. Für ihre Sache war er ebenso unverzichtbar wie sein Techniker. Daher genoss er seit jeher eine Art diplomatische Immunität. Islam Bencherif hasste ihn dafür, denn der Alte schreckte vor keiner Schandtat zurück, um seine grenzenlose Lust zu befriedigen. Die Koranschule für die Kleinen im Camp war nur die harmlose Fassade für das, was sich in Abu Jihads Höhle tagtäglich abspielte. Jeder wusste es. Im Camp gab es keinen Knaben, der nicht schon den Samen des Schänders geschmeckt, dem der Alte nicht schon das Glied in den Hintern gerammt hatte. Jeder musste wegsehen, auch er selbst, denn Abu Jihad verkörperte den Heiligen Krieg. Er war die Flamme Allahs auf Erden, das charismatische Symbol für nichts weniger als den Sinn ihrer Existenz. Abu Jihad war unantastbar. Von ihm geschändet zu werden, musste man als Ehre betrachten.
Islam Bencherif spuckte angewidert auf den Boden. Ungeduldig wartete er, bis die beiden Jungen die Höhle wieder verließen, dann machte er sich auf den Weg, um mit Abu Jihad die Predigt vorzubereiten.
Die Mittagssonne brannte wie Feuer und verwandelte die Schlucht in einen glühenden Ofen, als Abu Jihad zu seiner Predigt vor dem Freitagsgebet ansetzte. Bei Weitem nicht alle Männer des Camps fanden in der großen Grotte Schutz, die als Moschee diente. Vielen jungen Kämpfern und den Knaben blieb nichts anderes übrig, als in der prallen Sonne zuzuhören. Das Freitagsgebet war die einzige Versammlung unter freiem Himmel, die Islam Bencherif erlaubte. Die Gefahr, entdeckt zu werden, war stets gegenwärtig. Er durfte sie nicht unterschätzen. Er warf einen letzten argwöhnischen Blick in den wolkenlosen Himmel, bevor er die Grotte betrat. Sein Techniker setzte die Videokamera in Betrieb und gab dem alten Mann ein Zeichen. Es war ein eindrucksvolles Bild, das bald um die Welt gehen würde. Abu Jihad stand vor der riesigen Weltkugel, auf der die Kalaschnikow mit der schwarzen Flagge der AQIM als Symbol des Heiligen Krieges thronte. Er hob den Blick zur Felsenkuppel, streckte dabei den weißen Vollbart wie eine schützende Hand seinen Zuhörern entgegen und begann mit dem Ruf:
»Allahu akbar!«
»Allahu akbar!«, antworteten die Zuhörer wie aus einem Mund.
»Brüder«, fuhr er eindringlich fort, »ihr seid das Schwert Allahs.«
Mit den ersten Worten steckte er alle in die Tasche. Selbst Islam Bencherif ließ sich jedes Mal mitreißen. Der charismatische ›Chatib‹ blickte jetzt direkt in die Kamera. Der nächste Ausruf galt den vielen Zellen der al-Qaida rund ums Mittelmeer und im verhassten Europa. Er wandte sich an die kleinen, verstreuten Gruppen und einsamen Wölfe, die ungeduldig auf ihren Einsatz im Kampf der Gerechten warteten.
»Das Schwert Allahs ist unbesiegbar!«
»Allahu akbar!«, riefen die Männer mit erhobener Faust.
Das Echo der Grotte täuschte auf dem Video eine um ein Vielfaches größere Menschenmenge vor. Abu Jihad hob den Mahnfinger, bevor er weitersprach.
»Aber seid wachsam. Der Feind ist nah. Überall lauern die Heerscharen des Satans. Selbst Araber in diesem Land, die eigentlich unsere Brüder sein müssten, haben die gerechte Sache schändlich verraten. Sie verspotten den heiligen Koran und den Propheten, führen das lasterhafte Leben der Ungläubigen, kleiden sich wie Narren und Huren und lachen über die Gesetze der Scharia, die uns der Prophet selbst geschenkt hat. Sie werden ewig in der Hölle brennen!«
Wieder entlud sich die aufgeheizte Stimmung im Ruf: »Allah ist groß!«. Islam Bencherif teilte die Wut über den Betrug an der Revolution, die der Prediger ausdrückte. Er beurteilte die Zustände in den Ländern Nordafrikas differenzierter und hätte nüchterner gesprochen als Abu Jihad, aber der Alte traf den Kern des Problems. Europäischer Kolonialismus und seine moderne Form unter dem Deckmantel der ›Demokratisierung‹ hatte bisher stets Tod und Verderben gebracht, korrupte Politiker gezüchtet und die Gesellschaft gespalten durch extreme Ungleichheit. Verwahrlosung, Verbrechen und Massenexodus aus purer Verzweiflung bedrohten die Völker Nordafrikas. Die Jugend hatte keine Zukunft. So durfte es nicht weitergehen. Für ihn wie für Abu Jihad gab es deshalb nur ein vordringliches Ziel: die Befreiung der arabischen Muslime vom Ungeziefer aus Europa, Israel und den USA. Für diesen Heiligen Krieg, den Dschihad, hatte er schon in Afghanistan gegen den großen Satan gekämpft, weshalb ihn seine Brüder manchmal ›den Afghanen‹ nannten. Das Ziel war noch weit entfernt. Manche Schlacht musste noch geschlagen werden, aber sie kämpften für die gerechte Sache. Gott war auf ihrer Seite. Allahu akbar!
Die Predigt nahm den gewohnten Lauf. Abu Jihads Charisma zog die Männer auch an diesem Freitag in den Bann. Er verstand es wie kein Zweiter, ihrem harten Leben Sinn zu geben, indem er virtuos mit der latenten Unzufriedenheit spielte und gleichzeitig Balsam auf ihre wunde Seele tropfte. Die Zeit des Gebets nahte. Islam Bencherif fürchtete schon, die Predigt würde ohne den Aufruf enden, den er mit Abu Jihad besprochen hatte. Seine Furcht war unbegründet. Noch einmal wandte sich der Alte direkt an die Zuschauer draußen in aller Welt, die das Video in wenigen Minuten auf ihren Computerbildschirmen sehen würden:
»Frankreich schickt seine Söldner ins Nachbarland Mali, um unsere Brüder zu töten. Frankreich liefert der korrupten Regierung dieses Landes Waffen, um uns zu töten. In Deutschland werden unsere Brüder verfolgt, gedemütigt und eingekerkert. Moscheen brennen in deutschen Städten. Europa ist unser gefährlichster Feind. Brüder, die Zeit ist gekommen, das Schwert zu erheben! Europas Städte werden brennen. Denkt an die neunte Sure des heiligen Koran: Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Die Ungläubigen werden zur Hölle fahren. Die große Schlacht hat begonnen. Allahu akbar!«
»Allahu akbar!«, schrien die Männer außer sich.
Marseille
Der Mann mit dem schwarzen Vollbart und der gehäkelten weißen Mütze blickte sich unauffällig um, bevor er den verwilderten Garten des Hauses am Boulevard de la Méditerranée unweit der Mairie betrat. Er fiel nicht auf in dieser Gegend mitten in den Marseiller Quartiers Nord, dem Ghetto nördlich der Frontlinie Canebière, welche den armen Norden vom reichen Süden trennt. Ihm folgten im Abstand weniger Minuten vier weitere Männer, die ihm auf den ersten Blick glichen wie ein Ei dem andern. Ihr Ziel war der Schuppen im Gebüsch hinter dem Haus, der Ort für ›Gipfeltreffen‹, Versammlungen unter höchster Geheimhaltung. Mohammed Hamidi, der als Erster eingetroffen war, hatte seine engsten Vertrauten zu dieser Sitzung befohlen, der wichtigsten seit Langem.
»Ihr habt das Video gesehen«, begann er.
Es war eine Feststellung, keine Frage. Die Männer murmelten zustimmend. Er nickte befriedigt und sprach weiter:
»Endlich ist es soweit. Der Plan wird ausgeführt wie vorgesehen.«
»Wann?«, fragte einer, während er die Landkarte des Küstenstreifens auf dem Tisch ausbreitete.
»Ich erwarte den Anruf jede Minute. Also gehen wir den Ablauf der Operation nochmals durch. Jeder Handgriff muss sitzen. Wir werden unsere Brüder nicht enttäuschen.«
Die Aufgaben waren längst verteilt. Mechanisch wiederholte jeder, was er zu tun hatte, beschrieb seinen Einsatz auf der Karte, zählte die Probleme auf, mit denen er rechnen musste und wie er in jedem Fall reagieren würde. Mohammed Hamidi war stolz auf seinen generalstabsmäßigen Plan und stellte beruhigt fest, wie perfekt ihn seine Leute verinnerlicht hatten.
»Gibt es Veränderungen am Objekt in letzter Minute?«, fragte er die beiden Beobachter, die das Ziel erkundet hatten.
»Nicht am Objekt selbst …«, antwortete Basem Mansour zögernd.
Er war der Jüngste unter ihnen, war aber dank dem langen Bart nicht von seinen älteren Brüdern zu unterscheiden.
»Was willst du damit sagen, Basem?«
»L‘initié, der Insider … Ich glaube, er könnte Schwierigkeiten machen.«
»Ich knall ihn ab, den Hund!«, schimpfte der Buchhalter, der sonst für die Finanzen des Drogengeschäfts zuständig war und sich jetzt um die Schmiergeldzahlungen der Operation kümmerte. »Keinen Centime mehr kriegt der Hurensohn.«
Mohammed Hamidi legte die Stirn in Falten und fragte lauernd:
»Will er uns erpressen?«
»Das wagt er nicht, aber er hat angedeutet, dass er Stoff braucht. Ich nehme an, das sagt er, weil er etwas von uns erwartet.«
Wieder wollte der Buchhalter aufbrausen, doch Mohammed Hamidi gebot ihm mit einer Handbewegung, zu schweigen.
»Gut beobachtet, Basem«, lobte er. »Ich würde dem Insider sofort die Kehle durchschneiden, das wisst ihr, aber wir brauchen ihn noch. Wir dürfen jetzt kein unnötiges Risiko eingehen.«
Wenige Tage noch mussten sie den Mann bei der Stange halten, der ihnen den Zugang zur Anlage ermöglichte.
Der Buchhalter räusperte sich.
»Wir haben noch etwas vom Dreck der Albaner übrig, den niemand kauft.«
Das verschmutzte Crack war der reine Killer. Wer es in der üblichen Dosierung konsumierte, spielte mit seinem Leben. Genau das Richtige für den Verräter – nur nicht jetzt, dachte Mohammed Hamidi. Mit der Aussicht auf dieses Teufelszeug hatten sie den Insider-Junkie in der Hand. Seine Stirn glättete sich, als er Basem den Auftrag gab.
»Gib ihm erst nur eine kleine Dosis, damit er weiß, was ihn erwartet – nach der Operation«, schärfte er ihm ein.
Der Ruf des Muezzin schreckte sie auf. Erregt griff er zum Satellitentelefon, von dem das Geräusch stammte. Außer den Versammelten kannte nur ein Mensch dieses Telefon und seine Rufnummer. Er erhob sich und meldete sich mit einem ehrerbietigen:
»Allahu akbar.«
Das Gespräch blieb kurz und einseitig. Er hörte schweigend zu, dann verabschiedete er sich mit einem einzigen Wort: »Verstanden« und legte auf. Die Versammelten hingen an seinen Lippen, während er bekanntgab, worauf alle warteten:
»Der 13. Juni.«
Côte d‘Azur
Chris spürte, wie Jamie sie aus den Augenwinkeln beobachtete. Sie war keine gute Gesellschafterin. Auf dem Flug von Frankfurt nach Nizza hatte sie kaum ein Wort gesprochen. Nun saß sie teilnahmslos auf dem Beifahrersitz des Mietwagens und ließ eine der schönsten Landschaften Europas vorüberziehen, ohne sie zu beachten.
»Es war die richtige Entscheidung«, sagte Jamie unvermittelt.
Da sie nicht antwortete, fügte er hinzu:
»Dein Partner braucht jetzt einfach Ruhe und Zeit, um zu genesen. Daran kannst du auch in Wiesbaden nichts ändern.«
»Trotzdem mache ich mir dauernd Vorwürfe«, murmelte sie. »Ich kriege das Bild von Sven nicht aus dem Kopf, wie er nur durch Maschinen am Leben erhalten wird.«
Jamie schüttelte den Kopf. »Da irrst du dich. Sein Körper hält ihn am Leben. Die Maschinen dienen nur der Unterstützung der Atmung und des Heilungsprozesses. Er wird wieder gesund. Für einmal darfst du den Ärzten ruhig vertrauen, wenn sie so etwas behaupten.«
»Was soll das jetzt wieder heißen?«, brauste sie auf.
»Nichts, was meinst du?«
Mit unschuldiger Miene konzentrierte er sich auf den gelben Lamborghini vor ihnen, der zu einem Überholmanöver ansetzte. Er schloss in die Lücke auf, die der Zuhälter-Bolide hinterließ, bevor er ihr aufmunternd zulächelte.
»Ist doch toll diese Gegend, findest du nicht?«
»Die Autobahn!«
»Ich meine all die schönen Dinge neben der Autobahn: die Pinienwälder auf den Hügeln, das Grün der Büsche auf dem roten Fels …«
»Porphyr.«
»Wie bitte?«
»Der rote Fels heißt Porphyr. Es ist ein Gefüge aus verschiedenen vulkanischen Gesteinen mit einem hohen Anteil an Feldspaten. Das Massif de l‘Estérel ist bekannt dafür.«
Er brach in lautes Gelächter aus.
»Danke für die Gratisvorlesung, Frau Professor. Immerhin hast du mitbekommen, wo wir uns gerade befinden.«
»Steht auf dem Navi.«
Sie fühlte sich doppelt schuldig, in die paar Tage Zwangsurlaub an der Côte d‘Azur eingewilligt zu haben. Sie war ein Feigling, der vor dem rauen Alltag des Jobs flüchtete, und die miserable Laune würde ihrem Geliebten die Freude am ersten Besuch Südfrankreichs gründlich verderben.
Am Ortsausgang von Sainte-Maxime kippte die Stimmung. Die Bucht von Saint-Tropez öffnete sich vor ihren Augen, als wollte sie die Fremden in die Arme schließen. Das Meer schimmerte in allen Blautönen, reflektierte die warmen Strahlen der hochstehenden Sonne direkt in ihr Herz. Sie streichelte Jamies Hand am Steuer mit dem Ende ihres Haarzopfs, das ein rotes Seidenband zu einem neckischen Pinsel bündelte, und flüsterte:
»Entschuldige. Du hast recht. Es ist wunderschön hier. Aber das Beste ist, dass du bei mir bist.«
»Das denke ich auch, ich meine umgekehrt – also, dass du …«
»Schon verstanden«, lachte sie.
Sie liebte es, wenn er stotterte. Das Gesicht, das er dabei machte, löste regelmäßig Hormonschübe bei ihr aus.
»Ist es noch weit?«, fragte sie unschuldig.
»Fünf Minuten, schätze ich.«
Port Grimaud, das künstliche Städtchen am inneren Ende der Bucht, grüßte sie mit einem unübersehbaren Verbotsschild: Zufahrt nur für Berechtigte. Es markierte gleichzeitig das Ende der Weisheit des Navigationsgeräts. »Sie haben Ihr Ziel erreicht«, verkündete die nette Dame.
»Jetzt wird‘s schwierig«, murmelte Jamie, als er auf dem Parkplatz anhielt.
Sie stiegen aus, um den Weg zur Rue du Ponant zu suchen. Die Siedlung bestand aus einem verwirrenden Netz miteinander verbundener Landzungen und Inseln. Ihr schien, die Anlage diente einzig dem Zweck, möglichst viele Anlegeplätze für teure Jachten zu schaffen. Das war den Architekten hervorragend gelungen. Die romantische Seite von Port Grimaud offenbarte sich ihnen, als sie später im Schritttempo über die Brücke am Ende der Rue du Ponant fuhren.
»Wir sind in Venedig!«, rief sie überrascht aus.
Die steinerne Brücke überquerte einen verträumten Kanal, gesäumt von Häuserzeilen in warmen Erdfarben. Schattige Arkaden, Säulengänge und Straßencafés verbreiteten den Zauber italienischer Gelassenheit. Raumhohe Rundbogenfenster und Balkone mit Geländern aus filigranem Eisengitter zierten Prachtbauten, die sich nicht vor den Palazzi am Canal Grande zu verstecken brauchten.
»Venise provençale nennen es die Franzosen«, dozierte Jamie.
»Klingt einleuchtend.«
Port Grimaud hatte auf den letzten paar Metern deutlich an Sympathie gewonnen. Das Haus von Richters Golfbekanntschaft Stresemann lag an der Südspitze einer kleinen Insel. Jamie parkte den Mietwagen neben einer metallisch silbernen E-Klasse Limousine im Schatten der Pinie auf dem Vorplatz. Kaum hatte sie die Tür aufgestoßen, trat ein sportlich gekleideter Herr mit grauem Kurzhaarschnitt und überlangen Beinen freudestrahlend auf sie zu und begrüßte sie auf Deutsch mit unverkennbar sächsischem Akzent:
»Sie müssen Dr. Hegel und Ihr Verlobter sein. Willkommen in Port Grimaud.«
Er stellte sich als Jochen Preuss vor, Wahlfranzose und Heimweh-Ossi.
»Ich wohne mit meiner Frau Manon im Nachbarhaus. Wir haben ein Auge aufs Haus der Stresemanns, wenn sie nicht da sind, was eigentlich immer der Fall ist.«
Er hielt ihr einen Schlüsselbund hin.
»Ihr Akzent kommt mir bekannt vor«, lächelte er. »Berlin?«
Bevor sie antworten konnte, schlug er sich an die Stirn und wandte sich auf Englisch an Jamie:
»Entschuldigen Sie, Dr. Roberts, wie ungeschickt von mir. Sie sind Engländer, nicht wahr?«
Jamies Gesicht war ein einziges Fragezeichen, als er nickte und antwortete:
»Wie Sie richtig vermuten, Mr. Preuss, bereitet mir Ihr ausgezeichnetes Englisch entschieden weniger Mühe als Ihr Deutsch.«
»Also bleiben wir beim Englisch.« Zu ihr gewandt, fügte er lachend hinzu: »Sie sollten Dr. Roberts unbedingt Ihre schöne ostdeutsche Sprache beibringen. Schließlich ist er Angelsachse.«
»Das versucht meine Mutter schon seit langer Zeit, ohne nennenswerten Erfolg.«
An der Haustür verabschiedete er sich mit der Bemerkung, die in ihren Ohren fast wie eine Drohung klang:
»Sie sind selbstverständlich zum Kaffee eingeladen. Lernen wir uns besser kennen. Kommen Sie einfach rüber, wenn Sie soweit sind.«
Etwas verloren sahen sie sich um im Haus der unbekannten Stresemanns.
»Woher kennt der meinen Namen?«, fragte Jamie mit einem Blick, als suchte er nach verborgenen Wanzen.
»Richter. Unser guter Oberstaatsanwalt Richter muss es seinem Bekannten beim BND erzählt haben. Ich frage mich, was er sonst noch alles ausgeplaudert hat. Preuss hält mich wohl für ein psychisches Wrack auf Reha. Wusstest du übrigens, dass wir verlobt sind?«
»Ich habe schon so etwas vermutet«, sagte er mit schiefem Grinsen, dann blickte er sie plötzlich betroffen an und fragte: »Meinst du, die beobachten uns?«
»Wer – der Nachrichtendienst? Quatsch, du bist doch nicht James Bond.«
»Aber du. Na wenn schon, die werden bald etwas erleben.«
Er nahm sie entschlossen bei der Hand und zog sie sanft zum Sofa unter dem falschen Picasso.
»Das Gepäck ist noch im Wagen«, protestierte sie, »und ich muss unter die Dusche, bin ganz verschwitzt …«
Seine Lippen verschlossen ihr den Mund. Ihre Zunge machte sich selbständig, spielte mit der seinen. Seine Finger zogen Kreise um ihre Brüste. Die Warzen stellten sich auf unter dem dünnen Leibchen, hart wie sein Penis in Erwartung der zupackenden Hand. Glückshormone sandten Stoßwellen wohliger Wärme durch ihren Körper. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und sog sich heftig atmend an seiner Zunge fest, um ihn mit Haut und Haaren zu verschlingen. Seine Hand massierte ihren Busen. Zwei Finger spielten mit dem Nippel. Sie stöhnte auf. Die Zunge entwischte ihr, suchte ihren Weg über das Handgelenk und den Innenarm zum Ansatz der andern Brust. Seine Nasenspitze streichelte die Achselhöhle, dass ihr Verstand augenblicklich verdampfte. Statt sich zu fragen, woher solches Geheimwissen kam, konzentrierten sich alle Synapsen darauf, den Orgasmus hinauszuzögern, bis sie sein Glied zwischen den Schenkeln spürte. Kaum berührte die Eichel ihr Feuchtgebiet, entlud sich das Gewitter im Gehirn, angefacht vom Schweißgeruch und der archaischen Lust, nichts anderes als sein geiles Luder zu sein. Erschöpft von der Intensität des Orgasmus verwandelte sie sich in seinen Händen zum willenlosen Spielzeug beider Begierden.
Nach der neuen Erfahrung stand sie mit weichen Knien in der Dusche. Sie zögerte, bevor sie in den Wasserstrahl trat, roch lüstern an ihren Achselhöhlen, fauchte sie an wie eine hungrige Raubkatze. Erst danach gestattete sie dem Wasser, die Spuren der Ekstase in den Ablauf zu schwemmen. Ihre Reisetasche stand auf dem Bett, als sie das Bad verließ. Die blonde Mähne bedeckte den Rücken bis fast zum Po, sonst trug sie nichts. Das blaue, trägerlose Strandkleid mit den Malven sollte passen. Sie hatte es noch nicht aus der Tasche gezogen, da stürmte Jamie aufgeregt ins Zimmer. Immerhin trug er seinen Slip.
»Du glaubst nicht, was ich entdeckt habe!«, rief er außer Atem, als hätte ihm die Treppe ins Schlafgemach das Letzte abgefordert.
Ihr nackter Körper schien ihn nicht zu irritieren. Strahlend schaute er ihr in die Augen und wartete auf ihre Frage.
»Eine versteckte Kamera?«, spekulierte sie.
»Besser. Komm mit, ich zeige es dir.«
Er ließ ihr keine Zeit, sich anzuziehen, zog sie mit sich ins Erdgeschoss hinunter, in eine Kammer, fast so groß wie das Wohnzimmer. Dort blieb er andächtig stehen.
»Und – was sagst du?«
»Ich hätte es mir denken können. Die Küche … Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass der Kühlschrank leer ist – falls du zu kochen gedenkst?«
Er schüttelte ungeduldig den Kopf. »Darum geht es nicht, sieh dich doch um! Fällt dir nichts auf?«
»Sieht alles ziemlich unbenutzt aus.«
»Das auch, aber die Ausstattung. Wer diese Küche eingerichtet hat, muss ein wahrer Meister sein. Mein Gott, das ist ein professioneller Dampf-Kombi-Backofen! Ein Wasserbad mit Thermostat für ›sous-vide‹ Kochen, ein Vakuumiergerät …«
»Fehlt nur noch der flüssige Stickstoff«, bemerkte sie trocken. »Eine tolle Küche hast du da, echt. Darf ich mich jetzt anziehen?«
Jamies Entdeckung diente auch als Einstieg in die Unterhaltung auf dem Sitzplatz der Preussens im Schatten der Pergola am Wasser. Chris fürchtete, ihr ›Verlobter‹ würde die zierliche, fast zerbrechliche Manon Preuss in ein abendfüllendes Fachgespräch über moderne Kochkunst verwickeln. Sie beruhigte sich auf der Stelle, als Mrs. Preuss misstrauisch fragte:
»Sind die Geräte auch angeschlossen?«
Jochen Preuss lachte ob dem verblüfften Gesicht des Gastes.
»Sie müssen wissen: Wir reiten eher auf der Mikrowelle«, erklärte er.
»Das wäre allerdings eine ganz neue Erfahrung für unsern Dr. Roberts«, lachte Chris.
Sie versuchte, das Gespräch unauffällig in die Richtung zu lenken, wo sie mehr über die Preussens und Staatsanwalt Richters Bekannten im BND erfuhr, ohne allzu viel über sich selbst preiszugeben. Sie war gut in dieser Übung und verfügte über reiche Erfahrung, aber bei Preuss biss sie auf Granit. Der Mann war auf der Hut, wehrte alle Versuche, in seine Geheimnisse einzudringen, elegant ab. Sie erfuhr lediglich, dass die beiden sich schon vor einer Ewigkeit in Port Grimaud niedergelassen hatten, zu einer Zeit, als man die Häuser hier noch nicht mit Gold aufwiegen musste.
»Heutige Preise können sich nur noch reiche Russen und Araber leisten«, meinte Manon Preuss dazu.
Jamie deutete auf die Luxusjachten an den Kais und sagte mit ironischem Lächeln:
»Hier gibt es wohl keine Rezession.«
Jochen Preuss nickte. »So ist es«, wir leben auf einem andern Planeten.«
»Außer montags und samstags«, schränkte seine Frau ein.
»Ja, am Samstag geht‘s normalerweise auf den Markt, da gibt’s gewöhnliche Menschen, und Montag ist unser freier Tag.«
»Sie sind doch in Rente«, warf Chris überrascht ein. »Ist da nicht jeder Tag ein freier Tag?«
Die beiden Gastgeber schmunzelten.
»Im Prinzip schon«, gab Jochen Preuss zu. »Unter frei verstehen wir allerdings etwas anderes.«
Manon brachte es auf den Punkt: »Frei vom Partner. Jeder tut, was er will, ohne dem andern Rechenschaft darüber abzulegen. Ich verbringe den Tag auf meine Art, und ich will nicht wissen, was Jochen am Montag in Marseille tut. So läuft es seit vierzig Jahren bei uns ohne Probleme.«
Interessanter Ansatz, dachte Chris. Im Grunde genommen verhielt es sich bei ihr und Jamie ähnlich, nur nicht beschränkt auf den Montag.
»Du weißt genau, womit ich mich in Marseille beschäftige«, korrigierte Jochen Preuss seine Gattin.
»Na ja – ich will aber nichts davon wissen.«
Ihr Mann wandte sich lächelnd an die Gäste. »Manon hat bloß Angst, dass mir eines Tages etwas zustößt in der Stadt des Verbrechens. Unnötige Angst, wie ich betonen möchte. Ich betreue dort ein wichtiges Projekt mit Jugendlichen aus der Unterschicht, das ist alles. Wissen Sie was? Ich nehme Sie beide einfach mit am Montag …«
»Bloß nicht!«, unterbrach Manon entsetzt.
Chris reagierte sofort.
»Das würde mich brennend interessieren«, versicherte sie, ohne sich um Jamies betroffenes Gesicht zu kümmern.
Es wäre die Gelegenheit, mehr über den redseligen und doch so verschlossenen Jochen Preuss zu erfahren.
Bethioua, Algerien
Mitternacht war vorbei. In den Häusern der kleinen Gemeinde Bethioua an der algerischen Küste brannten keine Lichter. Nur die riesige Industrieanlage im Westen war taghell erleuchtet, als die zwei vermummten Männer das Paket, schwer wie ein Koffer voller Steine, vorsichtig über die Rampe ins Schlauchboot rollten. Sie mussten möglichst jede Erschütterung vermeiden. So hatte man sie instruiert und daran hielten sie sich, ohne zu wissen, was sie transportierten. Sie sahen sich wortlos um, bevor sie die Leine lösten. Niemand hatte sie bemerkt. Der Jüngere der beiden startete den Motor. Er ließ die Maschine nur auf niedriger Stufe laufen, um möglichst wenig Lärm zu verursachen. Sie waren nicht in Eile. Die wenigen Kilometer schafften sie auch im Schneckentempo bis zum vereinbarten Zeitpunkt.
Ein Windstoß schleuderte das ›RIB‹ so heftig gegen die Holzpfähle des alten Docks, dass der Behälter hart an die Hülle des Boots prallte. Der Mann am Steuer ließ vor Schreck das Ruder fahren.
»Merde, der verfluchte Scirocco!«, rief er dem Pelikan hinterher, dessen Nachtruhe sie gestört hatten.
Der Wind sorgte für ungewöhnlich hohe Wellen. Unter normalen Umständen wären sie niemals bei diesem Wetter ausgelaufen, aber das Paket musste heute Nacht aufs Schiff, und die Bezahlung war besser als sonst.
»Halt das verdammte Ding fest!«, schrie er seinen Partner an, der tatenlos zusah, wie das Paket gefährlich hin und her rutschte.
In weitem Bogen kämpften sie sich durch die raue See dem Dock 3 des Flüssiggas-Terminals entgegen. Der Steuermann achtete darauf, nicht in den Lichtkegel der Scheinwerfer zu geraten. Die letzten Meter entschieden über Erfolg oder Misserfolg des Transports. Im schlimmsten Fall würden sie die Ladung ins Meer kippen, falls die Küstenwache unerwartet auftauchte. Das war bisher nur einmal mit einer Lieferung Koks geschehen. Ein Jahr lang mussten sie danach umsonst arbeiten, aber immerhin lebten sie noch.
Die Betankung der blauen ›Baleine‹ mit den leuchtend weißen Buchstaben ›LNG‹ am Rumpf war noch im Gang. Der Umstand erleichterte ihr Vorhaben, da die Aufmerksamkeit der Crew dem Terminal, der Pipeline und den Schläuchen und Ventilen für das Flüssiggas galt. Nur der Empfänger der Ware würde sich für sie interessieren.
Wie erwartet, öffnete sich backbords eine Luke, kurz bevor sie anlegten. Der Ladebaum schwenkte aus. Sie befestigten das Paket am Geschirr des Flaschenzugs, sahen zu, wie die Fracht im Bauch der ›Baleine‹ verschwand. Ohne ein Wort zu wechseln, legten sie wieder ab, erleichtert, das unheimliche Zeug los zu sein.