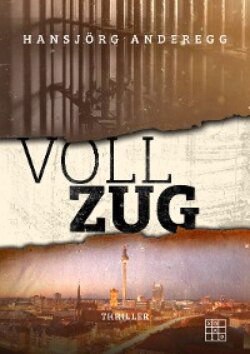Читать книгу Vollzug - Hansjörg Anderegg - Страница 6
ОглавлениеKapitel 2
Wiesbaden
Oberstaatsanwalt Richter fing sie vor dem Sitzungszimmer ab und stellte ihr die Frage, mit der sie die Kollegen im BKA neuerdings grüßten:
»Alles in Ordnung?«
Der Zusatz »Dr. Hegel« in lauerndem Ton fehlte. Ein sicheres Zeichen, dass der Staatsanwalt keinen heimtückischen Angriff auf sie plante. Sie nickte ihm mit gezwungenem Lächeln zu und trat ein. Richter eröffnete die Lagebesprechung, diesmal unterstützt vom leitenden Ermittler des LKA Hamburg, Hauptkommissar Justus Hansen, einem schmächtigen Mittfünfziger mit kahlem Schädel. Der nickte ihr freundlich zu, bevor er ausholte, um die Erkenntnisse im Fall Hassan Moussouni zusammenzufassen. Die ›Lage‹ verlief professionell emotionslos, als ginge alles seinen gewohnten Gang. Sie erwartete nichts anderes, konnte aber nicht verhindern, dass ihre Gedanken wiederholt abschweiften. Im Geiste stand sie am Bett ihres Partners, der in diesen Minuten in einem Zustand zwischen Leben und Tod schwebte, während Hansen über Haare und Hautschuppen referierte. Seine letzte Bemerkung ließ sie aufhorchen.
»In der ganzen Wohnung gibt es nur DNA einer einzigen Person.«
»Das ist unmöglich«, protestierte sie. »Moussouni wird kaum abwechselnd in einem der beiden Schlafsäcke gelegen haben.«
Hansen nickte schmunzelnd. »Das hat uns auch stutzig gemacht, zumal Fingerabdrücke zweier verschiedener Personen sichergestellt worden sind.«
»Ganz was Neues. Ein Mensch hinterlässt Fingerabdrücke aber keine DNA«, brummte ein Kollege aus der KT.
»Das wäre in der Tat verblüffend«, gab Hansen zu. »So ist es aber nicht. Die zweite Person hat ebenfalls DNA hinterlassen, identische DNA.«
»Eineiige Zwillinge«, rief Chris überrascht. »Hassan Moussouni hat einen Zwillingsbruder. Warum wissen wir nichts davon?«
Sie richtete die Frage an den Oberstaatsanwalt. Die Peinlichkeit prallte an ihm ab wie die Billardkugel an der Bande und rollte direkt vor Hansens Füße. Der Hauptkommissar antwortete schnell und schneidig, als hätte er genau auf diese Frage gewartet:
»Der BND wusste Bescheid.«
Ein Raunen ging durch die Versammelten. Einzelne gedämpfte Flüche waren zu vernehmen.
»Ich bitte Sie, meine Herrschaften!«, fuhr Richter dazwischen. Dann fragte er Hansen lauernd: »Der BND hat Sie informiert?«
»Erst auf unsere hartnäckige Nachfrage hin. Hassan Moussounis Zwillingsbruder heißt Ahmed. Der BND weiß von seiner Existenz. Es gibt jedoch keine Akte über ihn. Ahmed Moussouni sei ein weißes Blatt, behauptet der Nachrichtendienst.«
Richter murmelte etwas, das gar nicht nett klang.
»Das dicke Ende kommt erst noch«, fuhr Hansen weiter. »Die Fingerabdrücke des Verletzten sind nicht diejenigen des Terrorverdächtigen Hassan Moussouni. Auf der Hamburger Intensivstation liegt sein Bruder Ahmed.«
Dieser Gedanke hatte Chris schon beim Hinweis auf die Zwillingsbrüder gestreift.
»Schätze, Ahmed Moussouni ist ab sofort kein weißes Blatt mehr«, bemerkte sie trocken.
Richter nickte nachdenklich. »Was die Gewaltbereitschaft betrifft, scheint er seinem Bruder in nichts nachzustehen.«
Eine Pause entstand, während sein Blick über die versammelten Ermittler schweifte, als müsste er sie zählen. Schließlich fügte er eindringlich hinzu:
»Das bedeutet, meine Herrschaften: Die Suche nach Hassan Moussouni hat eben erst begonnen.«
Und wir haben wertvolle Zeit verloren, ergänzte Chris im Stillen. Laut fragte sie den LKA-Kommissar Hansen:
»Was hat die Untersuchung der Satellitenanlage ergeben?«
Zu ihrer Überraschung antwortete ihre Freundin Caro von der Kriminaltechnik des BKA:
»Hamburg hat uns das Gerät übergeben. Die Netzspezialisten sind noch an der Arbeit. Bis jetzt steht fest, dass die Benutzer sich praktisch ausschließlich für die Pläne des Hamburger Hafens und dort ansässige Reedereien und Werften interessiert haben. Hinweise auf konkrete Kontakte gibt es bisher allerdings nicht.«
»Na, das ist doch schon etwas«, freute sich Richter.
Er sandte einen fragenden Blick Richtung Hansen.
»Wir übernehmen das«, antwortete der Kommissar aus Hamburg, und alle verstanden, was er meinte.
Solang die digitale Spur nicht mehr hergab, hieß es Klinken putzen: mühsame und aufwendige Befragung aller denkbaren Kontakte rund um den riesigen Hamburger Hafen. Sie hielt es nicht für wahrscheinlich, dass sich der Gesuchte noch in der Hansestadt aufhielt, aber die Arbeit musste getan werden. Die Spur, die sie zur Wohnung im Plattenbau geführt hatte, endete dort. Hassan Moussouni konnte Gott weiß wo seine dunklen Geschäfte weiterverfolgen. Und Sven lag im Sterben.
Bei der Rückkehr ins Büro tippte Caro ihr an die Schulter. Die Freundin blickte sie besorgt an. Sie öffnete den Mund, doch Chris kam ihr zuvor:
»Nicht du auch noch!«, stöhnte sie in Erwartung der Standardfrage.
»Du siehst Scheiße aus, wollte ich eigentlich sagen.«
»Nett von dir. Vielen Dank, das hilft.«
Am Eingang zum Büro zögerte Chris. Nur widerwillig betrat sie den Raum mit Svens leerem Pult. Das Büro kam ihr steril vor. Es roch nach Desinfektionsmittel und Plastikschläuchen. Caro bemerkte ihr Zögern.
»Du solltest nicht hier sein. Geh nach Hause, nimm ein heißes Bad und hau dich aufs Ohr.«
Kloppenheim bei Wiesbaden
Caros Rat war gut gemeint. Schlaf wäre sicher nicht verkehrt in ihrer depressiven Stimmung. Sie hatte es versucht. Stundenlang lag sie mit offenen Augen im Bett in der Dachwohnung des ehemaligen Heuschobers am Kloppenheimer Feld. Milde Nachtluft wehte den Duft frisch geschnittenen Grases durchs offene Fenster herein. In der Ferne rief hin und wieder ein Kauz. Ein Fuchs markierte sein Revier mit kurzem Gebell. Die Voraussetzungen für gesunden Schlaf waren ideal auf dem luxuriösen Dachboden in Caros Haus. Aber ihre kranke Seele fand keinen gesunden Schlaf. Sie versuchte es mit Musik, die ihr stets in traurigen Momenten geholfen hatte. Sie nahm ihr Saxophon aus der Hülle, setzte das Mundstück auf und legte das Instrument lustlos wieder weg, ohne einen Ton zu spielen. Um Mitternacht rief sie das Krankenhaus in Hamburg an und ließ sich mit der Intensivstation verbinden.
»Sie wünschen?«, murmelte die Stimme eines Arztes, die sich so müde anhörte wie die ihre.
»Wie geht es dem Patienten Sven Hoffmann? Hat sich sein Zustand verändert?«
»Sind Sie verwandt mit dem Patienten?«
»Nein, ich …«
»Tut mir leid, dann darf ich Ihnen keine Auskunft geben.«
»Hören Sie, Doktor – ich mag mich nicht mit Ihnen streiten. Ich bin Oberkommissarin Hegel vom BKA. Ich war dabei, als er angeschossen wurde, und muss wissen, wie es meinem Partner geht. Haben Sie ein Problem damit?«
»Ich habe kein Problem, aber es gibt Vorschriften.«
Nach einer kurzen Pause gab er nach:
»Der Zustand des Patienten Hoffmann ist unverändert kritisch. Er hat Glück gehabt, dass der Schuss das Gehirn nur gestreift hat.«
»Das nennen Sie Glück?«, rief sie erregt aus. »Was ist, wenn sein Hirn nicht mehr funktioniert, falls er je wieder aufwacht, als Gemüse?«
»Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Gute Nacht.«
Dieser Anruf verschlimmerte ihren Geisteszustand noch weiter. Sie spielte mit dem Gedanken, ihren Freund Jamie anzurufen, der nichts von den Ereignissen der letzten zwei Tage ahnte. Der Arzt Dr. Jamie Roberts war seit Jahren ihr Geliebter, eine Art Ehemann auf Distanz. Er lebte und arbeitete als Mediziner am Imperial College in London. Normalerweise schätzte sie die Vorteile der Fernbeziehung, aber in dieser Nacht … Ein Finger schwebte kurz über Jamies Namen auf dem Touchscreen des Smartphones, bevor sie es ausschaltete. Lustlos goss sie sich ein Glas Rotwein ein, vom gehaltvollen, schweren Burgunder, Nuits-Saint-Georges, nicht den wässrigen badischen Landwein, den man trinkt, um den Durst zu löschen. Der fruchtige Körper des Weins widerte sie an, aber sie leerte das Glas in wenigen Zügen und goss sich ein Zweites ein. Die Flasche fast leer, der Kopf ein Karussell, fiel sie erschöpft ins zerwühlte Bett zurück.
Auch solche Medizin half nicht in dieser Nacht. Der Alkohol verstärkte ihre schlimmsten Albträume. In einem lichten Augenblick fiel ihr auf, dass sich die Bettwäsche kaum mehr von den stinkenden Schlafsäcken im Plattenbau unterschied. Die Erkenntnis blieb allerdings ohne Konsequenzen. Sie verfiel in einen Dämmerzustand, schloss endlich die Augen.
Ein anhaltender Pfeifton wie der Alarm auf der Intensivstation nach dem Aussetzen des Herzschlags schreckte sie auf. Vergeblich versuchte sie, die Augen auf das Fenster zu fokussieren, wo das Geräusch herkam. Immerhin glaubte sie, einen winzigen Vogel wegfliegen zu sehen.
»Angeber«, lallte sie ihm nach.
Ihre Hüfte begann wieder zu schmerzen. Sie versuchte eine Weile, sich wenigstens darauf zu konzentrieren, bis sie entnervt aufgab.
»Jetzt reicht‘s!«, herrschte sie das Saxophon an, das apathisch im offenen Instrumentenkoffer lag.
Sie schleppte sich hinkend zum Fenster, schlug es zu und ließ den Rollladen herunter. In einer Schublade des Nachttischs fand sie das Röhrchen mit Schlaftabletten, an das sie sich schwach erinnerte. Die Aufschrift konnte sie nicht entziffern. Vielleicht waren es die vergammelten Kopfschmerztabletten. Egal. Sie kippte den Inhalt ins leere Wasserglas neben dem Bett, goss den Rest des Nuits-Saint-Georges dazu und schüttete den Drogencocktail in sich hinein. Auf dem Rücken liegend, nackt, wie sie auf diesem traurigen Planeten angekommen war, wartete sie auf die Wirkung. Für ein paar Augenblicke fühlte sie sich leichter. Dann begann die ganze Flasche Wein in ihren Kopf zu fließen. Die Hirnmasse löste sich im Alkohol auf und der Magen begann zu pochen wie ein zweites Herz. Sie rollte aus dem Bett, kroch auf allen Vieren Richtung Bad, dann knipste jemand das Licht aus.
Richters Anruf erreichte Caro am Computer im Labor der Kriminaltechnik. Seine Stimme klang besorgt, was bei ihm im Verkehr mit seinem Fußvolk eher selten vorkam.
»Ich suche Kommissarin Hegel. Im Büro ist sie nicht erschienen. Am Telefon erreiche ich sie nicht. Wissen Sie vielleicht, wo sie sich verkrochen hat?«
Caro erschrak. »Ich – weiß nicht. Sie ist gestern früh nach Hause gefahren. Es ging ihr nicht gut …«
»Das habe ich gemerkt. Deshalb mache ich mir jetzt Sorgen, verstehen Sie?«
Da gab es nicht viel zu verstehen.
»Sie wohnt doch in Ihrem Haus?«
»Allerdings. Wahrscheinlich ist sie noch dort, hat nur verschlafen. Ich suche sie.«
»Tun Sie das, und verlieren Sie keine Zeit.«
Die Tür der Dachwohnung war nicht verschlossen. Mit flauem Gefühl im Magen trat sie ein, nachdem niemand auf ihr Klopfen geantwortet hatte. Ihre Dogge Nero stieß sie unsanft beiseite und schoss aufs offene Bad zu. Leise winselnd, mit anklagendem Blick, erwartete die Hündin sie neben ihrer leblos am Boden liegenden Freundin. Um Mund und Nase hatte sich Erbrochenes angesammelt. Wenig nur, aber die rote Farbe trieb Caros Puls auf 180.
»Chris, um Gottes willen!«, krächzte sie entsetzt. »Was ist geschehen?«
Chris regte sich nicht. Atmete sie überhaupt noch? Während Caro auf die Antwort der 112 wartete, suchten ihre Finger zitternd die Halsschlagader der Freundin. Chris‘ Herz schlug schwach und unregelmäßig.
Betäubender Rosenduft stieg Chris in die Nase. Sie schlug die Augen auf. Sie lag in einem fremden Bett. Gedämpftes Licht drang durch die halb geschlossenen Jalousien ins fremde Zimmer. Sie wusste nicht, wo sie sich befand und wie sie hierher gekommen war, aber sie erinnerte sich an die gleiche Situation vor nicht allzu langer Zeit. Inklusive Nadel im Arm und Infusionslösung am Haken neben dem Bett. Als sie den Kopf auf die andere Seite drehte, sah sie die Rosen. Schon halb verwelkt steckten sie in einer schmucklosen Vase. Daneben schlummerte Jamie leise schnarchend.
»Willst du dich nicht zu mir legen?«, fragte sie. »Im Bett schläft sich‘s bequemer.«
Zum ersten Mal seit dem Einsatz in Hamburg lächelte sie wieder. Jamie sprang auf beim Klang ihrer Stimme. Er setzte sich auf die Bettkante, beugte sich zu ihr herunter und küsste sie vorsichtig auf die Stirn. Sie schlang die Arme um ihn, um ihm zu zeigen, wie man es richtig machte.
»Lieb von dir, mich zu besuchen«, flüsterte sie nach dem langen Kuss, »aber warum liege ich im Krankenhaus?«
»Das ist eine unappetitliche Geschichte. Willst du sie wirklich hören?«
»Aber sicher.«
»Man hat dir den Magen ausgepumpt. Caro hat angerufen.«
»Das war doch nicht nötig.«
»Doch!«, widersprach er heftig. »Bei der Menge Barbiturate und dem Alkohol …«
»Ich meine, dass Caro dich anruft und du extra herfliegst.«
Er blickte sie mit dem betroffenen Ausdruck an, dem sie seit der ersten Begegnung nicht widerstehen konnte, und meinte kopfschüttelnd:
»Dich kann man aber auch wirklich nicht allein lassen, Liebes.«
Sie richtete sich auf, zog ihn sanft an sich, gerade eng genug, damit er ihre harten Brustwarzen spürte, und säuselte ihm ins Ohr:
»Musst du eben bleiben.«
Wiesbaden
Chris sah es kommen. Sie wusste, was sie erwartete, als Oberstaatsanwalt Richter »Dr. Hegel« zwei Tage nach ihrem Kollaps zu einem Zwiegespräch in sein Büro bestellte.
»Ich bin nicht verrückt«, sagte sie mit wenig überzeugender Stimme nach seiner Ankündigung.
»Das hat doch damit nichts zu tun«, wehrte Richter ab. »Ich biete Ihnen lediglich professionelle Hilfe an. Es ist einfach zu viel auf Sie eingestürzt in den letzten Tagen. Ihr Partner liegt schwer verletzt auf der Intensivstation und jetzt ihr Suizidversuch …«
»Das war kein Suizidversuch!«, fuhr sie auf. »Ich habe nur einen über den Durst getrunken.«
Er lächelte verständnisvoll, wie man Verständnis zeigt für den bedauerlichen Irrtum eines Kindes.
»Ich mache mir große Sorgen um meine beste Ermittlerin«, fuhr er fort. »Lassen Sie sich helfen, Dr. Hegel.«
Sie sah eine Weile durch ihn hindurch, dann entgegnete sie entschlossen:
»Ich gehe nicht zur Psychotante. Eher müssen Sie mich feuern. Sie wissen, was ich von Psychologen halte. Die lesen ein paar Märchenbücher und glauben, das Leben da draußen zu kennen. Hat einer von denen je ins Mündungsfeuer einer ›SIG Sauer‹ geblickt?«
Er setzte zu einer Antwort an, schloss den Mund wieder und betrachtete sie lange nachdenklich. Schließlich stieß er einen leisen Seufzer aus und sagte:
»Ich erinnere mich. Sie haben seinerzeit das psychologische Seminar abgebrochen …«
»Sie selbst haben mich da rausgeholt«, korrigierte sie schnell. »Vielen Dank auch.«
»Was mache ich nur mit Ihnen«, klagte er kopfschüttelnd.
»Lassen Sie mich einfach normal arbeiten … Entschuldigung.«
Ihr Handy summte. Hauptkommissar Hansen vom LKA Hamburg war am Apparat.
»Ich habe soeben erfahren, dass sich die Prognose für Ihren Partner verbessert hat. Dachte, das müssten Sie wissen.«
Ihr Herz hüpfte vor Freude. »Und ob! Vielen Dank. Was sagen die Ärzte?«
»Soviel ich mitbekommen habe, ist jetzt so gut wie erwiesen, dass keine bleibenden Hirnschäden zu erwarten sind.«
»Gut, ausgezeichnet. Hoffentlich täuschen sie sich nicht. Wann wird er – geweckt?«
»Darüber schweigt die Medizin.«
»Und die Moussouni Brüder?«
»Noch keine Spur von Hassan. Ahmed wird überleben, ist aber noch nicht ansprechbar.«
Richter nahm die gute Nachricht gelassen zur Kenntnis. Er saß ihr schweigend gegenüber und strich sich dabei in Gedanken versunken übers Kinn. Ihre Abneigung gegen den psychologischen Dienst schien ihn ordentlich zu erschüttern.
»Vielleicht nehme ich einige Tage Urlaub«, schlug sie als Zeichen guten Willens vor.
Ein Ruck ging durch seinen Körper. Begeistert schlug er mit der flachen Hand auf die Tischplatte, als hätte sie sein schwierigstes Problem gelöst.
»Unbedingt«, betonte er. »Etwas Abstand wirkt wahre Wunder, glauben Sie mir. Ich erlebe das jedes Mal auf dem Golfplatz.«
Wunder geschahen also wesentlich häufiger, als sie angenommen hatte. Ihr schien, der Staatsanwalt blühe geradezu auf beim Gedanken, sie für ein paar Tage loszuwerden.
»Apropos Golf …«, sprudelte es weiter aus seinem Mund, »da fällt mir ein, dass uns der BND noch einiges schuldet.«
Dieser Gedankengang war selbst für ihr analytisch geschultes Hirn nicht nachzuvollziehen.
»Klären Sie mich auf«, sagte sie etwas ratlos.
»Ein alter Golfspezi beim BND besitzt ein schönes Haus in Port Grimaud an der Côte d‘Azur, das dauernd leer steht. Der ideale Ort, um ein paar Tage auszuspannen. Ich rufe ihn gleich an.«
Er griff zum Telefon. Sie überlegte einen Augenblick, ihn daran zu hindern, verzichtete aber darauf. Ihr Quantum Widerspruch war erschöpft für diesen Tag. Beim Verlassen des Büros sprang ihr die reißerische Schlagzeile der Boulevardzeitung ins Auge, die neben der braven ›FAZ‹ im Eingangskorb lag:
ISLAMISTISCHER TERROR IN HAMBURG!
Wie sicher sind wir noch in Deutschland?
Hamburg
Die Berichterstattung über die Schießerei im Plattenbau entzündete ein Pulverfass. Das Trauma von Ahmed Moussounis Geiseln, bei denen er sich versteckt hatte, war ein gefundenes Fressen für die Sensationspresse. Schneewittchen mit ihrer alleinerziehenden deutschen Mutter, die mit Hartz IV und Gelegenheitsjobs kaum über die Runden kamen, in der Gewalt des algerischen Terroristen! Ein Terrorist war er, ein fanatischer islamistischer Terrorist, kein gewöhnlicher Gewaltverbrecher, daran ließen diese Blätter und das Frühstücksfernsehen nicht den geringsten Zweifel.
Im Morgengrauen des 8. Juni brannte die Imam Ali Moschee an der Außenalster, Hauptgebäude des Islamischen Zentrums Hamburg und eine der ältesten Moscheen Deutschlands. Brandbeschleuniger und Brandsätze im Gebetsraum sorgten dafür, dass in kurzer Zeit alles ein Raub der Flammen wurde, was nicht aus Stein oder Beton bestand. Der Gebetsteppich, mit seinen sechzehn Metern Durchmesser einer der größten handgeknüpften Rundteppiche der Welt, war zu Asche zerfallen, als die Feuerwehr eintraf. Nur ein Zufall rettete Ajatollah Rahimi das Leben. Er durfte den sechs Uhr Flug nach München nicht verpassen und verrichtete deshalb sein Fadschr, das Gebet vor Sonnenaufgang, eine halbe Stunde früher als üblich an diesem Morgen.
»Jetzt hamer den Scheiß Kriech!«, kommentierte Hauptkommissar Hansens türkischstämmiger Kollege in akzentfreiem Hamburger Deutsch an jenem Freitagmorgen in der Kantine des LKA. »Krieg« war kaum übertrieben, wie sich am folgenden Sonntagmorgen herausstellte. Der Anruf aus dem Präsidium erlöste Hansen um fünf Uhr früh aus einem unangenehmen Traum. Er hörte stumm zu, während er versuchte, sich den Schlaf aus den Augen zu reiben.
»Bin schon unterwegs«, brummte er schließlich.
Seine Frau ließ er weiterschlafen. Sie befand sich an einem besseren Ort, mit Watte in den Ohren und einem Lächeln im Gesicht. Überdies wollte er sie nicht damit erschrecken, beim Frühstück anwesend zu sein.
»Wie viele?«, fragte er beim Betreten des Büros.
»Schon über fünftausend«, erwiderte sein Türke mit finsterer Miene. »Die Kollegen von der Bereitschaft haben die muslimische Minderheit in unserm Land wohl gründlich unterschätzt. Aber die Reiterstaffel und Wasserwerfer stehen bereit.«
»Die Bereitschaft braucht mehr von deiner Sorte«, murmelte Hansen und verzog das Gesicht.
Der Kaffee schmeckte bitter und sauer. Die Hoffnung, schnell wieder nach Hause zurückzukehren an diesem schönen Sonntag, zerschlug sich schnell. Die in letzter Minute bewilligte ›Demonstration friedliebender Muslime‹, zu der das islamische Zentrum aufgerufen hatte, lockte weit mehr Anhänger in die Hansestadt als befürchtet. Der Zustrom aus dem Bundesland und angrenzenden Gebieten wollte nicht abreißen. Muslime aller Glaubensrichtungen, darunter viele Familien mit Kindern, marschierten auf das Zentrum zu, um ihre Solidarität und Betroffenheit friedlich zu demonstrieren. Gegen zehn Uhr schätzte man die Masse auf zehntausend Leute. Der Aufmarsch überforderte die Dienststellen heillos, die eigentlich für die Sicherheit der Demonstranten und der Stadt sorgen sollten. Deshalb waren alle verfügbaren Kräfte im Einsatz, inklusive aller erreichbaren Kommissare des LKA.
»Falls wirklich die Neonazis hinter der Brandstiftung stecken, sind sie noch dümmer, als ich angenommen habe«, sagte sein Kollege kopfschüttelnd. »Der Algerier Moussouni als Sunnit ist ein Todfeind der iranischen Schia. Er wird sich ins Fäustchen lachen, wenn eine schiitische Moschee brennt.«
»Ganz abgesehen davon, dass ihm nichts Besseres passieren kann als ein Polizeiapparat, dem keine Zeit mehr bleibt, nach ihm zu fahnden«, ergänzte Hansen.
Wie recht er damit hatte, zeigte sich gegen Mittag. Zur selben Zeit, als Ajatollah Rahimi vor der Ruine zur Rede ansetzte, detonierten gegenüber im Alsterpark Knallkörper, die zwar keinen Schaden anrichteten, aber eine Massenpanik auslösten. Eine Horde Kahlköpfe, mit Baseballschlägern, Schlagstöcken und Messern bewaffnet, hatte sie geworfen, bevor sie begannen, auf die flüchtenden Demonstranten einzuprügeln. Rettungskräfte verloren wertvolle Zeit, bis sie zu den Verletzten vordringen konnten. Hansens Uhr zeigte Punkt 12:15 Uhr, als das erste Todesopfer über Polizeifunk gemeldet wurde. Gleichzeitig schrillten die Telefone in der Mordkommission.
»Eine Gruppe Verdächtiger zieht Richtung Eppendorf. Gehen wir«, sagte er nach kurzem Gespräch.
Als Letzte verließen er und sein Partner das Büro.
»Wo bleibt eigentlich die Verstärkung aus Mecklenburg und Bremen?«, fragte der Kollege, während er den Zündschlüssel suchte.
»Vergiss die Verstärkung. Bremen hat das gleiche Problem. Lübeck und Rostock stehen Gewehr bei Fuß.«
»Ick sach‘s ja, Kriech!«
Er legte die Stirn in Falten und fuhr ab.
Rostock
Jonas Ullrich wartete, bis die Wohnungstür ins Schloss fiel, bevor er sich der Treppe zuwandte. Bedrückt und enttäuscht stieg er langsam hinab, ohne auf den Lärm zu achten, der von der Straße ins Haus drang.
»Kennen wir uns?«, hatte der alte Mann mit dem Ulbricht-Bärtchen zum Abschied gefragt.
Ullrich wollte es erst nicht wahrhaben. Eine geschlagene Stunde lang erzählte er seinem ehemaligen Professor für Chemie und verehrten Mentor vom wissenschaftlich-technischen Wunderwerk, das er bei der ›TransX‹ in Lubmin, im nordöstlichen Zipfel Mecklenburg-Vorpommerns, geschaffen hatte. Er redete und redete begeistert auf den alten Mann ein, ohne zu erkennen, dass er ihm nur freundlich zuhörte, aber kein Wort verstand. Sein Mentor war dement. Der scharfe Verstand hatte sich endgültig schlafen gelegt. Trotz seines fortgeschrittenen Alters war es das erste Mal, dass Ullrich hautnah mit dieser Geißel der Menschheit in Berührung kam. Seine Eltern waren früh verstorben, lang bevor der Zerfall des Gehirns einsetzte, ebenso wie seine über alles geliebte Johanna. Die Begeisterung war verflogen. Das gleißende Licht der Junisonne auf dem gewachsten Parkett des Treppenhauses wollte nicht mehr zu diesem traurigen Sonntag passen.
Immerhin konnte er nun seinen Chef beruhigen. Der geniale Physiker und Gründer der ›TransX‹, Professor Volkmann, lebte in ständiger Angst vor Industriespionen, wahrscheinlich ein Erbe der DDR-Vergangenheit. Ullrich musste mit seinem Blut unterschreiben, bevor er seinen Mentor zur Betriebsfeier einladen durfte. Der alte Mann würde nicht erscheinen. Er hatte die Einladung wohl schon vergessen. Die Feier konnte ohne gefährliche ›Externe‹ stattfinden. Wehmütig dachte Ullrich an die Zeit an der Uni zurück, in der Alter und Verfall kein Thema waren. Alles schien damals möglich, als er noch überzeugt war, im guten Deutschland zu leben.
In Gedanken versunken trat er aus dem Eckhaus gegenüber der Marienkirche auf die Lange Straße. Gebrüll und der Gestank von Feuerwerkskörpern und Fackeln holte ihn augenblicklich in die Gegenwart zurück. Er stand unversehens mitten in der Meute, die johlend, ihre schwarz-roten Fahnen schwingend, vom Stadthafen über den Burgwall herauf dem Neuen Markt zuströmte. Immer lauter skandierten die meist jungen, kahlgeschorenen Männer Parolen wie: »Islamisten raus!«, »Deutschland den Deutschen!« und »Sieg Heil!«. Sein militärischer Bürstenschnitt und die Schnürstiefel, die er trug, um seinen kaputten Fuß zu schonen, legitimierten ihn als einen der Ihren. Ob er wollte oder nicht, schob und zerrte ihn die Meute der Nazis mit sich auf den Marktplatz, wo sein Auto stand. Sein Fuß stieß an die Bordsteinkante. Er stürzte beinahe, hielt sich jedoch im letzten Moment am Vordermann fest.
»Nicht schlappmachen, Alter!«, brüllte der ihm ins Ohr.
Er richtete sich auf und spürte einen Stich, als steckte ein Hunderter Nagel im Fuß. Es war die regelmäßig wiederkehrende Erinnerung an seine dunkle Zeit im ›Gelben Elend‹, der DDR-Justizvollzugsanstalt Bautzen, in der die Stasi sich nach Lust und Laune austoben durfte.
Mit einem Mal begriff er, was die Neonazis bis zum Siedepunkt aufheizte. Ein Demonstrationszug muslimischer Männer, Frauen und Kinder näherte sich von der Kröpeliner Straße her dem Neuen Markt. Sie trugen ruhig ihre Transparente, ohne sich von den Hasstiraden der Rechtsextremisten aufhalten zu lassen. Nur Minuten trennten die beiden Massen voneinander. Polizei war noch immer keine zu sehen. Die Zeiten haben sich geändert seit der Wende und nicht immer zum Besseren, ging ihm durch den Kopf.
Endlich übertönten die Sirenen der Einsatzwagen den Krawall um ihn herum. Eine Hundertschaft Polizisten in Kampfmontur, Knüppel in der einen, Schutzschild in der anderen Hand, begann, die Nazis einzukreisen und einen Puffer zum Zug der Muslime zu bilden. Ein paar Kahlköpfe warfen Steine und Flaschen auf die anrückenden Polizisten. Die meisten verließ der Mut nach der ersten Tränengas-Granate. Ullrich staunte, wie rasch sie die Übermacht des Gegners erkannten. Sie kühlten ihre Wut über die verhinderte Schlacht gegen die Muslime an Fensterscheiben und geparkten Fahrzeugen.
»Halt, das ist mein Auto!«, brüllte er den fetten Deppen mit dem Kindergesicht an, als der mit dem Baseballschläger ausholte.
Wortlos rannte der Junge weiter. Die Frontscheibe des nächsten Wagens barst in tausend Teile und verwandelte sich in undurchsichtiges Milchglas. Ein Ausläufer der Tränengaswolke streifte Ullrich. Keuchend und hustend, mit brennenden Augen tastete er nach dem Autoschlüssel und schaffte es wie durch ein Wunder, sich im Wagen in Sicherheit zu bringen, bevor die nächste Granate platzte.
Auf dem Weg zurück ins beschauliche Küstenstädtchen Lubmin gab es im Radio nur ein Thema: die dramatische Entwicklung in Hamburg und aufflammende Unruhen in Leipzig, Dresden und Berlin. Immer wieder fragte er sich, wie es möglich war in einer aufgeklärten Gesellschaft, dass ein einziges tragisches Ereignis eine derart extreme Gewaltwelle auslösen konnte. Als er seine Wohnungstür aufschloss, suchte er immer noch nach der Antwort.