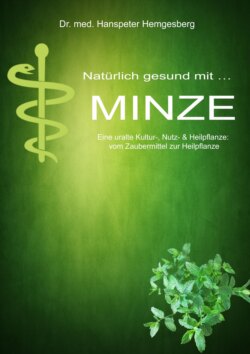Читать книгу Natürlich gesund mit.. MINZE - Hanspeter Hemgesberg - Страница 4
Rosemarie Hemgesberg
Оглавление© Copyright 2018
für das Buch Natürlich gesund mit
Minze liegt ausschließlich bei Dr. med.
Hanspeter Hemgesberg.
Nutzung - auch auszugs- und teilweise - in Wort, Schrift und allen elektronischen
(auch den zukünftigen) Kommunikationssystemen und in irgendeiner sonstigen
Form (Fotokopie, Mikrofilm und andere Dokumentations- & Archivierungs-
Verfahren) sowie die Weitergabe an Dritte und/oder die Vervielfältigung und
sonstige Verbreitung ist verboten und strafbewehrt!
Gerichtsstand: Jeweiliger Wohnort Dr. med. Hanspeter Hemgesberg
© Copyright 2018
für die Gestaltung des Covers und das Layout liegt bei M. Schlosser,
Unterhaching. Die missbräuchliche Verwendung ist strafbewehrt!
Gerichtsstand: Jeweiliger Wohnort M. Schlosser.
Ein Kräuter-Gedicht
Kräuterdüfte
Ich fahr’ durch den Lavendelbusch
und atme ein - behände
den wunderbaren, herben Duft,
das Öl an meinen Händen.
Geschenke, die der Sommer bringt,
der Kräuter Wohlgerüche,
ein Duft, der köstlich zu mir dringt
in meiner kleinen Küche.
Basilikum und Thymian,
auch Salbei ist’s und Rosmarin,
Dill, Minze und des Lorbeers Blatt;
sie sind mir so genüsslich grün.
Ich kenne sie aus Kindertagen.
Gereiht zum Trocknen hingen sie
und spendeten im Wintergarten
mir süß der Düfte Harmonie.
Ingrid Herta Drewing
(geb. 12.12.1942 * geboren in Wiesbaden und lebt auch heute noch dort * ist
pensionierte Lehrerin * hat im Laufe ihres Lebens ca. 3.500 Gedichte geschrieben)
Von Kräutern & Pflanzen:
„Gestern & Heute“
Die Nutzung von Kräutern und Pflanzen beginnt eigentlich schon mit
der Menschheits-Geschichte:
Schon immer wurden Kräuter & Co. in allen Winkeln der Erde für
Mensch und Tier genutzt. Sei es zur Ernährung, sei es als
Heilkräuter & Heilpflanzen oder auch als Duft- & Aromapflanzen.
Ein Lexikon müsste ich schreiben, wenn ich all den Kräutern und
Pflanzen gerecht werden wollte.
Aus der schier unendlichen Anzahl will ich lediglich stellvertretend
einige wenige auflisten und zwar jene, die sich bei uns in
Mitteleuropa – bes. dem deutschsprachigen Raum – einen ‚Namen‘
gemacht haben und die in der Bevölkerung beliebt und in Ver- &
Anwendung sind und zwar im Haushalt (Küche), zur Verschönerung
und zur gesundheitlichen Anwendung:
- Achillea millefolium (Schafgarbe)
- Allium cepa (Zwiebel)
- Allium sativum (Knoblauch)
- Allium ursinatum (Bärlauch)
- Anisum (Anis)
- Apium graveolens (Sellerie)
- Armoracia rusticana (Meerrettich)
- Arnica montana (Arnika/Bergwohlverleih)
- Avena sativa (Hafer)
- Bellis perennis (Gänseblümchen)
- Berberis vulgaris (Berberitze/Sauerdorn)
- Bryonia dioica (Zaunrübe)
- Calendula officinalis (Ringelblume)
- Carduus marianus (Mariendistel)
- Carum carvi (Kümmel/Feldkümmel)
- Cetraria islandica (Isländisch Moos)
- Chamomilla bzw. Matricaria chamomilla (Kamille)
- Convallaria majalis (Maiglöckchen)
- Crataegus oxyacantha (Weißdorn)
- Digitalis purpurea (roter Fingerhut)
- Echinacea angustifolia (schmalblättriger Sonnenhut)
- Euphrasia officinalis (Augentrost)
- Equisetum biemale (Schachtelhalm)
- Foeniculum vulgare (Fenchel)
- Fragaria vesca (Erdbeere)
- Gentiana lutea (Enzian)
- Hedera helix (Efeu)
- Humulus lupulus (Hopfen)
- Hypericum perforatum (Johanniskraut)
- Juniperus communis (Wacholder)
- Lavandula angustifolia (Lavendel)
- Levisticum officinale (Liebstöckel)
- Melissa officinalis (Zitronen-Melisse)
- Millefolium oder Achillea millefolium (Schafgarbe)
- Nasturtium officinale (Brunnenkresse)
- Ocimum basilicum (Basilikum)
- Origanum majorana (Majoran)
- Passioflora incarnata (Passionsblume)
- Phaeolus nanus (Bohne)
- Pimpinella alba (Bibernelle)
- Plantago major (Breitwegerich)
- Pulsatilla vulgaris (Küchenschelle)
- Raphanus sativus (Rettich/Bierrettich)
- Rheum palmatum (Rhabarber)
- Rosa canina (Hagebutte/Heckenrose)
- Rosmarinus officinals (Rosmarin)
- Rumex crispus (Sauerampfer)
- Salvia officinalis (echter Salbei)
- Sambucus niger (Schwarzer Holunder)
- Satureja hortensis (Bohnenkraut)
- Symphytum officinale (Beinwell)
- Taraxcacum officinale (Löwenzahn)
- Thymus vulgaris (Thymian)
- Urtica urens (Brennnessel)
- Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)
- Valeriana officinalis (Baldrian)
- Veratrum album (weiße Nieswurz)
- Viola odorata (wohlriechendes Veilchen)
- Viola tricoloris (Stiefmütterchen)
- Viscum album (Mistel)
- Zingiber officinalis (Ingwer)
Das soll als kleine Auswahl genügen.
Etliche der genannten Pflanzen & Kräuter sind bei uns zum festen
Bestandteil in der Küche geworden, andere wiederum haben einen
hohen Stellenwert in der naturheilkundlichen Medizin. insbesondere
auch in der Selbstanwendung als sogen. „Hausmittel“. Gerade bei
den Pflanzen & Kräutern zur gesundheitlichen Anwendung hat
sicherlich jeder von uns so seine ‚Favoriten‘.
Zuletzt:
Nicht zu vergessen die „Pfefferminze“ (Mentha piperita L.).
Dazu vorab nur so viel:
Die Minze(n) – sowohl die Blätter (das Kraut * Folia menthae piperitae), als
auch das aus den Blättern gewonnene Minz-Öl (Oleum menthae piperitae) –
waren und sind seit Jahrhunderten bzw. sogar seit Jahrtausenden
bewährte Hausmittel, die aus der alten asiatischen Heilkunde sowie
der Klostermedizin und besonders der Volksmedizin unserer Breiten
nicht wegzudenken sind.
Heute besinnt sich immer stärker auch die ‚moderne Medizin‘ im
ganzheitlichen Sinne dieses natürlichen Mittels, um den Menschen
schonende Linderung und Hilfe bei einer Vielzahl von Beschwerden
zu verschaffen.
Darüber will und werde ich nunmehr schreiben.
Minzen: Ein „Rückblick“
Im schier unerschöpflichen Fundus alter Heilkräuter-Bücher bzw. den
darin enthaltenen Rezepturen ist über die Kraft & Wirkung der Minze
u.a. nachzulesen [Quelle: Dr. med. Hanspeter Hemgesberg Büchlein „Minzöl –
Weisheit der Alten - Natürliche Gesundheit heute“]:
- Alle Minzen sind hitzig im dritten Grad.
- Die krause Minz werden von den anderen erwehlet. In Summa die
Minz ist zu vielen Dingen gut:
- Alle Minz, und sonderlich die zahme, stärken den Magen und
machen wohl dauen;
- Minz alle Tage genutzt, macht eine schöne Farb und ist zu aller
Zeit gesund;
- Die Stirn mit Saft bestrichen, benimmt das Hauptwehe;
- Der Saft mit Honigwasser getrunken, vertreibt den stinkenden
Athem und verbessert den übelriechenden Mund;
- Man mag Essig darunter tun und den Mund damit waschen, macht
gute Zähne;
- Minz essen und davon trinken bringt Frauen ihre Zeit;
- Minz ist den kalten Krankheiten eine köstliche Herzstärkung, macht
fröhlich, stärket den Magen, benimmt das Kluxen und Unwillen des
Magens.
Minzen: Gesundheit durch
uralte Haus- & Heilmittel
Es ist inzwischen – nicht einzig in der naturheilkundlichen Medizin,
sondern zunehmend auch in der wissenschaftlichen Schul-Medizin –
vielfach gesichertes Wissen, dass die Minzen weit mehr sind als ein
„Erfrischungsgetränk“!
Fakten und unwiderlegbare zudem sind:
Von der „Ur-Heilkunst“ spannt sich der Bogen über ererbte und
weitergegebene sogen. Haus-Rezepte bis hin zu den heute in der
ganzheitlichen Medizin [zumal in den klassischen Naturheilverfahren
westlicher wie östlicher Ausrichtung] wieder- und auch neu-entdeckten
Einsatz- & Anwendungsmöglichkeiten bzw. ‚Heilwirkungen‘ für die
verschiedenen Minz-Varietäten.
Die ‚klassische Pflanzenheilkunde‘ (Phytotherapie) (s.u. Erläuterung) hat in
der gesamten Naturheilkunde (unisono weltweit!) (s.u. Erläuterung) schon
seit sehr langen Zeiten – diese Zeit reicht zurück auf die Anwendung in
der sogen. ‚Erfahrensheilkunde‘ (s.u. Erläuterung) rund um den Globus –
stets schon einen wichtigen Stellenwert innegehabt.
Erklärungen zu den Fachbegriffen:
Phytotherapie / Pflanzenheilkunde
Die Phytotherapie oder Pflanzenheilkunde ist eines der ältesten Therapie-
Verfahren. Sie gehört zu den volksheilkundlichen Behandlungsmaßnahmen, die
sich hauptsächlich auf überlieferte Erfahrungen stützen. Inzwischen ist die
Phytotherapie als „komplementäre Behandlungsweise“ (auch in der Schulmedizin)
anerkannt.
Der Begriff stammt aus dem griechischen Phyton = Pflanze und therapeia =
Pflege. Der französische Arzt Henri Leclerc (1870-1955) hat ihn zum ersten Mal
verwendet.
Grundlage der Phytotherapie ist die Heilpflanzenkunde, die Phytopharmakognosie.
Sie ist die Lehre von den für medizinische Zwecke verwendeten oder
verwendbaren Pflanzen, also den Heilpflanzen. Ihr Arbeitsgebiet umfasst die
Systematisierung und Analyse dieser Pflanzen und deren Inhaltsstoffe, also die
chemische Zusammensetzung. Aber auch die Untersuchungen bisher nicht
erforschter Heilpflanzen gehören zu ihrer wissenschaftlichen Erforschung. Die
Phytotherapie enthält dadurch auch Teile der Pharmakologie, der Pharmazeutik
sowie der Toxikologie. Somit kann die Pflanzenheilkunde dem Überbegriff der
pharmazeutischen Biologie zugeordnet werden. Ihr Ziel ist es, Heilpflanzen und
ihre Inhaltsstoffe hinsichtlich ihrer therapeutischen Wirkungen zu untersuchen und
heilwirksame Ergebnisse zu dokumentieren.
Weltweit werden bisher mehr als 20.000 Pflanzenarten zur Herstellung von
Arzneimitteln verwendet. Blätter, Blüten, die ganze oberirdische Pflanze, Hölzer,
Hülsen, Früchte, Knospen, Rinden, Samen, Stängel, Wurzeln, Wurzelstücke,
Zweigspitzen und Zwiebeln werden zu therapeutischen Mitteln. Es kommen keine
isolierten Einzelstoffe zur Anwendung. Es ist stets eine Kombination der
verschiedensten Stoffteile einer Pflanze, die immer als Stoffgemisch im
menschlichen Körper wirken. Die moderne Pflanzenheilkunde folgt den
Grundsätzen der naturwissenschaftlich begründeten Medizin, indem sie von einer
Dosis-Wirkungs-Beziehung ausgeht.
Die Inhaltsstoffe einer Heilpflanze unterliegen natürlichen Schwankungen, bedingt
durch Klima, Standort und Erntezeitpunkt der Pflanze. Auch durch Lagerung und
Herstellungsprozess können die Zubereitungen aus Heilpflanzen in ihrem Gehalt
an Inhaltsstoffen beeinflusst werden. Daher sind die Standardisierungen der
Ausgangsstoffe und die Methoden für die Arzneimittel-Herstellung sehr wichtig. Es
sollen alle Phytopharmaka definierte Mengen von Wirkstoffen und gleichbleibende
Qualität und Wirksamkeit aufweisen.
Die Phytotherapie ist eine individuelle Therapie, die sich die verschiedenen Wirkprinzipien von Pflanzen zunutze macht. Die wichtigsten Wirkungen von
Heilpflanzen sind der Ersatz von fehlenden Stoffen, die Steigerung verschiedener
Funktionen und antibakterielle und antivirale Einflüsse. In der Regel nicht
angebracht sind Phytotherapeutika aber in der Akut- und Notfall-Medizin sowie bei
schweren Erkrankungen, es sei denn zur weiteren Unterstützung einer chemisch
definierten medikamentösen Therapie.
Man unterteilt die Pflanzen in drei Arten je nach ihrer Wirksamkeit: Mite-Pflanzen
wirken mild; Forte-Pflanzen haben starke Wirkungen. Dazwischen liegen Kräuter
und Gewächse, die in großer Zahl durch ausgeglichene Inhaltsstoffe wirksam sind.
Die Therapie mit Heilpflanzen in Form von Frisch-Pflanzen, Volldrogen oder
isolierten Reinsubstanzen kommt für alle Gebiete der Heilkunde infrage. Eine
Volksweisheit sagt: „Gegen jedes Leiden ist ein Kräutlein gewachsen!"
Pflanzliche Medikamente zeichnen sich vor allem durch ihre meist gute
Verträglichkeit aus. Ihre Wirkung setzt meist nicht sofort ein. Man muss zuwarten.
Auch für pflanzliche Arznei gilt: "Was wirkt, hat auch Nebenwirkungen!"
Phytotherapeutika haben nur bei richtiger Anwendung ihren Nutzen. Nur dann
gelten sie als unbedenklich. Sie sind durchaus eine „sanfte" Medizin. Zwar sind
akute Nebenwirkungen selten, sie können allerdings bei zu hoher Dosierung und
zu langer Einnahme auch bei dem einen oder anderen Patienten vorhanden sein.
Einige Pflanzen lösen sogar Allergien aus. Hautausschläge sind dann typisch.
Darauf ist von Patienten, die bereits allergische Empfindlichkeiten aufweisen, zu
achten.
Stark wirkende Heilpflanzen wie Fingerhut (Digitalis), Tollkirsche (Atropin) oder
Schlafmohn (Morphin), die medizinisch recht häufig eingesetzt werden, haben bei
bereits mäßiger Überdosierung erhebliche Nebenwirkungen und Toxizität. Deshalb
gehören diese Medikamente stets in die Hand eines erfahrenen Arztes. Sie
kommen in der klassischen Phytotherapie nach Kneipp nicht zur Anwendung.
Ein Mittel muss abgesetzt werden, wenn Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder
auffällige Haut- oder Schleimhaut-Reaktionen auf die Einnahme des Pflanzen-
Mittels zurückgeführt werden können. Besondere Vorsicht ist bei Säuglingen,
Kleinkindern, Schwangeren, sehr alten Menschen und psychisch Schwerkranken
geboten.
In den letzten Jahren stößt die Verwendung von pflanzlichen Medikamenten auf
ein immer größeres Interesse.
Fazit:
Die Pflanzenheilkunde kann therapeutische Lücken schließen und Heilung oder
auch Linderung chronischer oder akuter Leiden verlässlich und nach den Regeln
der medizinischen Heilkunde unterstützen. Damit ist die Phytotherapie längst mehr
als die Anwendung von bewährten und seit Generationen vererbten alten
Hausmitteln. Wissenschaftliche Untersuchungen und auch ärztliche Erfahrungen
seit Jahrzehnten haben gezeigt, dass die Wirkung der Gesamt-Pflanze in vielen
Fällen größer ist als die Wirkung der pharmakologisch-chemisch isolierten
Reinsubstanzen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind zahlreiche Erkrankungen von
Magen, Leber, Gallenblase, Atemwege, Kinder- und Alterskrankheiten oder auch
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch psychische Erkrankungen sind ein
dankbares Behandlungsgebiet.
{Quelle: Dr. med. Lutz Koch / „Praxis Magazin“ 03/2015}
Kurz & knapp zusammengefasst:
Unter Phytotherapie/Pflanzenheilkunde versteht man die Behandlung und
Vorbeugung von Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen durch Pflanzen,
Pflanzenteile und deren Zubereitungen (Pulver, Tee, Extrakt, Tinktur, Tabletten,
Dragees, Kapseln und Injektionsampullen).