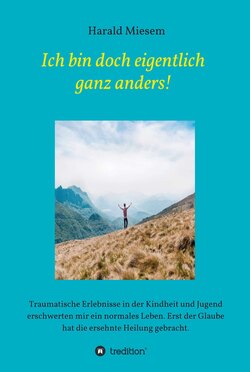Читать книгу Ich bin doch eigentlich ganz anders! - Harald Miesem - Страница 10
ОглавлениеKapitel 4
Hin- und hergeschoben
Immer noch unter Schock betrachte ich die Häuser des neuen Heims. Hier ist alles viel größer als in Bottrop. Einladend sieht das nicht aus! Mich schüttelt es. In diesen hässlichen Gemäuern soll ich nun leben?
Meine Gedanken werden jäh unterbrochen. Mein Taxifahrer ergreift mich an meinem Arm und zieht mich in Richtung eines der Gebäude. Die Eingangstür öffnet sich knarrend. Weiter geht es durch einen Flur hindurch, bis wir das Büro der Heimleiterin erreichen. Nach kurzem Klopfen ertönt eine Stimme: „Herein!“ Wir betreten einen kleinen Raum. Hinter ihrem Schreibtisch sitzend mustert mich eine Frau: „Ach, du bist der Neue aus Bottrop. Wie heißt du noch?“ Verlegen, den Fußboden anstarrend, flüstere ich leise: „Harald.“
Nun folgen viele Fragen, die sie mir in einem sehr herrischen Ton stellt, was meine Schüchternheit ansteigen lässt. Tapfer beantworte ich jede Frage, in der Hoffnung, es bald hinter mir zu haben. Zum Schluss befiehlt sie einer jungen Frau, die inzwischen das Büro betreten hat, mich zu meiner neuen Wohngruppe zu bringen.
Lustlos schlendere ich hinter der Frau her. Sie ist eine Praktikantin, erklärt sie mir fröhlich. Hilde Martin heißt sie. „Wenn du Fragen hast oder etwas brauchst, kannst du mich gerne ansprechen!“, bietet sie mir an. Höflich bedanke ich mich bei ihr. Doch in mir schreit alles: „Weg hier! Egal, wohin! Nur weg hier!“
In der Gruppe angekommen stellt sie mich den anderen Kindern vor. Fräulein Martin scheint sehr beliebt zu sein, denn sie wird herzlich und sehr freudig von den Kindern begrüßt. Ich stehe beobachtend am Rand des Geschehens. Fräulein Martin wird von den Kindern bestürmt, und alle reden gleichzeitig auf sie ein. Freundlich und geduldig geht sie auf jedes Kind ein. Langsam lässt meine Angst vor dem neuen Heim nach. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Fräulein Martins Art erinnert mich an die Schwestern aus dem Kinderheim.
Nach einigen Minuten löst sie sich von den Kindern: „Harald, nun zeige ich dir dein Zimmer.“ Wir betreten einen langen Flur, an dem viele Zimmertüren liegen. An einer bleiben wir stehen. Als sie die Tür öffnet und mich in den Raum schiebt, trifft mich der Schlag: Zwei Stockbetten in einem extrem kleinen Raum! Hier schlafen vier Jungen in einem Zimmer! Schockiert sehe ich zu Fräulein Martin, die fröhlich auf das Bett an der Tür zeigt. „Das obere ist noch frei. Das kannst du beziehen.“ Mit weit aufgerissenen Augen sehe ich sie an: „Das darf doch nicht wahr sein!“ Innerlich fröstelt es mich. In Bottrop hatte ich mein eigenes Zimmer. Jetzt muss ich in einem Vierbettzimmer leben und dann auch noch im oberen Bett schlafen. Innerlich schreit es wieder laut: „Das halte ich nicht lange aus, bei der ersten Gelegenheit werde ich abhauen!“
Fräulein Martin scheint meine Entrüstung nicht zu bemerken. Sie bittet mich, meine Wäsche in den für mich vorgesehenen Schrank zu legen. Dann überlässt sie mich meinem Schicksal und geht fröhlich von dannen.
Unruhig erledige ich brav die Aufgabe. Wie kann ich hier raus? Das halte ich nicht aus! Ich muss weg hier! Sobald ich fertig bin, verlasse ich das Zimmer. Nur schnell weg hier! Eilig laufe ich aus dem Haus und erkunde das Umfeld des Heims, um einen Unterschlupf für mich zu suchen. Innerlich tobt eine Diskussion: Soll ich sofort abhauen oder auf eine bessere Gelegenheit warten?
Die innere Seite „Warten“ siegt schließlich. Widerwillig kehre ich zum Haus zurück, öffne die Eingangstür und schleiche mich auf mein Zimmer. Hoffentlich spricht mich niemand an! Lasst mich bloß alle in Ruhe! Innerlich geladen erklimme ich mein neues Bett. Der Schock in mir sitzt tief. Warum? Warum haben die mich hierhin geschickt? Was habe ich bloß falsch gemacht, dass sie mich hierhin abgeschoben haben? Grübelnd krieche ich immer tiefer unter meine Bettdecke.
Eine schrille Glocke reißt mich aus meiner Grübelei, oder war es Schlaf? Egal, es ist Abendbrotzeit. Soll ich liegen bleiben? Aber man weiß ja nie, wann es wieder nichts zu essen gibt. Mies gelaunt klettere ich aus dem Bett und suche den Speisesaal.
Dort angekommen stellt mich eine Erzieherin den anderen Kindern vor. Dann weist sie mir einen Platz zu, an dem einige Jungs sitzen. Diese machen sich gierig über das Essen her, während ich appetitlos vor meinem vollen Teller sitze. Ich bringe keinen Bissen rein.
Nach dem Abendbrot dürfen wir uns frei bewegen. Die meisten Kinder laufen nach draußen. Ich schlurfe ins Zimmer zurück, um in dem Buch weiterzulesen, welches ich aus Bottrop mitgebracht habe. Während der ersten Zeilen ist es auch schon wieder vorbei mit meiner Ruhe. Meine Zimmergenossen stürzen laut lärmend herein. Wir machen uns kurz miteinander bekannt: Hans schläft unter mir, erfahre ich. Er kommt aus Krefeld. Ihm gegenüber schläft Johannes, der aus Mülheim hierhin gekommen ist. Mir gegenüber im oberen Bett schläft Markus aus Bielefeld.
Wir unterhalten uns eine Zeit lang. Dann ertönt das Kommando, dass wir uns bettfertig zu machen haben. Die Jungs zeigen mir den Waschraum. Die sind ja ganz nett, meint eine innere Stimme in mir. Na ja, warten wir mal ab, wie es sich entwickeln wird! Im Bett zurück schnappe ich mir erneut mein Buch. Doch meine drei Zimmergenossen sind ganz anders drauf als ich.
Eine halbe Stunde lang erzählen sie sich Witze und schütteln sich vor Lachen. Wie soll ich mich denn da auf mein Buch konzentrieren? Ein „Gute Nacht, Jungs!“ unterbricht den ausgelassenen Lärm. Wir müssen das Licht ausschalten und schlafen. Schlafen in einem Hochbett! Es ist so schrecklich hoch.
Ängstlich drücke ich mich sicherheitshalber an die Wand. Bloß nicht zu nahe an die Kante kommen, sonst falle ich runter. Hans, Johannes und Markus schlafen bereits wie die Murmeltiere. Ich hingegen erwache immer wieder und bringe mich zur Wand rutschend in Sicherheit. Das Kommando „Aufstehen, Jungs!“ am nächsten Morgen erlöst mich endlich.
Die neue Schule
Mit dem Heimwechsel ist auch ein Schulwechsel verbunden. Ein scheinbar dauerhaft gut gelauntes Fräulein Martin bringt mich zu meiner neuen Schule, stellt mich beim Rektor vor, begleitet mich gemeinsam mit ihm noch bis zur Klasse, dann ist sie weg und ich bin alleine mit vielen neuen Gesichtern. Der Rektor stellt mich der Klasse vor. Unsicher stehe ich neben ihm. Es ist schrecklich für mich, vorne stehen zu müssen und mich von allen angaffen zu lassen. Der Rektor erzählt, wer ich bin, wo ich herkomme und erwähnt, dass ich aus dem Heim komme. Einige Neu-Klassenkameraden lachen verstohlen und mustern mich von oben bis unten. Es ist genau wie in Bottrop! Das kann ja was werden!
Die Schulglocke ruft zur Pause. Meine neuen Klassenkameraden stürmen Richtung Pausenhof. „Du kannst dir gerne den Schulhof ansehen!“, ermutigt mich der Lehrer und zeigt einladend auf den Hof. Unsicher schlendere ich zum Schulhof. Dort umringen mich sofort einige Jugendliche: „Du bist also aus dem Heim!“, raunzt mich einer der Jungs an.
Mit verschränkten Armen baut er sich provozierend vor mir auf. Die anderen schließen sofort einen Kreis um mich. „Mein Vater sagt immer, dass ihr Heimkinder alle klaut. Erwischen wir dich dabei, machen wir dich fertig!“ Seine bedrohlich erhobene Faust macht mir unmissverständlich deutlich, dass er es ernst meint.
Meine Versuche, ihm zu erklären, dass ich noch nie geklaut habe, helfen nicht. Er glaubt mir nicht. Alle Jungs um mich herum werden aggressiver und rücken mir immer mehr auf die Pelle. Die werden mich gleich verprügeln, so aufgebracht, wie die sind. Ängstlich und hilfesuchend sehe ich mich nach einem Lehrer um. Doch weit und breit entdecke ich keinen.
Deshalb beschließe ich, mich still zu verhalten und nichts mehr zu sagen. Ein heftiger Schubser des Jungen, der vor mir steht, beendet meine bedrohliche Lage. Er dreht sich um und geht. Die anderen folgen ihm. Erst jetzt kommt meine Angst so richtig raus. Schlotternd stehe ich auf dem Hof. Am besten wäre es, jetzt einfach abzuhauen. Doch wohin?
Aus der Schule zurück verkrieche ich mich sofort in meinem Bett. Ich brauche jetzt Zeit zum Nachdenken. Pustekuchen! Von wegen: In Ruhe nachdenken! Zwei meiner Zimmerkollegen stürmen in den Raum, während ich in meiner Bettburg hocke. Lachend setzen sie sich auf die Kanten ihrer Betten und erzählen sich wiederum einen Witz nach dem anderen.
Können die nicht draußen Witze erzählen? Warum denn hier? Verzweifelt und missmutig verlasse ich meine Burg. Ich will Ruhe haben! Ohne groß nachzudenken laufe ich aus dem Haus, zu einem Wald, der am Rande meines Schulweges liegt. Es muss doch einen ruhigen Rückzugsort für mich geben!
Suchend laufe ich tiefer in den Wald hinein. Dann sehe ich es: Ein Erdloch, gerade groß genug für mich. Das ist ein sehr gutes Versteck!
Ich spüre förmlich, wie sich Erleichterung in mir ausbreitet: Endlich habe ich etwas gefunden, das mein neuer Lieblingsplatz werden kann. Wie kann ich das Loch so verstecken, dass es niemand findet? Nachdenklich suche ich nach Material. Wenn ich Äste über das Loch lege und noch etwas Laub zur Tarnung auf die Äste verteile, dann ist es für niemanden mehr zu sehen: Sehr gut! Das ist eine hervorragende Unterkunft für Notfälle. Frohlockend mache ich mich unverzüglich an die Arbeit. Nach drei Stunden ist mein Notquartier fertig. Zufrieden betrachte ich mein Werk. Dieses Versteck wird niemand so leicht finden. Nun, wo ich endlich einen Rückzugsort für mich gefunden habe, kann ich hoffnungsvoll in meine Zukunft hier in Espelkamp gehen. Mit einem guten Gefühl und stolz auf mein Werk kehre ich ins Heim zurück.
Anfeindungen
Am nächsten Morgen gehe ich mit bangem Herzen zur Schule. Am liebsten würde ich am Waldrand abbiegen und mich in meiner Höhle verstecken. Was werden die Burschen heute machen? An der Schule angekommen verstecke ich mich hinter einigen Büschen und beobachte die anderen Kinder aus sicherer Entfernung. Die Schulglocke ertönt. Der Hof leert sich schnell. Jetzt kann auch ich das letzte Stück zur Schule gehen. Doch ich komme zu spät an: Die Klassentür ist bereits geschlossen. Oh je, was für eine Peinlichkeit! Zögernd klopfe ich an die Tür. Der Klassenlehrer öffnet und bittet mich in die Klasse: „Setz dich! Ab morgen erwarte ich von dir, dass du pünktlich erscheinst.“ Erleichtert, dass er mir keine Moralpredigt vor der ganzen Klasse hält, setze ich mich auf meinen Platz neben Thomas.
Als es zur Pause schellt, bin ich der Erste, der zur Tür hinaus stürmt. Bloß schnell weg, damit mich die anderen nicht wieder in die Finger bekommen! Aus sicherer Distanz, versteckt hinter einem Busch, beobachte ich das Treiben auf dem Schulhof. „Wo ist denn der Neue aus dem Heim?“, höre ich. Es ist der Junge, der mich gestern schon so angemacht hat. Eine Gruppe von Jungs macht sich auf den Weg, um mich zu suchen. Zwei von ihnen kommen direkt auf mein Versteck zu: „Da steckt er ja!“ Unverzüglich kommen alle zu mir und nehmen mich in ihre Mitte. Ein innerer Warnruf ertönt.
Doch bevor der Riese mit den Bärenkräften in mir erwacht, erklingt die Stimme eines Lehrers: „Auseinander mit euch!“ Mit eiligen Schritten kommt er zu uns gelaufen: „Was ist hier los?“ In großer Einigkeit deuten die Jungs auf mich: „Der aus dem Heim hat Streit angefangen!“ Der Lehrer packt mich beim Arm. Sein Griff ist sehr schmerzhaft. „So, so! Gerade hier angekommen und schon Streit anzetteln! Das lassen wir hier nicht durchgehen. Den Rest der Pause bleibst du bei mir. Dann bin ich sicher, dass Ruhe auf dem Schulhof herrscht.“ „Aber ich habe doch gar nichts gemacht!“, versuche ich mich zu verteidigen. Doch der Lehrer packt nur noch fester zu: „Du willst mir also weismachen, dass die anderen alle lügen?“ Nun lacht er mich aus. Mit festem Griff schleift er mich mit.
Den Rest der Pause muss ich an seiner Seite bleiben. Erst die Glocke erlöst mich. Schnell renne ich zu meinem Sitzplatz im Klassenraum und versinke in meinen Gedanken. Der Unterricht erreicht mich nicht. Verzweifelt grüble ich darüber, wie es weitergehen soll. Ich habe große Angst vor meiner Zukunft hier an dieser Schule.
Nach der letzten Schulstunde jage ich wie ein Getriebener aus dem Klassenraum: Nur nicht der Meute in die Hände fallen! Schnurstracks renne ich zu meiner Höhle und verkrieche mich in dem Bau. Nach einiger Zeit kehrt endlich wieder Ruhe in mir ein.
Als ich zum Heim zurückkehre, läuft mir die Leiterin über den Weg: „Na, Harald, wie war dein Schultag?“ Schüchtern sehe ich sie an: „Die anderen Jungs wollten mich verprügeln!“ Sie mustert mich von oben bis unten: „Und, was hast du angestellt, dass sie dich verprügeln wollten?“ Ich erzähle ihr von dem Jungen, der übrigens Matthias heißt: „Er ist in meiner Klasse. Matthias hat überall herumerzählt, dass alle Heimkinder Diebe sind. Die anderen glauben ihm.“ Ungläubig sieht sie mich an: „Harald, diese Geschichte hast du dir doch nur ausgedacht!“, sagt sie und verschwindet in ihrem Büro. Frustriert setze ich meinen Weg zum Zimmer fort. Die Erwachsenen kotzen mich an! Ich erklimme meine Bettburg und grüble über die Ungerechtigkeiten dieser Welt.
Beim Abendbrot begegne ich Fräulein Martin. „Na, Harald“, mustert sie mich, „dein Tag war wohl nicht so gut?“ Brummig sehe ich sie an. Weil ich jetzt weiß, dass die Erwachsenen mir sowieso nicht glauben und ich ihnen egal bin, halte ich lieber den Mund. „Wenn du jemanden zum Reden brauchst“, bietet sie mir an, „kannst du mich gerne auf meinem Zimmer besuchen.“ Um meine Ruhe zu haben, verspreche ich ihr, dass ich das machen werde. Doch mein Entschluss steht fest: Ich werde niemandem mehr vertrauen!
Zu meiner Erleichterung verlaufen die nächsten Wochen ruhiger. Die Jungs in der Schule lassen mich in Ruhe. Ich schaffe es, mich mit anderen Jugendlichen anzufreunden, was mir gut tut. Doch eines Tages verbreitet sich die Nachricht, dass einem Mädchen aus der fünften Klasse der Turnbeutel geklaut wurde. Sofort werde ich nach der Schule wieder von Matthias und seiner Clique in die Mangel genommen: „Hey, du Heimkind!“, ertönt seine verächtliche Stimme. „Rück sofort den Turnbeutel raus!“ Seine Fäuste erheben sich. Hilfesuchend versuche ich mich zu verteidigen: „Ich habe nichts mit dem Diebstahl zu tun!“ Aufgebracht brüllt er zurück: „Nicht nur klauen, sondern auch noch lügen!“ Seine Faust trifft mich im Gesicht. Von der Wucht des Schlages gehe ich zu Boden. Nun gerät die Clique in Rage. Alle treten auf mich ein. Krampfhaft versuche ich, mich so klein wie möglich zu machen, so dass sie mich nicht so heftig treffen können.
„Was seid ihr doch für Feiglinge!“, schreit ein Mädchen, das eilig auf die wilde Meute zurennt. Sie reißt Matthias zurück, der gerade zu einem erneuten Tritt ausholt. „So viele gegen einen! Das ist nicht gerade mutig!“, brüllt sie. Matthias, der deutlich größer ist als sie, baut sich provozierend vor ihr auf. Doch da erscheinen die Klassenkameraden des Mädchens. Sie sind deutlich in der Überzahl. Fluchtartig rennen meine Angreifer weg. Auch Matthias gibt kleinlaut auf und verzieht sich.
Meine Retter ziehen mich auf die Füße. Ich bedanke mich bei ihnen und renne, so schnell ich kann, zum Heim zurück. Mit mir rennt meine Angst. Ist die Meute noch hinter mir? Werden sie mir womöglich woanders auflauern? Panisch rennend suche ich ständig die Gegend ab, um vorbereitet zu sein.
Zum Glück erreiche ich unbehelligt das Heim. Schnurstracks gehe ich in mein Zimmer und klettere in meine Bettburg. Die Angst sitzt mir den ganzen Tag im Nacken. Ich lasse alle Mahlzeiten aus, bleibe grübelnd im Bett liegen, bis abends das Licht ausgeschaltet wird. Es scheint niemanden zu kümmern, dass ich nicht auftauche. In der Nacht träume ich schreckliche Szenen und werfe mich unruhig hin und her. Ein lauter Aufschlag weckt mich. Sofort spüre ich heftige Schmerzen im Mund.
Was ist passiert? Wo bin ich? Nach und nach begreife ich, dass ich aus dem Hochbett gestürzt bin. Der Schmerz im Mund ist schrecklich. Vorsichtig fühle ich an meinen Zähnen. Keiner meiner Zimmerkollegen ist erwacht. Ich rappele mich auf und laufe erschrocken auf den Flur. Ich brauche Hilfe!
Suchend laufe ich die Gänge entlang, bis Frau Burkhardt, die heute Nachtdienst im Heim hat, mich findet: „Ach du liebe Güte! Was hast du denn gemacht?“ Eilig wischt sie mir das Blut ab. Dann sieht sie nach meinen Zähnen: „Oh weh, das sieht nicht gut aus! Wir müssen sofort zum Zahnarzt.“ Es läuft wie ein Film an mir vorbei. Die Schmerzen sind extrem. Ich bekomme mit, wie man mich in ein Auto legt. Mit einem Tuch soll ich das Blut wegwischen, während man mich zur Zahnarztpraxis fährt.
Dort angekommen erwartet mich ein unfreundlicher Arzt. Er befiehlt mir, den Mund zu öffnen, was mir irgendwie auch gelingt. Doch mein Mund muss noch weiter geöffnet werden. Das kann ich nicht: Es tut zu weh! Schon packen die Hände des Arztes zu und ziehen mir den Kiefer auseinander. Es tut so schrecklich weh! Ich höre, wie er sagt, dass die Schneidezähne gezogen werden müssen. Dann stutzt er. Nachdenklich sieht er mich an. Er wirkt plötzlich freundlicher: „Sag mal, Junge, was ist denn mit deinen Zähnen passiert? Hattest du mal einen Unfall?“ Ich kann mich an keinen Unfall erinnern. „Nein“, sage ich leise.
„Aber mein Stiefvater hat mir mit einem Kochlöffel meine Schneidezähne abgeschlagen.“ Der Doktor und meine Begleiterin sind entsetzt. „Wie grausam kann doch ein Mensch sein!“ Schweigen erfüllt den Raum, während der Zahnarzt mit meinen Zähnen beschäftigt ist. Er wirkt traurig: „Ach, Junge, wäre man mit dir rechtzeitig zum Zahnarzt gegangen, hätten wir deine Zähne vermutlich jetzt nicht ziehen müssen. Doch sie sind so verdorben, dass ich keine andere Wahl habe.“
Eine halbe Ewigkeit lang versucht er, meine Zähne zu ziehen. Immer wieder stöhnt er auf: „Puh…die sitzen aber ganz schön fest!“ Die Schmerzen merke ich kaum. Ich bin anderweitig beschäftigt: Was werden die Klassenkameraden sagen, wenn ich mit einer riesigen Zahnlücke ankomme?
Als der Zahnarzt fertig ist, betrachte ich mich in einem Spiegel. Zu meinem Entsetzen ist die Lücke noch größer, als ich sie mir vorgestellt hatte. Mich schaudert es. Die Schmerzen, die plötzlich doch mit aller Wucht für mich wieder fühlbar werden, lenken mich von meinen Gedanken ab. Die Erzieherin wird noch mit Anweisungen ausgestattet. Dann geht es zurück zum Heim. Immer noch unter Schock stehend klettere ich widerspruchslos in mein Bett, aus dem ich vor einigen Stunden herausgefallen bin. Ich will jetzt niemanden sehen oder sprechen. Zusammengekrümmt vor Schmerzen ziehe ich die Bettdecke über meinen Kopf. Irgendwann übermannt mich der Schlaf.
Am Morgen, meine Zimmergenossen sind schon zur Schule gegangen, öffnet sich die Zimmertür. Fräulein Martin sieht nach mir: „Na, wie geht es dir, Harald?“ Brummig gebe ich zur Antwort, dass es mir beschissen geht und ich meine Ruhe haben will. Fräulein Martin dreht sich um. An der Tür schaut sie nochmals zu mir: „Ich kann dich verstehen!“, säuselt sie und lässt mich alleine. In die Bettdecke eingehüllt hänge ich meinen zahlreichen Gedanken nach. Was muss ich denn noch alles ertragen? Ich mag nicht mehr!
Lautes Rufen weckt mich. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Die Jungs aus meinem Zimmer stehen vor mir. „Harald, zeig mal deine Zahnlücke!“, werde ich aufgefordert. „Ihr könnt mich alle mal… ! Lasst mich einfach in Ruhe!“, brumme ich. Demonstrativ drehe ich mich Richtung Wand. Einige Minuten hänseln sie mich weiter, dann gehen sie wieder. Mein Bett ist meine sichere Burg. Den ganzen Tag komme ich nicht hervor.
In Bedrängnis
Drei Tage darf ich im Heim bleiben. Doch dann beginnt für mich wieder der Alltag. Bei dem Gedanken an die Schule vergeht mir wieder einmal der Appetit. Innerlich gerate ich schon bei dem Gedanken an die Begegnung mit der Meute in Panik. Mir ist völlig klar, dass sie wieder über mich herfallen werden. Doch ich bin gezwungen, zur Schule zu gehen. Ich habe ja keine andere Wahl. Zögernd setze ich mich in Bewegung, verstecke mich wieder, bis die Glocke läutet, und schleiche als Letzter mit zusammengepressten Lippen in meine Klasse. „Harald! Da bist du ja wieder!“, werde ich freundlich von Herrn Maier begrüßt. „Du hast ja einiges hinter dir, habe ich gehört. Setz dich einfach und komm erst mal an!“ Erleichtert lasse ich mich auf meinen Stuhl fallen. Für diesen Moment bin ich gerettet.
Als die Glocke zur Pause ruft, stürmen alle nach draußen, nur ich nicht. Ich bleibe auf meinem Platz sitzen. Herr Maier schaut mich besorgt an und kommt zu mir: „Na, Harald, warum gehst du nicht mit den anderen nach draußen?“ Leise kommt aus mir heraus: „Die verhauen mich doch sowieso nur.“ Er zieht einen Stuhl heran und setzt sich zu mir. Schweigend sieht er mich an.
Es tut mir gut, dass er mich nicht einfach nach draußen schickt. Ich fasse Vertrauen: „Ich soll gestohlen haben, behaupten Matthias und die anderen. Dabei habe ich noch nie etwas gestohlen. Aber sie glauben mir nicht. Für sie bin ich das Heimkind, das sowieso stiehlt.“ Das erste Mal, seitdem ich in Espelkamp angekommen bin, schießen mir Tränen in die Augen. Das ist mir peinlich. Verstohlen wische ich sie ab. Herr Maier versichert mir, dass er sich der Sache annehmen wird, und ermutigt mich, doch noch in die Pause zu gehen. Gemeinsam gehen wir nach unten.
Während ich den Pausenhof betrete, geht Herr Maier zum Aufsicht führenden Lehrer und informiert ihn. Ängstlich stelle ich mich in eine Ecke des Hofes. In dieser Pause passiert nichts.
Auch in den nächsten Pausen bleibt alles ruhig. Sobald ich bedrängt werde, mischt sich ein Lehrer ein. Doch der Weg von der Schule zum Heim wird zum Spießrutenlauf. Die Jungs haben mich abgefangen, hänseln und bedrängen mich. Es geht alles blitzschnell: Auf einen inneren Gedankenimpuls hin werfe ich meinen Tornister ab, den sie bereits gepackt haben.
Lauf, Harald, du bist schnell! Ohne weiter nachzudenken, renne ich los. Bis die Meute begriffen hat, dass sie nur den Tornister in den Händen hält, habe ich schon eine große Distanz zu ihnen gewonnen. Von wütenden Drohungen begleitet renne ich um mein Leben und mache mich aus dem Staub.
Japsend rase ich zum Heim, wo ich der Heimleiterin in die Arme renne. Diese bemerkt sofort, dass mein Tornister nicht auf meinen Schultern ist. Völlig außer Atem erkläre ich, was passiert ist. Verwundert über meine Geschichte sieht sie mich an: „Morgen gehen wir gemeinsam zur Schule und klären das.“ Schon ist sie weg.
Doch am nächsten Morgen erscheint sie nicht, sondern Fräulein Rohrmann wird abkommandiert zu klären, was an meiner Geschichte dran ist.
Wir gehen schnurstracks zum Rektor, der sich meine Geschichte anhört. Die Jungs werden ins Büro zitiert. Matthias marschiert vorne weg. Er strahlt über das ganze Gesicht und tut so, als ob er die Unschuld vom Lande sei. Der Rektor sieht alle an: „Warum lasst ihr Harald nicht in Ruhe?“, fragt er mit strenger Stimme. Matthias bläht sich auf: „Aber wir machen doch gar nichts! Harald ist derjenige, der immer wieder Streit sucht.“ Die anderen Jungs bestätigen seine Aussagen. Der zuvor freundliche Rektor wendet sich zu mir: „So, so, auch noch lügen! Ich werde künftig ein wachsames Auge auf dich haben, Harald! Ab mit euch in die Klasse!“
Wieder einmal glaubt man mir nicht! Wie ungerecht ist diese Welt! Ich werde keinem mehr vertrauen, egal, wie nett er ist! Am besten ist es sowieso, immer alleine zu bleiben. Von diesem Tag an bin ich ein Einzelgänger, der niemandem mehr vertraut und kaum ein Wort redet.
Als ich nach der Schule zum Heim zurückkehre, werde ich sofort zur Heimleiterin zitiert: „Ich habe gehört, dass du ziemlich streitsüchtig bist!“, mault sie mich an. „Das lasse ich nicht durchgehen. Du hast zwei Wochen Hausarrest. Nur, um in die Schule zu gehen, wirst du das Heim verlassen. Jetzt geh auf dein Zimmer!“ Wortlos drehe ich mich um und gehe. Im Zimmer angekommen krieche ich in meine Bettburg. Grüblerische Gedanken schwirren durch meinen Kopf.
Erwachsene sind schrecklich! Sie glauben einem nicht. Die stecken doch alle unter einer Decke! Ich werde abhauen. Hierbleiben bringt ja sowieso nichts. Die Welt ist so was von ungerecht!
Statt am nächsten Morgen zur Schule zu gehen, verkrieche ich mich in meinem Versteck im Wald. Erst der Hunger treibt mich wieder ins Heim zurück. Ärger erwartend schleiche ich mich durch das Haus. Doch heute schimpft niemand mit mir.
In den nächsten Wochen schwänze ich immer öfter den Unterricht. Bin ich mal in der Schule, kommt es ständig zu Konflikten. Immer werde ich als Schuldiger ausgemacht. Einige Male nehmen Matthias und seine Clique mich in die Mangel. Die Schuld wird immer mir in die Schuhe geschoben. Die Lehrer glauben ihnen mehr als mir.
Auch im Heim wird es immer schwieriger für mich. Ich habe den Eindruck, dass außer Fräulein Martin mir sowieso niemand glaubt. Mein innerlicher Frustpegel steigt immer weiter an. Die Höhle im Wald wird zu einem oft besuchten Rückzugsort. Ermahnungen der Lehrer und Erzieher prallen inzwischen an mir ab: Was soll ich mir noch Mühe geben, wenn mir sowieso niemand glaubt? Lasst mich doch alle in Ruhe!
Pastor Müller
„Du bist also der Harald!“ Vor mir steht ein großer Mann, den ich bisher noch nicht im Heim gesehen habe. „Guten Tag, Harald. Ich bin Pastor Müller“, stellt er sich mir vor. „Ich würde gerne mal mit dir sprechen.“ Misstrauisch beäuge ich ihn.
„Lass uns in die Kirche gehen. Dort können wir uns in Ruhe unterhalten.“ Pastor Müller dreht sich um und geht voraus. Verwundert sehe ich ihm hinterher. Er schleift mich nicht mit. Was soll ich tun? Abhauen oder ihm folgen? Er scheint anders zu sein als die Menschen, die ich bisher hier in Espelkamp getroffen habe. Ausgenommen davon ist nur Fräulein Martin. Ich entscheide mich, ihm zu folgen, weil er mir die Wahl gelassen und mich nicht gezwungen hat.
Zögerlich betrete ich die Kirche. Eine Stille empfängt mich, die ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Die Stille ist sehr angenehm. Langsam bewege ich mich auf Pastor Müller zu, der inzwischen auf einer der Kirchenbänke sitzt. Mit einem Blick deutet er mir an, dass ich mich auch setzen soll. Schweigend betrachtet er mich lange: „Hast du eine Idee, weshalb ich mit dir sprechen möchte?“ Trotzig platze ich heraus: „Sie wollen mir sicher auch ein schlechtes Gewissen machen, wie all die anderen!“ Er sieht mich sichtlich irritiert an: „Ich habe gehört, dass du in der Schule fast immer Streit anzettelst, wenn du überhaupt mal zur Schule gehst. Und im Heim werden sie auch nicht mit dir fertig.“
Wieder lässt er sich lange Zeit. Mit verschränkten Armen sitze ich auf der Bank, innerlich zum Sprung bereit, um aus der Kirche zu flüchten. „Ich möchte dir helfen, Harald!“ Der ist doch genau so ein Betrüger und Lügner wie die anderen! „Dann wären sie aber der Einzige!“ Voller Zorn blicke ich ihn an.
Pastor Müller fragt mich, wie denn meine Sicht der Dinge ist. Na, die kann er erfahren! Meine Worte überschlagen sich. Je mehr ich berichte, um so heftiger schüttelt er den Kopf: „Das ist ja kaum zu glauben, Harald!“ Pastor Müller verspricht mir, sich für mich einzusetzen. Meine Güte, wie oft habe ich diesen Spruch schon gehört! Und hat sich etwas geändert? Nein! Es ist immer schlimmer für mich geworden! Das Gespräch ist abrupt für mich beendet. Ich springe auf und verlasse die Kirche. Mit mir nicht mehr!
Einige Tage später werde ich angewiesen, zur Kirche zu gehen. Pastor Müller würde auf mich warten, erklärt mir die Erzieherin. Brav betrete ich den Gottesdienstraum. Auf mich wartend sitzt er in der zweiten Bankreihe. Ich schlurfe zu ihm und lasse mich auf eine Kirchenbank fallen, innerlich zum Absprung bereit.
Pastor Müller betrachtet mich freundlich: „Wie ist es dir ergangen, seit wir uns getroffen haben?“ Ich ziehe gelangweilt meine Schultern hoch. „So, wie immer!“, antworte ich kurz angebunden. „Ich habe gehört, dass du in dieser Woche die Schule nicht ein Mal von innen gesehen hast. Wenn du nicht zur Schule gehst, wirst du keinen Schulabschluss machen können, und ohne Abschlusszeugnis wird es auch nichts mit einer Lehre werden. Willst du das?“
Will er mich jetzt unter Druck setzen? „Würden Sie gerne in die Schule gehen, wenn Sie immer nur verprügelt werden und man Lügen über Sie erzählt?“ Ich richte mich grimmig, zum Angriff bereit, auf und sehe ihn herausfordernd an. Er geht gar nicht weiter darauf ein.
Stille kehrt ein. „Sag einmal, Harald: Glaubst du an Gott?“, unterbricht Pastor Müller die Stille. Das war keine gute Frage. Spontan platzt es aus mir heraus: „Nein, ich glaube nicht an einen Gott. Selbst, wenn es einen Gott geben sollte, sind wir Menschen ihm scheißegal. Der schaut doch nur zu, wie mir Unrecht geschieht. Aber er hilft nicht, dass das Unrecht aufhört!“ Vor meinem inneren Auge laufen Filmszenen ab, was ich alles durchgemacht habe: „Ich kann mit Ihrem Gott nichts anfangen.“
Einen kurzen Moment denke ich an die Schwestern im Kinderheim von Bottrop. Sie haben mir immer wieder von Gott erzählt, dem sie sich ganz hingegeben hatten und dienten. Bei ihnen war es auch ganz anders als hier. Sie waren liebevoll und hatten Verständnis. Bei ihnen wäre so etwas wie hier niemals geschehen. Damals habe ich auch noch an einen liebevollen und helfenden Gott geglaubt, aber jetzt nicht mehr.
Pastor Müller sieht mich mit festem Blick an: „Doch, Harald, Gott gibt es und er sieht alles, was du tust!“ Will der Pfaffe mir jetzt Angst machen? Bin ich für Gott jetzt auch noch der Sündenbock? Resigniert schweige ich. Was soll ich auch dazu sagen?
In den folgenden Wochen lädt Pastor Müller mich immer wieder zum Gespräch ein. Jedes Mal dreht es sich darum, dass mein Verhalten nicht in
Ordnung ist und ich für meine Taten vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Ich antworte nur noch kurz angebunden, meistens nur mit „Ja“ und „Nein“ oder mit Schweigen. Dieser Blödmann hat keine Ahnung, was ich alles erlebt habe! Es kümmert ihn auch nicht wirklich. Hoffentlich lässt er mich bald in Ruhe!
Die weiteren Treffen verlaufen einseitig. Inzwischen antworte ich gar nicht mehr. Der Pastor versucht mal mit Freundlichkeit zu mir durchzudringen, dann wieder mit Strenge. Alles prallt an mir ab. Nach einiger Zeit lädt er mich nicht mehr zu sich in die Kirche ein.
Im Heim lassen sie mich auch in Ruhe. Die Heimleiterin verhängt noch einige Male Hausarrest. Doch das ist nur halb so schlimm: Man kann ja auch aus dem Fenster flüchten. Ich komme gut alleine zurecht. Immer ernsthafter überlege ich, ob es nicht Zeit wird, abzuhauen und mich alleine durchs Leben zu schlagen.
Sie haben mir doch alles genommen! Was soll ich mir noch Mühe geben? Alleine zu leben wäre doch allemal besser, als immer wieder Ungerechtigkeiten erleben zu müssen. Ich fühle mich innerlich zerrissen. Am liebsten würde ich einfach nur schreien. Warum ist das Leben nur so ungerecht?
Sehnsüchtig denke ich an an meine Freunde in Bottrop, an die lieben Schwestern dort und an Tina, mir der ich einen tollen Sommer verbringen durfte, zurück. Tränen laufen mir die Wange herunter. Tina war der einzige Mensch, der mich wirklich verstanden hat. Mit ihr konnte ich lachen und weinen. Sie schaffte es immer, den Schmerz für mich leichter zu machen. Jetzt könnte ich sie so gut gebrauchen! Aber ich muss ganz alleine mit meinem Schmerz fertig werden.
Manchmal nimmt Fräulein Martin mich mit in ihr Zimmer. Sie versucht, mir zu helfen, mit mir im Gespräch zu bleiben und mich zu trösten. Sie ist der einzige Mensch, dem ich noch etwas Vertrauen entgegenbringe, denn mit ihr habe ich nur gute Erfahrungen gesammelt. Sie ist der einzige Lichtblick in einer kalten und ungerechten Welt.