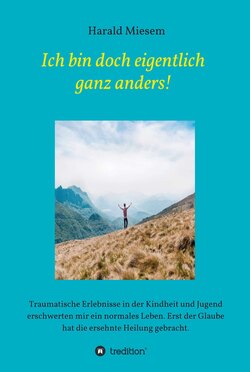Читать книгу Ich bin doch eigentlich ganz anders! - Harald Miesem - Страница 7
ОглавлениеKapitel 1
Verlorene Jahre
Ich liege im Bett. Doch einschlafen kann ich nicht. Immer wieder überlege ich, wie ich dem schlimmen Elternhaus entfliehen kann. Vier erfolglose Versuche habe ich bereits hinter mir. Leider hat der Stiefvater mich immer wieder gefunden.
Kaum bin ich endlich eingeschlafen, da erwache ich schon wieder. Der Stiefvater kommt sturzbetrunken nach Hause. Erschrocken fahre ich hoch. Kommt er wieder zu mir, um mich zu verprügeln? Schnell verkrieche ich mich tief unter meiner Bettdecke. Ängstlich lausche ich den Geräuschen, die vom Flur her ertönen. Ich höre, wie er den Schlüsselbund auf den Flurschrank wirft. Dann stürmt er in das Schlafzimmer, in dem Mama liegt. Er brüllt Mama an, dass sie eine Hure sei. Die Geräusche der Prügel, die auf Mama herunterprasseln, sind noch unter meiner Bettdecke zu hören. Panisch verkrieche ich mich noch tiefer unter der Decke.
Ich hasse ihn! Ich werde ihn umbringen! Aber wie? Ich bin doch ein kleiner Junge 10 Jahren, was kann ich schon gegen einen Erwachsenen ausrichten? Irgendwann falle ich erschöpft in einen unruhigen Schlaf.
Doch die Angst bleibt aktiv. Immer wieder erwache ich und frage mich, ob er erneut zu mir kommen wird. Der Rest der Nacht bleibt ruhig.
Am frühen Morgen verlässt der Stiefvater unsere Wohnung. Er ist Schlosser von Beruf. Während er auf der Hütte seiner Arbeit als Schlosser nachgeht, haben wir einige Stunden Ruhe. Endlich kann ich sicher einschlafen.
Als meine Geschwister lärmend durch die Wohnung rennen, erwache ich. Gemeinsam mit meiner ältesten Schwester – sie ist sieben Jahre alt – helfe ich den Kleinen beim Anziehen. Mama ist wieder einmal nicht zu Hause. Ich weiß nicht, warum.
Einige Zeit nach dem Vorfall torkelt der Stiefvater wieder einmal in die Wohnung, wirft den Hausschlüssel auf den Flurschrank und ruft mich zu sich: „Komm mit!“ Ich folge ihm ins Schlafzimmer, ahnend, was jetzt geschieht. Am liebsten würde ich weglaufen oder mich in ein Schneckenhaus verkriechen. Doch der Gedanke an meine Geschwister hilft mir, das auszuhalten, was jetzt folgt. Dieser große, starke und sehr schwere Stiefvater wirft mich auf das Ehebett und wirft sich auf mich. Ich habe Angst zu sterben, denn ich bekomme kaum noch Luft. Irgendwie schaffe ich es, mich frei zu strampeln. Doch unverzüglich liegt er wieder auf mir. Ich versuche mich zu wehren, kämpfe um mein Leben. Dann verliere ich das Bewusstsein.
Als ich wieder zu mir komme, ist der Stiefvater weg. Mein ganzer Körper schmerzt. In der Wohnung ist es seltsam ruhig. Ich brauche einige Minuten, um mich wieder zu sammeln, dann schaue ich nach den Geschwistern. Sie liegen in ihren Betten und schlafen. Ich krieche in mein Bett, finde jedoch keinen Schlaf.
Wir Kinder werden immer häufiger uns selbst überlassen. Der Stiefvater lässt sich nur ab und zu blicken. Mama taucht nicht mehr auf. Als der Stiefvater wieder einmal zu Hause ist, frage ich zaghaft, wo Mama ist. Zur Antwort erhalte ich eine Ohrfeige.
Der Schwur
„Bastard, komm zu mir!“, brüllt es aus dem Schlafzimmer. Ich zögere. Wutentbrannt stürmt der Stiefvater um die Ecke und verprügelt mich. Dieses Mal ist es besonders schlimm. Immer und immer wieder schlägt er zu. Er trifft mich am Mund. Zwei meiner oberen Schneidezähne brechen ab. Ich schreie entsetzlich. Gleichzeitig überkommt mich eine große Wut. Ich will mich irgendwie wehren, aber wie? Ganz unvermittelt kommt mir eine Idee: Ich werde jetzt keinen Ton mehr von mir geben, und wenn er mich totschlägt! Während er auf mir herumtrommelt, bleibe ich still. Kein Laut kommt mehr aus mir heraus. Verwundert unterbricht der Stiefvater seine Prügelattacke. „Du willst wohl den Helden spielen?“, knurrt er mich an. „Warte ab, das treibe ich dir aus!“ Erneut prasseln Schläge auf mich ein. Ich bin still. Während der Stiefvater fluchend und schimpfend auf mich einschlägt, spüre ich plötzlich gar nichts mehr. Es ist, als ob ich meinen Körper verlassen habe. Aus sicherer Distanz sehe ich dem Schauspiel zu. Der Körper steckt einen Schlag nach dem anderen ein. Schmerzen habe ich in diesem Zustand nicht mehr. Dann wird es auf einmal dunkel. Ab diesem Moment habe ich einen Filmriss.
Eines Tages füttere ich ein Baby. Wie es zu uns gekommen ist und was alles in der Zwischenzeit geschehen ist, weiß ich bis heute nicht. Meine Geschwister und ich sind alleine. Seltsamerweise weiß ich, wie ich das Baby füttern muss und wie man die Windeln wechselt. Die Eltern tauchen nicht auf. Sie haben uns scheinbar allein gelassen.
Fremde Menschen
Trübsinnig grübelnd sitze ich am Wohnzimmerfenster und starre nach draußen. Tausend Gedanken gehen mir durch den Kopf. Ich suche nach einer Lösung, was wir essen könnten. Ich habe bereits jeden Winkel in der Wohnung abgesucht. Es ist zum Verzweifeln! Das Baby ist kaum noch zu beruhigen. Es hat offensichtlich Hunger. Wir haben keine Milch mehr.
Auch jetzt liegt es jammernd im Bettchen. Ich kann ihm nicht helfen. Ich hole es aus seinem Bettchen und setze mich mit ihm vor das Wohnzimmerfenster. Meine Nähe beruhigt es. Ich lege es zurück und setze mich wieder an das Fenster. Während ich stumpfsinnig aus dem Fenster starre, höre ich ein lautes Knurren: Es ist mein Magen.
Am nächsten Morgen versorge ich wieder die Geschwister. Sie weinen und klagen immer wieder. Wir alle haben Hunger. Mir bricht es das Herz. Wie gerne würde ich ihnen etwas zu essen geben! Gedankenverloren setze ich mich wieder an das Fenster und sehe nach draußen.
Laute Geräusche holen mich aus der Lethargie heraus. Auf einmal gibt es einen fürchterlichen Knall. Ich zucke erschrocken zusammen. Krachend fliegt die Wohnungstür auf, und fremde Menschen stürmen herein. Erschrocken vor Panik versuche ich, meine Geschwister zu schützen. Aber ich bin zu klein und habe keine Chance gegen diese Menschen. Sie packen mich und meine Geschwister und verfrachten uns in einen Kleinbus. Unsicher und verängstigt frage ich, was sie mit uns vorhaben. „Ihr kommt in ein Kinderheim!“, ist die schroffe Antwort eines Mannes. Als wir losfahren, stelle ich entsetzt fest, dass das Baby nicht da ist! „Wo ist das Baby?“, schluchze ich auf. Der Bus setzt sich in Bewegung. Einer der Männer schnauzt mich an: „Das musst du nicht wissen!“ Entsetzt und verschreckt sitzen wir auf der Rückbank eines fremden Busses und fahren ins Ungewisse. Der Mann zückt einen Block aus der Tasche und schreibt laut nachdenkend in den Block: „Heute haben wir“, er hält kurz inne, „den 20. Juli 1962.“ Dann steckt er den Block wieder in die Tasche.
Im Verlauf der Fahrt erfahren wir, dass die Menschen, die uns aus der Wohnung geholt haben, vom Jugendamt sind. Ich verstehe das nicht. Was ist ein Jugendamt? Man erklärt uns, dass sie darüber benachrichtigt worden seien, dass wir Kinder alleine in der Wohnung sind und das Baby ständig schreit. „Wir bringen euch nach Bottrop“, erklärt der Begleiter unwirsch. Plötzlich laufen mir die Tränen, und ich weine bitterlich. „Hör endlich auf, du Balg!“, schnauzt mich einer der Männer an. „Sei froh, dass wir euch aus dem Schlamassel herausgeholt haben! Im Kinderheim wird es euch sicher besser gehen.“ Tapfer versuche ich, meine Tränen zurückzuhalten und still zu sein.
Im Kinderheim
Nach einer Weile hält der Bus vor einem großen Haus. Eine Frau in Schwesterntracht nimmt uns in Empfang. Ich fühle mich unwohl: Was werden die mit uns machen? Sie betrachtet uns lange, dann spricht sie kurz mit den Leuten, die uns hergebracht haben. Die steigen schließlich in den Bus zurück und fahren wieder weg. Die Schwester wendet sich zu uns: „Kinder, ihr seht so aus, als könntet ihr etwas zu essen vertragen. Kommt mit!“ Schon schiebt sie uns in Richtung des Hauses.
Wir gehen in einen großen Raum, in dem viele Tische und Stühle stehen. „Nehmt schon mal Platz! Ich schaue mal in der Küche nach, was ich für euch besorgen kann.“ Die Frau wirkt sehr nett, aber ich traue dem Braten nicht. Nach kurzer Zeit kommt sie mit einem Tablett voller Butterbrote wieder. Lächelnd fordert sie uns auf, zuzugreifen und uns satt zu essen. Da schmilzt das Eis in mir. Gierig stürze ich mich auf die Brote. Meine Geschwister tun es ebenso. Ausgehungert, wie wir sind, ist der Teller in Windeseile geleert. Die Schwester beobachtet uns beim Verschlingen der Brote: „Ihr armen Kinder! Ihr habt scheinbar lange nichts mehr gegessen! Was habt ihr bloß mitgemacht?“
Endlich wieder etwas zu essen löst ein wahres Glücksgefühl in mir aus. Mein Bauch fühlt sich warm und wohlig an. Ich glaube, hier bin ich sicher und hier werde ich nie wieder Hunger leiden. Die Schwester ist sehr nett und wartet freundlich lächelnd, bis wir den Teller geleert haben.
Als Nächstes bringt sie uns zu einer Kleiderkammer. Nun kommt Leben in uns: Wir stürzen uns auf die Kleidung, sind kaum dabei zu bremsen. Die Wäsche an unserem Körper ist seit vielen Tagen nicht gewaschen worden. Endlich saubere Sachen! Überglücklich sucht sich jeder etwas Neues aus. Mit der Kleiderbeute auf dem Arm bringt uns die Schwester in den Speisesaal zurück: „So, Kinder, nun zeige ich euch, wo ihr künftig leben werdet.“
Sie geht mit uns nach draußen. Wir laufen über einen Weg zu einem anderen Haus. Dort werden wir von einer Frau empfangen, die scheinbar schon auf uns gewartet hat. Uns wird erklärt, dass wir in verschiedenen Häusern untergebracht werden. Meine Schwestern werden der Frau übergeben.
Am nächsten Haus wird mein Bruder einer Frau übergeben. „Ich will aber bei meinem Bruder bleiben!“, bettle ich, als wir weitergehen. Die Schwester legt mir die Hand auf die Schulter: „Das geht leider nicht. Du bist deutlich älter als dein kleiner Bruder. Wir können die Gruppen nicht einfach verändern. Ihr könnt euch ja jeden Tag besuchen!“, ermutigt sie mich. Schweren Herzens ergebe ich mich in die neue Situation.
Als Letzter werde ich zu meiner neuen Gruppe gebracht. Fröhlich begrüßt mich ein Fräulein Martin: „Ich freue mich, dass du zu uns kommst! Dieses Kinderheim ist etwas Besonderes. Es wird dir bestimmt gefallen!“ Ich senke meinen Kopf. „Schlechter als zu Hause kann es nicht sein!“, murmele ich vor mich hin. „Was hast du gesagt?“ Ich schaue noch tiefer zu Boden. „Ach, nichts!“, erröte ich.
Fräulein Martin führt mich zu meinem neuen Zimmer. Brav trotte ich hinterher. Sie zeigt mir den Schrank und fordert mich auf, die Wäsche, die immer noch über meinem Arm hängt, einzuräumen. Dann mustert sie mich: „Ich denke, wir gehen dich erst einmal baden. Nimm dir frische Wäsche mit, die du danach anziehen möchtest.“ Brav trotte ich hinter ihr her zum Badezimmer. Fräulein Martin lässt Wasser in die Wanne laufen. „Ab mit dir in die Wanne!“, lacht sie. Hoffentlich geht sie gleich wieder! Im Zeitlupentempo beginne ich mich auszuziehen. Fräulein Martin macht keinerlei Anstalten, das Bad zu verlassen. Ich schäme mich, mich vor einer fremden Frau auszuziehen. Aber darauf nimmt sie keine Rücksicht. Auf einmal ruft sie erschrocken aus: „Was ist denn mit dir passiert? Du bist ja voller blauer Flecken!“ Noch mehr beschämt klettere ich splitternackt über den Wannenrand und setze mich ins Wasser.
Ohne eine Antwort abzuwarten schnappt sich Fräulein Martin einen Waschlappen, seift ihn ein und wäscht mich von oben bis unten. Frisch gewaschen und mit der neuen sauberen Kleidung am Körper verlasse ich kurze Zeit später das Bad. Ich fühle mich wie neugeboren.
Fräulein Martin schaut auf ihre Uhr: „Bis zum Essen hast du genug Zeit, dich im Heim umzusehen. Du kannst gerne auf Erkundungstour gehen.“ Mit dieser Botschaft lässt sie mich stehen und geht ihrer Arbeit nach.
Unsicher laufe ich los. Alles wirkt so sauber. Die Schwestern und Erzieherinnen, denen ich begegne, sind sehr freundlich. Immer wieder sprechen sie mich an: „Hallo, du musst der Harald sein!“ Verwundert frage ich mich, woher sie denn meinen Namen kennen.
„Harald, komm, es ist Zeit zum Mittagessen!“, werde ich gerufen. Erwartungsvoll laufe ich mit vielen anderen Kindern zum Speisesaal. Vor dem Essen müssen wir alle still sein. Die Erzieherin betet mit uns. Sie dankt Gott für das Essen und die Gemeinschaft. Während sie betet, erinnere ich mich daran, dass wir zu Hause auch manchmal gebetet haben. Für mich war das ganz komisch, denn was muss das für ein schlimmer Gott sein, der dabei zuschaut, wie kleine Kinder geschlagen werden, hungern und fast sterben? Und er hat nicht eingegriffen, als die Kleinste von uns weggebracht wurde. Was ist mit ihr passiert? Was haben sie mit ihr gemacht? Und was ist das für ein Gott, der nicht hilft?
Widerwillig lausche ich der Erzieherin, die diesem Gott dankt. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Götter. Tief in meinen Gedanken versunken bemerke ich nicht, dass ich von der Erzieherin angesprochen werde. Erst das laute Lachen der anderen Kinder holt mich aus meinen Gedanken. Ich muss irgendetwas verpasst haben. „Na, Harald, in welchem Traum warst du denn gerade?“ Beschämt schaue ich nach unten und kann nicht antworten. Das Essen bringt mich schließlich auf andere Gedanken.
Am Nachmittag schaue ich mich weiter um. Es gefällt mir hier sehr gut. Besonders die Weide hinter dem Haus, auf der friedlich grasende Pferde stehen, begeistert mich. Fasziniert sehe ich den Tieren zu. „Kann man auf den Pferden auch reiten?“, frage ich andere Kinder, die gerade vorbeikommen. Begeistert erzählen sie mir, dass die Pferde vor die Kutsche gespannt werden und alle Kinder in der Kutsche manchmal auch durch die Felder fahren dürfen. Oh, wie schön, das wird bestimmt wunderschön sein! Ich freue mich schon auf die erste Fahrt mit der Kutsche. Das muss doch ein Abenteuer sein!
Am Abend liege ich in meinem Bett. Es gefällt mir hier. Ich brauche keine Angst zu haben, dass der Stiefvater wiederkommt. Hier bin ich wirklich sicher. Ich freue mich schon auf den nächsten Tag und die Abenteuer, die ich hier erleben werde. Ich möchte einschlafen, doch mir schießen viel zu viele Gedanken durch den Kopf. Ich sehe mich und meine Geschwister wieder alleine zu Hause. Wir waren so einsam und hilflos. Und so schrecklich hungrig. Ich erlebe nochmals die Situation, wie die Menschen uns in den Bus setzen. Nun bin ich hier. Es ging alles so schnell. Irgendwann schlafe ich endlich ein.
Doch mich plagen schlimme Träume. Immer wieder werde ich von dunklen Gestalten gejagt und kann ihnen einfach nicht entkommen. Morgens beim Erwachen stelle ich entsetzt fest, dass mein Bett nass ist. Voller Scham überlege ich, was ich jetzt machen soll. Schnell ziehe ich die nasse Bettwäsche ab und laufe zum Bad, um sie dort auszuwaschen. Leider ertappt mich eine Erzieherin dabei. „So geht das aber nicht!“, mault sie mich an. „Hier wird nicht ins Bett gemacht! Heute lasse ich das noch mal durchgehen. Doch wenn das nochmal vorkommt, bekommst du den Kleiderbügel zu spüren!“ Zwei Tage später ist es wieder passiert. Ich werde angebrüllt und beziehe die angekündigte Strafe. Die Erzieherin begreift überhaupt nicht, dass es mir doch selbst peinlich ist. Ich bin doch ein großer Junge, dem das noch nie passiert ist! Zum Glück bessert es sich nach einigen Wochen.
Nach und nach gewöhne ich mich an den Alltag im Kinderheim. Die Schwestern sind sehr liebevoll und unternehmen viel mit uns Kindern. Es ist das erste Mal nach vielen Jahren, dass ich mich wohlfühle und neugierig die kleine Welt im Kinderheim erkunde.
Der Ausflug
Heute steht Schwester Julia freudestrahlend vor uns Kindern. Alle, die Lust haben, eine Wanderung zu unternehmen, sollen ihre Hand heben. Kein Finger bleibt unten. Wir alle wollen mit. Jeder bekommt ein Lunchpaket, und dann geht es los. Wir wandern Richtung Dorsten. Ein langer Bandwurm von Kindern zieht sich durch den Wald. Alle müssen in der Reihe laufen, was auf Dauer keinen Spaß macht. Die ersten abenteuerlustigen Kinder, und auch ich, versuchen, sich in den Wald zu schlagen. Schnell werden wir alle wieder eingereiht und nochmals ermahnt, hintereinander herzugehen.
Wie so oft hänge ich meinen Gedanken nach. Trödelnd und unaufmerksam folge ich der Schar. Erst der Schmerz an meinen Füßen holt mich aus der Grübelei heraus. Zum Glück machen wir jetzt eine Pause. Ich kann meine Füße entlasten. Oh je, was tun die weh! Auf den herumliegenden Baumstämmen reihen sich die kleinen und großen Wanderer, holen die Lunchpakete hervor, und jeder beißt heißhungrig ins Brot. Der Rückweg unserer Wanderung ist begleitet von einem vielstimmigen Gestöhne. Ich bin nicht der Einzige, der unter schmerzenden Füßen leidet!
Zurück im Heim falle ich glücklich und zufrieden ins Bett und schlafe sofort ein. Der schlimme Traum reißt mich diesmal nicht aus dem Schlaf, sondern die vertraute Stimme von Fräulein Martin: „Abendbrot, Kinder!“, erschallt es vom Flur her. Mit beiden Beinen gleichzeitig springen wohl alle Kinder aus ihren Betten und rennen johlend in den Speisesaal. Ich liebe das Leben in meinem neuen Zuhause!
Wo sind meine Schwestern?
Einige Zeit nach unserer Ankunft im Kinderheim werde ich zur Oberin, der Leiterin des Heimes, gebracht. Sie teilt mir mit, dass meine beiden Schwestern in ein anderes Kinderheim gebracht wurden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Leben ist so ungerecht! Warum raubt man mir meine Geschwister? Ich fühle mich plötzlich so allein gelassen. Mir ist das alles zu viel, was da auf mich einströmt. Ich verlasse das Zimmer der Oberin und renne in den nahen Wald. Betrübt und traurig setze ich mich an meinen Lieblingsplatz, den ich mir vor einigen Wochen ausgesucht habe. Hier, wo mich niemand sieht, lasse ich meinen Tränen freien Lauf. Was ist das doch für eine ungerechte Welt, in der ich lebe! Es ist das erste Mal, dass ich mir ernsthafte Gedanken mache, meinem Leben ein Ende zu setzen, um endlich Ruhe zu haben.
Über meinem Grübeln muss ich wohl eingeschlafen sein, denn es wird schon dunkel, als ich erwache. Schnell mache ich mich auf den Weg zurück ins Heim, um noch rechtzeitig zum Abendbrot zurück zu sein. Mit bangem Herzen und der Erwartung, dass ich wieder mal richtig Ärger bekommen werde, schleiche ich zu meiner Gruppe zurück. Ich soll mich nicht getäuscht haben: „Für dich gibt es heute kein Abendbrot!“, schimpft die Erzieherin. Zu meiner Erleichterung werde ich hier nicht zusammengeschlagen. Die Strafe ist, in der Ecke zu stehen und zusehen zu müssen, wie alle anderen Kinder sich den Bauch vollschlagen. Aber das ist für mich immer noch besser auszuhalten als geschlagen zu werden. „Das wird dir eine Lehre sein!“, schnauzt die Erzieherin mich an. Eine Schwester, die zufällig die Szene mitbekommt, unterbricht sie. Die beiden verschwinden im Nebenzimmer und kommen kurz danach wieder heraus: „Harald, du darfst doch am Abendbrot teilnehmen. Aber noch mal lasse ich das nicht durchgehen!“
Wo ist mein Bruder?
Ein Tag nach dem anderen vergeht. Das Heim ist mein Zuhause geworden. Hier erlebe ich eine Freiheit, die ich vorher nicht kannte. Eine Freiheit ist für mich das Rollschuhfahren. Es wird meine Lieblingsbeschäftigung. Stundenlang bin ich oft unterwegs. Beim Rollschuhfahren komme ich innerlich zur Ruhe und kann meinen zahlreichen Gedanken nachhängen, ohne gestört zu werden.
Die Schwestern haben nichts dagegen, dass ich so lange Ausflüge mache, denn ich komme immer pünktlich zum Essen zurück, das wissen sie.
Auch heute kehre ich wieder einmal gedankenverloren von meinem Ausflug zurück. Da ich noch genügend Zeit bis zum Essen habe, beschließe ich, noch schnell meinen Bruder in seiner Gruppe zu besuchen. Doch ich finde ihn nicht! Erschreckt laufe ich zu den Schwestern und Erzieherinnen. Niemand weiß, wo er steckt. Aufgeregt tänzle ich vor einer Erzieherin von einem Fuß auf den anderen. Tränen füllen meine Augen: Was ist mit meinem Bruder passiert? Die Erzieherin schickt mich zur Oberin. Misstrauisch sehe ich sie an: Das kommt mir komisch vor! Wieso soll ich die Oberin fragen? Da ich nichts weiter erfahre, mache ich mich weinend auf die Suche nach ihr. Die Oberin läuft mir vor ihrem Büro über den Weg. Als sie mich sieht, wird ihr Gesicht ernster: „Harald, du suchst bestimmt deinen Bruder.“ Eine unheimliche Ahnung steigt in mir hoch: Sie hat sicherlich keine guten Nachrichten für mich. Die Oberin sieht mich mit traurigem Blick an: „Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Dein Bruder ist gestern in ein anderes Kinderheim verlegt worden. Wir haben alles versucht, um diesen Wechsel zu verhindern. Doch das Jugendamt in Duisburg hat anders entschieden.“ Wie vom Donner gerührt stehe ich vor der Oberin. Die Tränen versiegen augenblicklich. Ich sehe sie an, dann bricht eine unbändige Wut aus mir heraus. Ich renne aus dem Haus nach draußen, schnalle mir meine Rollschuhe wieder an und rase davon. Niemand kann mich aufhalten.
Nachdem ich eine große Runde gefahren bin, suche ich meinen Lieblingsplatz im Wald auf. Die Traurigkeit über mein Schicksal und die Ungerechtigkeiten von Erwachsenen übermannt mich. Ich weine bitterlich, einsam und alleine im Wald sitzend. Ich fühle mich so schrecklich verlassen! Nun ist niemand mehr von meiner Familie bei mir. Ich bin ganz alleine. Ich will nicht mehr leben!
Viele Stunden später erreicht mich eine Stimme, die meinen Namen ruft. Erschrocken schaue ich auf: Eine Erzieherin steht vor mir. Ich habe sie gar nicht kommen hören. Sie ist sensibel genug, mir keine Vorwürfe zu machen. Es ist bereits später Abend, und ich habe es nicht bemerkt. Schuldbewusst gehe ich mit ihr zum Haus zurück. Sie bringt mich in die Küche, schmiert einige Brote für mich, kocht mir einen Tee und setzt sich mit mir gemeinsam an den Tisch. Ich stecke wie in einem Nebel fest. Die Brote verschwinden in mir, aber eigentlich will ich gar nichts essen. Alles erscheint mir so unwirklich. Ich breche immer wieder in Tränen aus. In den nächsten Nächten mache ich wieder ins Bett und habe schlimme Träume.