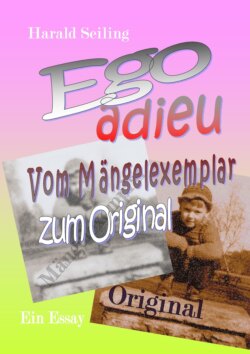Читать книгу Ego adieu - Harald Seiling - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Artikel IV.Fremd-Programmierung, das Gegenteil von Eigenidentität
Оглавление„Leben, das ist das Allerseltenste in der Welt – die meisten Menschen existieren nur.“
Oscar Wilde
Wenn ich bei sommerlichen Temperaturen ganz entspannt bei einem Cappuccino in einem Café der Lüner Fußgängerzone meine vorbeiziehenden Zeitgenossen betrachte, sehe ich zunächst menschliche Buntheit und Vielfalt. Junge, Alte, Farbige, Paare, Muslim*innen mit Kopftuch, Menschen im Rollstuhl oder an Gehilfen, Eltern mit Kindern, etc. Einige schreiten gemächlich, während andere es eilig haben, ja fast schon hetzen. Viele telefonieren oder starren wie hypnotisiert auf das Display ihres Smartphones. Bei ihnen grenzt es fast schon an ein Wunder, dass sie beim Gehen keinen Schaden nehmen bzw. anrichten. Gern würde ich ihnen zurufen: „He, ihr Smartphone-Junkies wacht auf und blickt euch um! Hier findet das Leben statt, und zwar analog! Schmeißt endlich eure Gehirntoaster weg, oder schaltet sie wenigstens aus. Nehmt stattdessen eure Umgebung wahr! Wendet euch euren neben euch laufenden Kindern oder Partnern zu!“ (Im Kapitel Leid, das Kindern zugefügt wird erfahren Sie, wie sich das ständige (suchtartige) Beschäftigen der Eltern mit dem Handy fatal auf ihre Kinder auswirkt.)
Nun ja, die meisten der Vorübergehenden sind in Gedanken, angetrieben von der Agenda in ihrem Kopf. Sie verrichten ihr sogenanntes Tagwerk. Wie gesagt, kaum bis gar nicht nehmen sie die anderen um sich herum wahr. Kurz fesseln Auslagen eines Geschäftes ihre Aufmerksamkeit, um zum nächsten Sonderangebot weiterzueilen. Wie viele von diesen Menschen, glauben Sie, sind sich des gegenwärtigen Augenblicks bewusst? Nehmen wahr, was in ihrem Innern vor sich geht, sind achtsam, ob Freude, Angst, gar Traurigkeit sie erfüllen?
Die US-amerikanische Zeitung Washington Post hatte 2007 ein Experiment in Auftrag gegeben, um zu erfahren, ob Menschen in ihrem routinierten Tagesablauf achtsam sind und innehalten für einen besonderen Augenblick, ob sie Schönheit in ihrem ganz alltäglichen Umfeld wahrnehmen, ob sie eine Situation in einem unerwarteten Kontext - jenseits der üblichen Lockangebote - erkennen:
In einem U-Bahn Tunnel in Washington DC steht an einem kalten Januarmorgen ein Mann und spielt auf seinem Instrument Johann Sebastian Bachs Chaconne in d-moll, eins der am schwierigsten zu spielenden Musikstücke für Solovioline. Hunderte Menschen hasten auf dem Weg zur Arbeit vorbei. Erst nach einigen Minuten verlangsamt ein Passant für einige Sekunden seinen Schritt, bleibt aber nicht stehen. Dann vermindert eine Frau ihr Tempo, auch sie verharrt nicht, wirft aber den ersten Dollar in den Hut des Musikanten. Ein junger Mann hält kurz inne, um zu lauschen, ein Blick auf seine Uhr jedoch lässt ihn weitereilen. Dann nähert sich eine Mutter mit ihrem etwa dreijährigen Sohn. Er blickt interessiert den Musiker an, möchte stehen bleiben, aber an Mutters Hand wird er weitergezogen. Der Kleine schaut im Gehen zurück, aber die Mutter zerrt ihn weiter. Wie diesem Knaben ergeht es noch einigen Kindern, die zuhören wollen, aber ihre Eltern drängen ausnahmslos zur Eile. Lediglich sechs Passanten blieben kurze Zeit stehen und hörten dem unermüdlichen Geiger zu. Und nicht viel mehr als 20 Vorübereilende hatten ihm Geldstücke in den Hut geworfen, als sein Musikvortrag nach knappen 45 Minuten beendet war. Keiner spendete Beifall. Die Menschen hasteten unbeirrt weiter. Der Musiker Joshua Bell, einer der weltweit größten Geigen-Virtuosen, packte seine wertvolle 3,5 Millionen-Dollar-Geige ein und zählte den Inhalt seines Hutes: 32 Dollar hatte sein Konzert eingespielt. (Zwei Tage vorher hatte er in Boston vor ausverkauftem Haus das gleiche Programm gespielt. Allerdings kosteten die Eintrittskarten im Schnitt 100 Dollar.)
Und ― wären Sie stehen geblieben, hätten Sie sich von der Musik berühren oder gar verzaubern lassen?
Aber vielleicht haben Sie ja Lust auf ein anderes Experiment: Lehnen Sie sich entspannt mit einem ausreichend großen Spiegel auf Ihrem Schoß, bequem in Ihren Lieblingssessel zurück, und zwar so, dass Sie Ihr Gesicht klar und deutlich betrachten können. Wichtig: Lassen sie sich Zeit bei Ihrer Betrachtung, erforschen Sie ausgiebig Ihre Gesichtszüge. (Schon die Vorstellung kommt Ihnen sonderbar vor, macht Sie gar verlegen? Macht nichts! Tun Sie’s einfach... sieht Sie doch keiner.) ― Nun, Sie haben sich getraut, sitzen also vor Ihrem Spiegel und schauen sich an… zugewandt oder eher kritisch distanziert? Auf jeden Fall sind Sie das da im Spiegel. Ja, und so sehen Sie aus! (Zugegeben, ist schon etwas ungewöhnlich, diese konzentrierte Selbstbetrachtung, so intim und ganz anders als der morgendliche Blick beim Schminken, Rasieren oder Zähneputzen.) Gefallen Sie sich, sind Sie mit dem, was Sie sehen zufrieden?
Versuchen Sie nun zu Ihrem virtuellen Gegenüber Kontakt aufzunehmen, wie zu einem lieben Bekannten, zugewandt und interessiert: „Hallo, du, schön dich zu sehen! Du gefällst mir…(vielleicht aber auch nicht?!)“ Und dann stellen Sie sich beispielsweise die folgenden Fragen:
„Wer bin ich eigentlich, bin ich die/der, die/der ich sein will bzw. die/der, die/der ich sein könnte? Lebe ich mein Leben oder werde ich vielmehr gelebt? Funktioniere ich nur? Folge ich nur einem Programm, das Erziehung durch Eltern, Schule, Gesellschaft, Medien etc. in mir geschrieben hat? Was ist eigentlich mein Ureigenes? Was will ich und was will ich nicht, tue es aber trotzdem, weil sogenannte Sachzwänge oder Konventionen mich dazu nötigen? Spüre ich – ganz tief: irgendetwas fehlt, irgendetwas ist nicht echt?! …“
Zugegeben, keine ganz leichte Aufgabe, die zudem ein bisschen Mut, aber unbedingt Ernst- und Wahrhaftigkeit verlangt. Lassen Sie sich von den Antworten überraschen, die Sie sich geben, und achten Sie besonders auf die aufsteigenden Emotionen bzw. Gefühle!
Bei den meisten von uns läuft statt ihres ureigenen Lebens nur ein uralt gespeichertes Programm ab, einst geschrieben von den Eltern, Erziehern, den Spezies der sogenannten schwarzen Pädagogen etc. Wir könnten es euphemistisch Programm der Anpassung, unverblümt bzw. schlimmstenfalls aber das der misshandelten, weil dressierten, gebrochenen Persönlichkeit nennen. Es äußert sich beispielsweise in Pflichterfüllung: „ich muss unbedingt noch…“, „eigentlich habe ich keine Lust dazu, aber es hilft ja nichts…“; „was werden die Nachbarn dazu sagen/von mir denken…“ moralischen Geboten: „aber, das kann man doch nicht machen…“; anerzogenem höflichen Verhalten: „Dürfte ich bitte einmal…, „ach, wären Sie bitte so freundlich…“. (Nichts gegen höfliches Verhalten. Es ist ja per se nichts Schlechtes, allerdings nur als selbstgewählte Umgangsform!)
Dieses Programm wird morgens beim Aufwachen gestartet und endet erst beim abendlichen Zubettgehen. Jeden Tag aufs Neue! Und wenn ausnahmsweise dem Programm zuwidergehandelt wird, gibt’s sofort die Quittung in Form eines schlechten Gewissens. Das Urteil lautet: schuldig! Hier zeigt sich neuerlich die nachhaltige Wirkung der elterlichen Waffe gegen unser kindliches Bestreben nach Autonomie.
Schuldgefühle erlebten wir stets nach demütigenden Strafmaßnahmen, wenn wir den Forderungen der Eltern nach richtigem Verhalten nicht entsprachen. Diese Schuldgefühle dienten einstmals der Deckelung unserer Wut auf die Eltern, die unsere autonomen Bestrebungen verboten. (Ohne die Erfüllung des kindlichen Grundbedürfnisses nach Selbstbestimmtheit jedoch kann sich oft eine elementare Verlustangst entwickeln. Immer dann, wenn die Eltern auf das Autonomiebedürfnis des Kindes mit Ablehnung reagieren oder gar mit Verlust von Bindung drohen, kann dies zur Vermeidung des Wunsches nach Eigenbestimmtheit führen. Es lernt, sich zunächst in den Dienst der Eltern, später in den der anderen zu stellen und verliert auf diese Weise den Bezug zum eigenen seelischen Bedürfnis nach Autonomie.) Die durch die Einschränkung entstehenden Wutgefühle müssen wir verdrängen und fühlen uns stattdessen schuldig, weil wir nicht richtig sind, so wie wir sind. Es scheint paradox, aber es ist so: Wir fühlen uns schuldig, obwohl wir gezwungen wurden unser Ureigenstes zu verleugnen! Diese Schuldgefühle, wie diffus sie auch immer sein mögen, werden fortan unser*e Lebensbegleiter*in neben tiefer Verunsicherung und dunkler Leere sein.
Dieses Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche beziehungsweise Lob und Tadel konditioniert ein falsches Selbst, das sogenannte Ego, das wir fatalerweise für unsere wahre Identität halten. Welch ein gewaltiger und dazu noch folgenschwerer Irrtum! Jedes Ego ist individuell mehr oder weniger ausgeprägt, um nicht zu sagen aufgeblasen. Da es aber nicht aus sich selbst heraus existieren kann ist es stets angewiesen auf die Meinung und Anerkennung anderer. So muss es stets von außen „gefüttert“ werden. Obwohl es immer dicker wird, bekommt es nie genug!
Aber zurück zu uns Fremdprogrammierten: Wir funktionieren, auch wenn uns ab und an mal der Kragen platzt (Die fliegenden Brocken bekommen zumeist Schwächere ab, und das sind an erster Stelle die eigenen Kinder. In der Firma sind es Kolleg*innen bzw. Untergebene.). Dieser beklagenswerte Zustand des Funktionierens ist das Ergebnis eines gelebten falschen Selbst (Ego), das Resultat der ins Unbewusste verdrängten Gefühle von Wut und Schmerz, die Liebesentzug und Nichtanerkennung der kindlichen Identität mit sich bringen. Dieses Unbewusste lässt die einen von uns zu Ja-sagern*innen, zu angepassten Untertanengeistern oder dem Gegenteil, zu Rebellen*innen werden, während andere nach Überlegenheit, Macht und Größe streben. Alle gemeinsam kennzeichnet, dass ihr unbewusstes inneres Leben ein brodelnder Kessel voller Wut oder anderer verdrängter Gefühle ist.
Auf diese Weise bleibt unser wahres Selbst auf der individuellen Landkarte ein weißer Fleck, unentdecktes Terrain, ohne Stimme, aber nicht stumm. Und da es nach wie vor zum Leben strebt, äußert es sich nonverbal, durch beispielsweise absurdes Verhalten, Phobien, Ängstlichkeit, Selbstverstümmelungen, Süchte, Depressionen, Krankheiten und/oder Verbrechen. Beispielsweise
wird in der psychosomatischen Störung über körperliche Symptome – der physische Schmerz vertreibt den psychischen - der Schmerz der einstigen traumatischen Erfahrung wieder erlebt, wobei jedoch die Ursache, das Trauma, verborgen bleibt;
werden in der Neurose die eigentlichen lebendigen Bedürfnisse verdrängt und verleugnet bzw. falsch gelernte Strategien und Muster ständig wiederholt (Wiederholungszwang);
wird in der Psychose eine Misshandlung durch eine Wahnvorstellung in Szene gesetzt;
wird im Verbrechen die Misshandlung immer wieder neu ausagiert, als das Ventil für erlittene Qualen (lesen Sie hierzu: Amokläufe sind Akte tiefster Verzweiflung).
Die Mehrheit der Betroffenen wird die Symptome zunächst ignorieren oder versuchen, ihnen vielleicht mit dämpfenden Psychopharmaka (im Amerikanischen treffend als Painkillers bezeichnet) und/oder medizinischen Maßnahmen beizukommen. Und natürlich weiß die Pharmaindustrie Rat. Sie agiert geschickt, um ihre Botschaft unters Volk zu bringen:
"Sorgen Sie sich nicht, wenn Sie mal nicht schlafen können, gelegentlich deprimiert sind, vor Aufregung in Panik geraten oder gar Suizidgedanken hegen. Es sind lediglich Ihre Gene oder Ihre Hormone, die ein bisschen verrückt spielen. Unsere Medikamente werden Ihnen helfen, dass alles wieder ins Lot kommt."
Orthodoxe Schulmediziner*innen teilen diese zwar unheilige, aber absatzfördernde Heilsbotschaft der Pharma-industrie. Hand in Hand reden sie den Betroffenen ein: Alle Beschwerden seien lediglich auf Neurotransmitter und Gehirnmechanik zurückzuführen. Auf keinen Fall sollen sie sich damit auseinandersetzen, dass all die alltäglichen Probleme in Beziehungen, die Verstrickungen zwischen Kindern und Eltern, das von Angst dominierte Kräftemessen mit Autoritäten und Hierarchien ihre Ursachen in der frühen Kindheit haben und sogar über Generationen weitergegeben werden können.
Nun ja, vielleicht helfen ja die ergriffenen Maßnahmen gegen die Symptome sogar und es tritt vorübergehend Besserung ein oder die Symptome verschwinden ganz. Aber da Symptombekämpfung nur an der Oberfläche kratzt, werden sie wiederkehren, verstärkt oder verändert oder in gänzlich neuer Form. Dabei sind sie Signale unserer Seele, die sich äußert, aber keine andere Möglichkeit hat, als sich über den Körper mitzuteilen. Darin liegt jedoch die Schwierigkeit: Die Signale müssen zunächst entschlüsselt werden. Diese Arbeit der Decodierung ist aber zumeist mühevoll, mehr oder weniger langwierig und häufig mit (psychischen) Schmerzen verbunden. Und besonders dieser unbewusst gefürchtete Schmerz lässt Menschen zwecks Schmerzvermeidung zu den leicht verfügbaren Glückspillen greifen. Das Einwerfen der Pille entbindet die Schmerzvermeider von der Verantwortung für sich selbst, die mühselige Arbeit der Decodierung zu leisten. Dieser vermeintlich leichte Weg der Schmerzvermeidung führt aber nicht zu persönlicher Entwicklung, sondern lediglich im Kreis herum. (In Deutschland hat sich die Zahl der Verschreibungen von Psychopharmaka deutlich erhöht: von knapp über 20 Tagesdosen je 1000 Einwohner im Jahr 2000 auf 50 Tagesdosen je 1000 Einwohner 2011). Außerdem führen Psychopharmaka wie sie die Rolling Stones in ihrer Nummer Mother’s little helpers besingen schnell in die Abhängigkeit, was die Pillenindustrie wohlweißlich verschweigt! Der Französische Psychiater und Psychoanalytiker Gérard Pommier meint dazu: „Gefühlsmäßig leben wir auf einem Vulkan. Doch wenn man diesen Vulkan mit Medikamenten erstickt, die nichts anderes sind als Drogen, erstickt man das Leben. Dabei können wir gerade dann neue Energie gewinnen, wenn wir es geschafft haben, uns in einer emotionalen Krise aus eigener Kraft zu befreien. Wir müssen weinen, bevor wir wieder lachen können.“
Wer allerdings achtsam ist wird wahrnehmen und feststellen, dass die Seele trotz Psychopharmazeutika glücklicherweise nicht locker lässt; denn Leben will ans Licht – oder frei nach Alice Miller - solange sie lebt, die Seele, kann sie auferstehen.