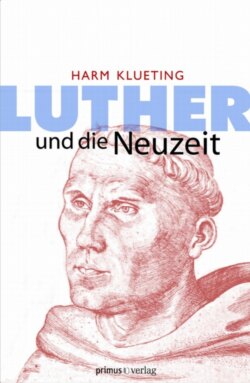Читать книгу Luther und die Neuzeit - Harm Klueting - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Konfessionelle Zeitalter
ОглавлениеDas 16. Jahrhundert war nicht nur Fortsetzung des 15. Es gab Veränderungsprozesse, die erst im 16. Jahrhundert einsetzten und dieses und das folgende Säkulum prägten. Das war vor allem der konfessionelle Grundzug des Zeitalters, das Gegenüber konkurrierender christlicher Glaubensformen oft in demselben Land oder in derselben Stadt. Das hatte es im 15. Jahrhundert nicht gegeben. Nach dem Zurücktreten – nicht Verschwinden – der konfessionellen Polarisierung seit dem späteren 17. und im 18. Jahrhundert gab es diesen konfessionellen Grundzug nicht mehr in der alten Weise.
Was unter Konfessionsbildung und unter Konfessionalisierung zu verstehen ist, soll hier nicht erörtert werden.9 Wichtig ist, dass das 16. Jahrhundert in Europa noch ganz christlich bestimmt, ja gegenüber dem Mittelalter durch Katholische Reform und Reformation zumindest auf kurze und mittlere Sicht noch stärker verchristlicht war, während die Konkurrenz der Konfessionen auf längere Sicht zur Verweltlichung beitrug. Das Dasein Gottes, der Fluch der Sünde, die Existenz der Hölle und des jenseitigen Lebens waren noch eine selbstverständliche Voraussetzung. Nur der Weg zur Gnade Gottes konnte fraglich sein. Alles war von den religiösen – und konfessionellen – Fragen der Zeit geprägt und durchdrungen. Das gilt für die innenpolitischen Auseinandersetzungen in den großen Monarchien im Westen Europas ebenso wie für das Reich und die deutschen Territorien, weil Religion und Politik, Kirche und Staat noch keine unabhängigen Teilbereiche darstellten, sondern einander umschlossen.
Die konfessionelle Komponente zeigt sich auch in der zwischenstaatlichen Politik und bei den Kriegen des Zeitalters. Auch wenn das Konfessionelle dabei oft nur als Vorwand diente und Bündnisse mit konfessionellen Gegnern und Kriege gegen Glaubensverwandte zuließ, so war es doch auch dann noch präsent. Die Prägung durch den christlichen Glauben und die Bedeutung des Konfessionellen bestand in allen sozialen Schichten von den Analphabeten in Stadt und Land bis zu den intellektuellen Eliten. Unglaube und Irreligiosität, die es im späteren Mittelalter unter der Oberfläche einer in jeder Hinsicht von Kirche und Religion bestimmten Kultur gegeben hatte, wurden im 16. Jahrhundert von der Konfessionalisierung zeitweise überdeckt. Auch standen die dem Späthumanismus keineswegs fremden Züge von Freigeisterei in Wechselbeziehungen mit den konfessionellen Gegensätzen, aber auch mit Gruppierungen wie den Antitrinitariern. Das alles erlaubt, dieses Zeitalter das Konfessionelle Zeitalter zu nennen, obwohl im 16. und 17. Jahrhundert auch andere „Sachkomplexe“ wirksam waren, „die eine eigene Entwicklungsdynamik gewinnen und als solche auch – neben der Konfession – singularisierbar sind“.10
Die traditionelle Epochengliederung der deutschen Geschichtswissenschaft unterscheidet für das 16. und 17. Jahrhundert einen ersten Abschnitt bis zum Augsburger Religionsfrieden von 1555 und einen zweiten von 1555 bis zum Westfälischen Frieden von 1648. Auch das geht auf Ranke und seine Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation zurück. Ranke führte den Begriff Reformation als Epochenbegriff und als Name des Zeitalters bis 1555 ein. Der Begriff Reformation ist eine verhältnismäßig junge Bezeichnung für das Wirken Luthers und für dessen Ergebnis. Im 16. Jahrhundert bedeutete reformatio zunächst noch wie im Mittelalter Wiederherstellung eines ursprünglichen und damit Verbesserung eines als verdorben angesehenen Zustandes. Dabei bezog sich reformatio auch auf profane Sachverhalte. Das änderte sich seit der Mitte des 16. und vor allem im 17. Jahrhundert. 1692 verstand Veit Ludwig von Seckendorff unter Reformation nur noch Luthers Kirchenkritik, sein Handeln und die Ausbildung einer neuen Kirche. Er schuf damit die Grundlage für den modernen kirchengeschichtlichen Reformationsbegriff, auch wenn er Zwingli und Calvin noch nicht einbezog.
Jünger als der von Seckendorff geprägte Begriff und die von Ranke eingeführte Epochenbezeichnung Reformation sind Begriff und Epochenbezeichnung Gegenreformation. Von Gegenreformation war zwar schon 1654 die Rede, doch fehlte noch der katholische Bezug. Seine Prägung als Begriff erfuhr dieser Ausdruck 1776 bei Johann Stephan Pütter, der zur Benennung der antiprotestantischen Anwendung des ius reformandi durch katholische Landesherren von Gegenreformationen sprach. Aber erst Ranke gebrauchte Gegenreformation für die katholische Reaktion auf die Reformation. Indem er die Gegenreformation als Zeitabschnitt auf die Reformation folgen ließ, bereitete er der Verwendung von Gegenreformation als Epochenbezeichnung den Weg. Danach war es Moriz Ritter, der 1889 Gegenreformation als Bezeichnung für das auf die Epoche der Reformation – im Sinne Rankes – folgende Zeitalter der deutschen Geschichte einbürgerte. Mit der Periodisierung und Terminologie Rankes und Ritters konnte die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts als protestantisches und die zweite nach 1555 als katholisches Zeitalter erscheinen.
Hier knüpften jüngere Historiker an. Otto Brunner sprach 1953 vom Konfessionellen Zeitalter und bezog das auf die Zeit von 1555 bis 1648. Er suchte dem Umstand Rechnung zu tragen, dass dieser Zeitraum nicht nur im Zeichen der katholischen Gegenreformation stand, sondern auch von der Ausbreitung des Calvinismus geprägt war. Joseph Lortz bezeichnete das ganze 16. Jahrhundert als Zeitalter der Glaubensspaltung und unterteilte dieses in protestantische Reformation und katholische Reform, wobei diese noch einmal in Katholische Reformbewegung und Gegenreformation aufgegliedert wurde. Wie bei der traditionellen Bezeichnung Zeitalter der Gegenreformation, so blieben auch bei Lortz die protestantischen Faktoren des späteren 16. Jahrhunderts undeutlich. Eine befriedigende Lösung dieses Problems setzt die Verknüpfung der Begriffsfrage mit der Periodisierungsfrage voraus, wie sie sich bei Ernst Walter Zeeden anbahnte. Zeeden verneinte die Bedeutung des Jahres 1555 als Zäsur für die allgemeine europäische Geschichte und für die Kirchengeschichte und hielt nur für die deutsche Geschichte die Aufgliederung in einen bis 1555 reichenden und in einen daran anschließenden Abschnitt für vertretbar. Doch betrachtete er den gesamten Zeitraum von 1517 bis 1648 als Einheit und nannte ihn Zeitalter der Glaubenskämpfe.11
Zeeden bezog die frühe Reformation in das Zeitalter der Glaubenskämpfe ein. Einen neuen Ansatz bot seit etwa 1977 Wolfgang Reinhard, der die Gegenüberstellung einer Epoche der Reformation und einer – im Gegensatz dazu als reaktionär verstandenen – Epoche der Gegenreformation zu überwinden suchte und die „relativ kurzfristige evangelische Bewegung“, in der er „den Kulminationspunkt von zwei Jahrhunderten voller Reformstreben“ und somit noch etwas Mittelalterliches sah, von einem „ebenfalls runde zwei Jahrhunderte anhaltenden Prozess der ‚Konfessionalisierung‘“ unterschied. Dieser habe „bereits in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts“ eingesetzt und „in allen drei konfessionellen Bereichen, bei Calvinisten, Katholiken und Lutheranern, sachlich weitgehend und zeitlich einigermaßen parallel“ stattgefunden.12 Diesen Zeitraum von den 1520er-Jahren an nennt Reinhard Konfessionelles Zeitalter.13 Diese Benennung lag dem Buch des Verfassers von 1989 zugrunde14, das die Epochenbezeichnung Konfessionelles Zeitalter ebenso im Titel führt wie sein umfangreicheres Buch von 2007.15
Eine Gegenposition zu Reinhards Sicht eines von etwa 1525 an zu datierenden Konfessionellen Zeitalters nahm Heinz Schilling ein, der zwar auch die Epochenbezeichnung Konfessionelles Zeitalter kannte,16 die bei ihm aber keine herausgehobene Rolle spielte, während er inzwischen Luthers Reformation als einen Faktor − „wenn auch sicherlich ein ganz entscheidender“ − innerhalb einer mehrere Jahrhunderte umfassenden und tief im Mittelalter wurzelnden Reformepoche sieht und daher Pierre Chaunus Le temps des Réformes (1250–1550)17 den Vorzug zu geben scheint, ohne wie dieser ein Ende dieser Zeit der Reformationen in der Mitte des 16. Jahrhunderts zu befürworten.18 Schilling hob nie auf eine Zäsur um 1525 ab, im Gegenteil, er polemisierte gegen diejenigen, die das taten. Schilling betonte, dass der Ausgang des Bauernkriegs von 1525 kein Ende der Reformation als Volksbewegung und somit keine Zäsur bewirkt habe, zumal die reformatorische Bewegung in den Städten vielfach erst nach 1525 ihren Höhepunkt erlangt oder ihr Ziel erreicht habe.19 Der Verlauf der Reformation vor allem in den niederdeutschen Städten gibt ihm recht.
Dennoch brachte das Jahr 1525 vier Momente, in denen man eine Zäsur sehen kann, nämlich 1. mit dem Ausgang des Bauernkriegs zumindest in Mittel- und Oberdeutschland den Sieg des Territorialfürstentums und in Verbindung damit – und mit dem Speyerer Reichsabschied von 1526 – den Beginn des Ausbaus des landesherrlichen Kirchenregiments, 2. die Entstehung des Täufertums, 3. mit der literarischen Fehde über die Willensfreiheit zwischen Luther und Erasmus von Rotterdam das Ende des Zusammengehens von Reformation und Humanismus und 4. mit dem Abendmahlsstreit zwischen Luther und Zwingli die Aufspaltung der Reformation in einen Wittenberger und einen Zürcher Flügel. Wenig später setzten mit dem gescheiterten Marburger Religionsgespräch von 1529 und mit den auf dem Augsburger Reichstag von 1530 vorgelegten Bekenntnisschriften − darunter die lutherische Confessio Augustana − auch in der theologischen Lehrentwicklung entscheidende Verfestigungen ein, die für die Konfessionsbildung bedeutsam wurden. Diese Jahreszahlen machen deutlich, dass sich die Zeit um 1525 als mögliche Zäsur zwischen der Zeit der relativ kurzfristigen evangelischen Bewegung und dem Konfessionellen Zeitalter bis 1529/30 erstreckte, sich also nicht auf ein Jahr fixieren lässt. Dabei ist das Konfessionelle Zeitalter aber nicht scharf abgehoben von der frühen Reformation und überdies mit dieser zusammen mit den Reformbewegungen des 14. und 15. Jahrhunderts verbunden und somit als Teil einer Großepoche zu sehen, deren Anfang im sogenannten Spätmittelalter liegt und deren Ende in der sogenannten Frühen Neuzeit zu suchen ist. Das Ende des Konfessionellen Zeitalters kann in der Mitte und in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, mit Nachwirkungen bis ins 18. Jahrhundert, angesetzt werden.
Diese Epochenbezeichnung Konfessionelles Zeitalter hat eine Vorgeschichte, die über Otto Brunners Ansatz von 1953 zurückreicht. Sie stammt von dem evangelischen Theologen und Religionssoziologen Ernst Troeltsch. Dieser unterschied 1906 zwischen Altprotestantismus und Neuprotestantismus und charakterisierte den Altprotestantismus als eine noch dem Mittelalter zugewandte Erscheinung. Erst der Neuprotestantismus habe die kirchliche Einheits- und Zwangskultur des Mittelalters überwunden, der die Reformation noch angehört habe. Als Kennzeichen des Neuprotestantismus nannte er die Emanzipation der allgemeinen weltlichen Kultur von der kirchlichen Zwangskultur und den Zug zur weltlichen Autonomie und zum Säkularismus. Die Grenze zwischen dem Altprotestantismus und dem Neuprotestantismus sah Troeltsch am Ende der großen Religionskriege des 17. Jahrhunderts – im Falle Deutschlands um 1648 – und in der Zeit des aufkommenden religiösen Individualismus im Zusammenhang mit dem Pietismus. Die Zeit des Altprotestantismus, also das 16. und große Teile des 17. Jahrhunderts, sei – so Troeltsch – nicht mehr Mittelalter, aber auch noch nicht Neuzeit – es sei das „Konfessionelle Zeitalter der europäischen Geschichte“.20