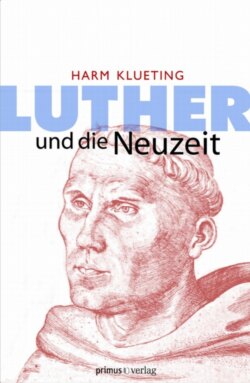Читать книгу Luther und die Neuzeit - Harm Klueting - Страница 13
Katholische Reform
ОглавлениеEs bleibt die Frage, wann die Katholische Reform begann. Eine Antwort gibt Konrad Repgen: Die „Anfänge der katholischen Reform [lagen] im frühen 15. Jahrhundert“.6 Katholische Reform wäre damit zumindest in zeitlicher Hinsicht ein viel umfassenderer Prozess als katholische Konfessionalisierung. Die Katholische Reform hätte dann auch lange vor Luther begonnen und wäre nicht als Reaktion auf die Reformation zu verstehen. So stützt Repgens Sicht das Verständnis des frühen Luther als katholischer Reformer und die Deutung der Reformation als „eine aus dem Ruder gelaufene Ordensreform“.7
Italien: Kardinäle, Bischöfe, Spirituali Die Katholische Reform begann in Ansätzen mit der Diskreditierung von Kirche und Klerus während des Schwarzen Todes seit 1348, spätestens aber mit den Reformbewegungen, die sich in Italien und Spanien seit dem 15. Jahrhundert ohne Unterbrechung durch die Reformation − aber von ihr beeinflusst − fortsetzten und die besonders in Spanien − ähnlich wie die Reformation in Deutschland oder in der Schweiz − bei den politisch Mächtigen Unterstützung fanden. Der Niedergang des Papsttums in Avignon seit 1309 und im Schisma von 1378 führte − bei Dante, Katharina von Siena und anderen − zu Reformforderungen und zum Ruf nach einer reformatio ecclesiae in capite et in membris, wie es 1410 in einer Flugschrift Dietrichs von Niem hieß, während das 15. Jahrhundert zum Jahrhundert der Reformkonzilien wurde. Nach dem Scheitern des Konzils von Basel übernahm das Papsttum die Kirchenreform. Das begann mit Nikolaus V., dem Humanisten auf dem Papstthron, dem aber Erfolg bei seinen Reformbemühungen versagt blieb − wegen der politischen Umstände mit der wachsenden Türkengefahr nach dem Fall von Konstantinopel 1453 und den Gegensätzen der europäischen Mächte, wegen des 1453 auf ihn verübten Mordanschlags und wegen Alters und Krankheit. Der übernächste Papst, Pius II., Enea Silvio Piccolomini, hätte das Zeug zu einem großen Papst der Katholischen Reform gehabt, doch kam seine große Reformbulle vor seinem Tod nicht zum Abschluss. Nach Pius II. setzte wieder ein Niedergang des Papsttums ein. Mit Sixtus IV. begann 1471 die Epoche des Nepotismus. Innozenz VIII. war nicht nur ungebildet, sondern erlangte sein Amt auch durch Simonie (Ämterkauf). Er veranstaltete für seinen Sohn im Vatikanischen Palast eine prunkvolle Hochzeitsfeier und ebenso für seine Enkelin. Giovanni de’ Medici machte er mit 14 Jahren zum Kardinal. Dieser Giovanni war der spätere Papst Leo X. Von Innozenz VIII. war keine Kirchenreform zu erwarten, ebenso wenig von seinem Nachfolger Alexander VI. Dieser Papst aus der spanischen Familie Borja, Musterbeispiel des verweltlichten Renaissancepapsttums, nutzte sein Pontifikat zur Steigerung von Macht und Reichtum seiner Familie.
Aber das Renaissancepapsttum, die Päpste, die Kardinalnepoten und die Höflinge und Schmarotzer in den Palästen von Rom waren nicht alles. Es gab daneben zahlreiche, oft hochgebildete Reformer. Ein solcher war der als Sohn eines Moselschiffers in Kues an der Mosel geborene Bischof von Brixen und Kardinal Nikolaus Cusanus, der am Konzil von Basel teilnahm und 1437 nach Konstantinopel reiste, um die Union der lateinischen und der griechischen Kirche zu erreichen. Während er in De concordantia catholica von 1433 und in anderen Schriften aus der Zeit zu Beginn des Basler Konzils konziliaristische Standpunkte vertreten hatte, wechselte er unter dem Eindruck der Unionsbestrebungen Eugens IV. auf die papalistische Seite. Nach dem Konzil von Basel war er einer der wichtigsten Vertreter der Reformpartei an der Kurie, wie er in Brixen um Reformen auf Diözesanebene bemüht war. 1459 machte er mit seiner Reformatio generalis umfassende Reformvorschläge und war der Verfasser der nicht zum Abschluss gekommenen großen Reformbulle Pius’ II. Als Kardinallegat wirkte er seit 1451 auf Visitationsreisen im Reich für Reformen in Diözesen und Orden. Als einer der bedeutendsten Philosophen und Theologen des 15. Jahrhunderts trat er für verinnerlichte Religiosität ein und verfasste 1453 mit De visione Dei auch ein Werk der mystischen Theologie.
Ein anderer Reformer war der Augustiner-Eremit und Humanist Aegidius von Viterbo, der als Reformator der Augustiner-Eremiten, als Legat Leos X., als Kardinal und als Bischof von Viterbo Reformaktivitäten zu entfalten suchte. Im Mai 1512 hielt er in Rom die Eröffnungsrede des V. Laterankonzils und stellte dabei die Kirchenreform als Hauptaufgabe heraus. Ein dritter Reformer war der Dominikaner und Kardinal Thomas de Vio Cajetan − jener Cajetan, der Luther 1518 in Augsburg zu verhören hatte −, der auf dem V. Laterankonzil die Autorität des Papstes verteidigte und auch später in der Auseinandersetzung mit Luther den Papstprimat vertrat. Cajetan wirkte vor allem als Theologe. Mit seinem am 8. Dezember 1517, nur fünf Wochen nach Luthers Ablassthesen, abgeschlossenen Traktat De indulgentia, der der Bulle Cum postquam von 1519 zugrunde lag, suchte er die im Mittelalter ungeordnet gebliebene Ablasstheologie zu klären. 1513 begann er mit der Kommentierung des Alten und Neuen Testaments, was unter dem Eindruck von Luthers Theologie an Bedeutung gewann. Sein Kommentar zur Summa Theologiae des Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert, den er zwischen 1507 und 1522 verfasste, trug dazu bei, dass die Summa als wichtigste Grundlage des theologischen Studiums an die Stelle der Sentenzen des Petrus Lombardus aus dem 12. Jahrhundert trat. Cajetan war mit Erfolg bemüht, „die katholische Lehre so darzulegen, dass er den Grundanliegen der Reformation gerecht wurde − und das nicht obwohl, sondern weil er der große Thomist war, der spätmittelalterliche Theologoumena hinter sich ließ“.8
Die Reformbestrebungen, in denen die Anfänge der Katholischen Reform in Italien sichtbar werden, hingen mit den Observanzbewegungen (lat. observare [die Ordensregel] beachten) der Bettelorden und mit den sich ihnen als Tertiaren oder Dritte Orden anschließenden Laien zusammen. Venedig war ein Zentrum der Katholischen Reform. Aus dem seit 1505 bestehenden Kreis in der Lagunenstadt ging die radikale Reformschrift an Leo X., Libellus ad Leonem X, hervor. In Venedig wirkten der spätere Kamaldulenser und Gründer der Reformkongregation vom Monte Corona Tommaso (Paolo) Giustiniani, der Verfasser des Libellus, und Gasparo Contarini. Dem späteren Kardinal Contarini ging in der Osterbeichte von 1511 die Erkenntnis auf, dass keine menschliche Bußleistung dem Menschen vor Gott Gerechtigkeit verschaffen könne, sondern nur das Sühneleiden Christi, das als Gnade Gottes nur im Glauben empfangen werden könne. Das war im Kern die Rechtfertigungslehre, zu der Contarinis Geburtsjahrgangsgenosse Luther erst sehr viel später gelangte. Als Legat Pauls III. nahm Contarini 1541 am Regensburger Religionsgespräch teil und versuchte, in der Rechtfertigungslehre einen Kompromiss zu erreichen, der Luther entgegenkam, doch wurde seine Position von Luther wie von Rom abgelehnt. Contarini gehörte in Venedig zu den humanistisch beeinflussten Theologen, den Spirituali, deren Ansichten sich mit denen der Reformation berührten und manches von dem vorwegnahmen, was später von Luther vertreten wurde. Zu den Spirituali zählte auch der Abt des Benediktinerklosters San Giorgio Maggiore in Venedig, Gregorio Cortese, der an der Vorbereitung des Konzils von Trient beteiligt war.
Im Kardinalskollegium und unter italienischen Bischöfen gab es reformbereite Kräfte wie die Kardinäle Oliviero Carafa, den 1511 gestorbenen Erzbischof von Neapel und späteren Kurienkardinal, der unter Alexander VI. in einer Reformkommission wirkte, oder Gian Matteo Giberti, der 1527 Bischof von Verona wurde. Unter Clemens VII. war er an der Kurie tätig. In Rom lernte er das Oratorium der göttlichen Liebe und den 1524 aus dem Oratorium hervorgegangenen Theatinerorden kennen. 1527 verließ er Rom und ging nach Verona. Bis dahin war es üblich, dass italienische Bischöfe − zumal solche, die an der Kurie Karriere gemacht hatten − in Rom lebten und ihr Bistum als Pfründe und die Einkünfte aus ihrem Bistum zur Steigerung ihres Wohlstands nutzten. Giberti hingegen ging in sein Bistum, visitierte den Diözesanklerus, richtete ein Priesterseminar ein, reformierte Klöster und sorgte für soziale Einrichtungen. Er nahm das Bischofsideal des Konzils von Trient voraus. Giberti stand in Verbindung mit der Bewegung des Evangelismo italiano und war von dessen theologischen Auffassungen beeinflusst.
Der Evangelismo italiano, zu dem auch die Spirituali um Contarini und den späteren Erzbischof von Canterbury Reginald Pole, der seit 1532 in Italien lebte und 1536 Kardinal wurde, gehörten, war eine katholische Reformbewegung vor und nach dem Tridentinum. Durch die Erhebung Contarinis zum Kardinal 1535 und den Eintritt anderer in kuriale Ämter konnte der Evangelismo vor Trient an der Kurie Einfluss erlangen und zu dem Weg zum Konzil von Trient beitragen. War die Bewegung auch heterogen, so spielte die Rechtfertigung allein aus dem Glauben ohne Werke für den Evangelismo doch eine so große Rolle, dass er nach der Einrichtung der römischen Inquisition 1542 unter Protestantismusverdacht geriet.
Ungeachtet von Bischöfen wie Giberti in Verona, neben dem Gianpietro Carafa − der spätere Paul IV. − seit 1505 in Chieti oder Geromino Trevisani seit 1507 in Cremona zu nennen sind, und der Bewegung des Evangelismo italiano waren die Reformer in der stark verweltlichten hohen Geistlichkeit Roms und Italiens im späten 15. und im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts noch eine kleine Minderheit. So gewann die Katholische Reform in Rom erst während des Pontifikats Pauls III. seit 1534 Bedeutung. Paul III. war selbst noch ein Papst der Renaissance, hatte vier Kinder, versorgte drei Enkel mit hohen Ämtern und verdankte seinen Platz im Kardinalskollegium Alexander VI., der sich mit seiner Erhebung zum Kardinal für die Liebesdienste erkenntlich zeigte, die seine Schwester Giulia Farnese ihm als Mätresse geleistet hatte. So war Paul III. noch kein Papst der Katholischen Reform. Dennoch wirkte er durch die Einberufung des Konzils von Trient als Wegbereiter der Reform der Kirche. Der Durchbruch der Katholischen Reform vollzog sich am Sitz des Papsttums nach den beiden ersten Tagungsperioden des Konzils unter den drei Päpsten Julius III., Marcellus II. und Paul IV. und somit zwischen 1549 und 1559.
Spanien: Katholische Reform im Dienst der Einheit des Königreichs Was so in Italien als Werk kleiner Gemeinschaften von Laien und Klerikern erscheint, das gewann in Spanien vor der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert die Gestalt einer großen Erneuerungsbewegung, womit Spanien zum wichtigsten Land der Katholischen Reform − und zum Antipoden des Deutschland der Reformation − wurde. Getragen und gefördert wurde die Katholische Reform in Spanien von den alten Mönchsorden und den Bettelorden, von manchen Bischöfen und von Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragón. Dahinter standen das Kreuzzugsbewusstsein der siegreichen Reconquista und das Staatskirchentum der Kronen von Aragón und Kastilien. Die beiden Reyes Católicos9 stellten die Erneuerung der Kirche in den Dienst der Einheit ihrer Reiche. 1478 wurde auf dem Nationalkonzil von Sevilla die Reform der spanischen Kirche beschlossen, die von den Königen gemeinsam mit den Bischöfen vorangetrieben und gegen Einflussnahme von außen, auch gegen das Papsttum, abgesichert werden sollte. Dazu gehörte die Einschränkung der Privilegien der exemten Orden (als exemte Orden bezeichnet man die der bischöflichen Jurisdiktion nicht unterstehenden – davon exemten – Orden bzw. deren Klöster) und die strenge Einhaltung der Residenzpflicht der Bischöfe und des Klerus. Die Vernachlässigung der Residenzpflicht war − neben Nepotismus, Korruption und Ämterkäuflichkeit, Kommerzialisierung des Bußsakramentes im Ablasshandel und verweltlichtem Luxusleben von großen Teilen des hohen Klerus − einer der wichtigsten Missstände der Kirche. Das gab es überall im lateinischen Europa, wo die teilweise gut dotierten Pfarrer oft außerhalb des Pfarrsprengels lebten und die Einkünfte aus ihrer Pfarrei verzehrten, in der sie sich von schlecht besoldeten Kaplänen vertreten ließen. So nahm das Nationalkonzil von Sevilla 1478 wichtige Reformimpulse des Konzils von Trient voraus.
Einer der hervorragendsten Vertreter der Katholischen Reform war der aus dem Franziskaner-Observantentum kommende Bettelmönch und seit 1495 Erzbischof von Toledo Francisco Ximénes de Cisneros, der nicht nur Beichtvater der Königin Isabella war, sondern auch − während der Jahre 1506 bis 1508 und 1516 bis 1517 − Regent von Kastilien sowie seit 1507 Kardinal und Generalinquisitor. Ein anderer war der Erzbischof von Granada Hernando (Fernando) Talavera y Mendoza, auch er Beichtvater des Königspaares. Beide führten in ihren Diözesen Reformen durch, mit denen sie die tridentinischen Reformen vorwegnahmen. Dazu gehörten neben Diözesansynoden – im Erzbistum Toledo seit 1497 – Visitationen des Klerus und Richtlinien für die Seelsorge, mit denen Cisneros Toledo zu einer Art Musterbistum machte, die Abfassung einer Breve doctrina genannten Zusammenfassung der Glaubenslehren für den Volksunterricht und die Gründung von Einrichtungen für die Priesterausbildung und die Hebung des Bildungsstandes des Seelsorgeklerus. Cisneros hatte 1499 entscheidenden Anteil an der Gründung der 1508 eröffneten Universidad Alcalá de Henares. Die Alcalá wurde ein Zentrum des biblischen oder christlichen Humanismus und zugleich des Thomismus. Hier wurde − maßgeblich gefördert von Cisneros − eine Neuedition des Alten und Neuen Testaments, die Biblia Sacra Polyglotta, besser bekannt als Complutensische Polyglotte, erarbeitet. Die ersten fünf der sechs Foliobände enthielten das Alte Testament im hebräischen Text und im griechischen der Septuaginta und das Neue Testament im griechischen Text, beides ergänzt um den lateinischen Text der Vulgata. Als Ordensreformer − seit 1496 war Cisneros Visitator der spanischen Franziskaner, seit 1499 Visitator und Reformator aller Bettelorden in Spanien − „beseitigte er Mißstände, die in Mitteleuropa zum Anlaß für die Reformation wurden“.10
Bedeutung erlangte auch Francisco de Vitoria, der, nach Lehrtätigkeit im Dominikanerkonvent von Saint-Jacques in Paris, seit 1523 im Dominikanerkonvent San Gregorio in Valladolid und seit 1526 an der Universität von Valladolid lehrte, die scholastische Theologie erneuerte und zum Mitbegründer der noch für das ganze 17. Jahrhundert und darüber hinaus wichtigen spanischen Spätscholastik wurde. Er ersetzte das Sentenzenwerk des Petrus Lombardus als theologisches Lehrbuch durch die Summa Theologiae des Thomas von Aquin und trug so zur thomistischen Reform des Theologiestudiums bei.
Die Theologie der Escuela de Salamanca, als deren Haupt Vitoria gilt, gewann bedeutenden Einfluss auf das Konzil von Trient. Lange vor dessen Zusammentritt vertrat Vitoria in Relectiones von 1532 bis 1534 Vorstellungen über Kirchen- und Papstgewalt und ein weitreichendes Programm zur Kirchenreform, das ihn mit diesen Schriften unter dem seit 1581 regierenden Sixtus V. auf den römischen Index brachte. Mit De iure belli von 1539 wurde Vitoria, lange vor Hugo Grotius, ein Begründer des Völkerrechts. Auf dem Boden der Katholischen Reform stand seine Kritik an der spanischen Kolonialpolitik in Mittel- und Südamerika in seinen Relectiones de Indis von 1539, wie sie vor allem ein anderer spanischer Dominikaner, Bartolomé de Las Casas, übte. An der Alcalá gewannen die Gedanken des Erasmus von Rotterdam Einfluss, die auch unter den Bischöfen, vor allem bei dem Kardinal-Bischof Iñigo López de Mendoza y Zúñiga von Burgos, Anhänger fanden. In Spanien, dem wichtigsten Land der Katholischen Reform, verbanden sich Gesellschaft und Königtum unter dem Katholizismus wie nirgendwo sonst in Europa. Im Grunde ging es darum, ganz Spanien als katholisches Spanien zu integrieren.