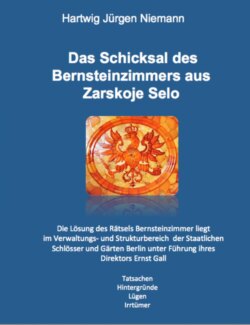Читать книгу Das Schicksal des Bernsteinzimmers - Hartwig Niemann - Страница 10
Georg Poensgen
ОглавлениеGeorg Poensgen war ein anerkannter Kunsthistoriker, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Nur von einer Tatsache kann man ihn nicht freisprechen. Er war unmittelbar am „Raub des Bernsteinzimmers“ beteiligt. Er war ein Kunsthistoriker, der direkt aus dem Verantwortungsbereich der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Berlins kam. Zum Zeitpunkt seiner Tätigkeit in diesem Verantwortungsbereich war Ernst Gall sein unmittelbarer Vorgesetzter.
Wahrend des Krieges wurde Hermann Lorey - zeitweilig Chef der Heeresmuseen - sein neuer Vorgesetzter. In diesen Zeitraum fällt der „Raub des Bernsteinzimmers“.
Hermann Lorey war es, der Ernstotto Graf Solms zu Laubach und Georg Poensgen den Auftrag erteilte, sich um das Bernsteinzimmer zu kümmern. Die Handlungen dieser unmittelbar beteiligten Personen sind daher in der Nachkriegszeit vordergründig zu betrachten und zu erforschen, weil sie – aus ihrer damaligen Sicht des Vorgehens - immer die richtigen Motive zum Handeln hatten.
Sie hielten zusammen:
Adolf Hitler, Hermann Göring, Ernst Gall, Alfred Rohde, Hellmuth Will (Oberbürgermeister von Königsberg), Hermann Lorey, Georg Poensgen, Ernstotto Graf Solms zu Laubach, Ernst Poensgen (Großindustrieller und Vater von Georg Poensgen), Graf Schimmelmann. Die Brigadeführer der SS: Ludwig Grauert (Staatsekretär und Kriegskamerad von Hermann Göring aus dem Ersten Weltkrieg), Hans-Adolf Prützmann (Ostpreußen) und von Wulffen (Stadtkommandant von Potsdam). Hauptmann Segebarth (Verantwortlich für den Kunstgütertransport von „Kurfürst“ in die Heeresmunitionsanstalt Bernterode am 13. März 1945), Oberleutnant Kraske (Transportleiter des Kunstgütertransportes vom 13.März 1945 von „Kurfürst“ in die Heeresmunitionsanstalt Bernterode), Oberst von Wedelstedt (Transportleiter des Kunstgütertransportes vom 24.März 1945 von „Kurfürst“ in die Heeresmunitionsanstalt Bernterode) u.v.a.
Kein Wunder, dass die Erinnerungen, die Georg Poensgen niedergeschrieben hat, immer noch unzugänglich wohlverwahrt im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg liegen. Dieses Verhalten bedauerte sogar Anja Heuß. Sie beschreibt dieses Verhalten mit folgenden Worten:
„Das Kurpfälzische Museum in Heidelberg verwahrt seine
(Georg Poensgens - d.A.)
Erinnerungen, von denen mir leider nur wenige Seiten
zugänglich gemacht wurden, die wenig ergiebig waren.“ (1)
Es ist immer schwierig, in die Grauzone der Vergangenheit einzudringen. Sicherlich ist dem einen oder anderen inzwischen bekannt geworden, dass Georg Poensgen nach Beendigung des Krieges als Leiter des Kurpfälzischen Museums im schönen Heidelberg eine neue Wirkungsstätte fand, um seine Kenntnisse als Kunsthistoriker zu verwirklichen und in eine neue Form zu bringen.
In Würdigung seines 60. Geburtstages wurde für den Freundeskreis des Jubilars in 400 Exemplaren (es wurden nur 400 Exemplare gedruckt - d.A.) seine Leistungen hervorgehoben.
Es ist schon eine Rarität, eine Kopie dieser Veröffentlichung zum Thema
„GEORG POENSGENS WIRKEN ALS LEITER DES KURPFÄLZISCHEN MUSEUMS“
zu besitzen, weil der Inhalt wesentlich zum Persönlichkeitsbild von Georg Poensgen beiträgt.
Nachzulesen ist der Beitrag unter:
„Eine Würdigung des 60. Geburtstages von Georg Poensgen von G.F. Hartlaub. Heidelberg 1958.“
Dem Autor ist in dem Zusammenhang nur folgendes aufgefallen. Der Name des Vaters von Georg Poensgen findet in dem Beitrag keine Erwähnung, sondern wird wie folgt umschrieben:
„Georg Poensgen, am 7. Dezember 1898 in Düsseldorf geboren kam als Sohn eines bekannten Industriellen aus einem typisch großbürgerlichen Milieu mit einem Lebensstil und einer Gesinnung, die das materiell Fortschrittliche mit einer kulturell eher konservativen Haltung verbinden...“
Sein Einsatz im Zweiten Weltkrieg entspricht eher einer lapidaren nichtssagenden
Vorstellung:
„Im Kriege war Poensgen dem Kunstschutz zugeteilt und hat in dieser Eigenschaft auch ferne Länder Rußland und Japan gesehen. Nach völliger Ausbombung seines Berliner Heims fand er sich schließlich mit seiner Gattin nach Wien verschlagen, von wo er sich 1945 nach Überlingen am Bodensee abzusetzen vermochte. Auch hier blieb er, trotz der noch so drückenden Verhältnisse, nicht untätig. Als Privatmann, nur aus uneigennützigem Interesse an solchen Aufgaben, hat er das dortige Museum wieder eingerichtet.“ (2)
Was sagt uns nun diese sachliche und lapidare Würdigung der Persönlichkeit Georg Poensgens, in der kein einziges Wort über seinen Einsatz als „Sammeloffizier“ des Chefs der Heeresmuseen und über das Bernsteinzimmer zu finden ist. Sie drückt sehr viel aus.
Sie bestätigt, dass er „als Sohn eines bekannten Industriellen“ geboren wurde. Der Name dieses Industriellen wird zwar nicht genannt, aber dieser Industrielle war Ernst Poensgen. Ernst Poensgen war im Dritten Reich - wie bereits erwähnt nicht nur Industrieller - sondern er war Großindustrieller und bestens bekannt mit anderen Großindustriellen der damaligen Zeit. Diese Großindustriellen wiederum, zu denen der Vater von Georg Poensgen gehörte, waren zur damaligen Zeit das „stählerne Rückgrad“ des Faschismus.
Sie waren es, die in ihren Betrieben dafür Sorge trugen, dass die Produktion von Kriegsschiffen, Panzer, Kanonen und Munition aufrechterhalten werden konnte. Sie waren es, die den Stahl für die Kriegswirtschaft produzierten. Der Erfolg lag auf der Hand – hohe Gewinne. Diese hohen Gewinne, daran gibt es keinerlei Zweifel, wurden von Ernst Poensgen und Fritz Thyssen in der Schweiz als bare Münze in Schweizer Franken umgewandelt und auf Schweizer Banken deponiert.
Während deutsche Soldaten in den Panzern, die für den Krieg benötigt wurden, den Heldentod starben, konnten sie ihr Scherflein ins Trockene bringen. Als der Niedergang des Dritten Reiches nicht mehr aufzuhalten war, setzen sich diese beiden Großindustriellen in die Schweiz ab. Sie hatten genau und rechtzeitig erkannt, was auf Deutschland zukommen würde.
Fritz Thyssen trieb diese Entwicklung in die Arme des OSS und er kehrte nach der Niederlage mit dieser Geheimdiensttruppe von Allan Dulles, die in der Schweiz operierte, wieder nach Deutschland zurück.
Heute erwähnt man ungern den Namen Ernst Poensgen, auch nicht im Zusammenhang mit dem „Weißen Haus“ in Bonn dem zweiten Arbeits- und Wohnsitz des Bundespräsidenten das einmal Eigentum von Ernst Poensgen war.
Einen Ernst Poensgen, der Hermann Göring aus Anlass zu dessen Hochzeit einen Scheck in Höhe von 100 000 Reichsmark ausschrieb, einem Ernst Poensgen, der von den Nationalsozialisten ausgezeichnet und hofiert wurde, einem Ernst Poensgen, der in Absprache mit Hermann Göring dafür Sorge trug, das ein Ludwig Grauert auf Wunsch von Hermann Göring im Polizeidienst eingesetzt werden konnte und die Gestapo mit aufbaute und einem Ernst Poensgen, der zum Wehrwirtschaftsführer wurde, lässt man heute lieber im Hintergrund der Vergangenheit schlummern.
Nur die biologischen Fakten sprechen für sich. Der Kunsthistoriker Georg Poensgen war sein Sohn. Vielleicht sprachen beide nie miteinander über ihre eigentlichen Aufgaben. Entsprechende Dokumente wie das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war sind dem Autor nicht bekannt geworden.
Heute wird es aber immer schwieriger, die Vergangenheit im Hintergrund zu verstecken. Immer mehr Tatsachen erblicken nach ausführlichen Recherchen im World Wide Web das Tageslicht.
Eine Tatsche ist dem Autor bekannt: in diesen industriellen Kreisen von Krupp bis Poensgen, Ernst waren Kunstgüter immer wieder gefragte Objekte, um die auf Kosten anderer erwirtschafteten Gewinne inflationssicher anzulegen. Aus diesem Grunde ist es unerlässlich, eine Persönlichkeit wie den Vater von Georg Poensgen in die Suche mit einzubeziehen.
Die Verbindungen, die Ernst Poensgen im Dritten Reich hatte waren Beziehungen der Superlative - insbesondere zum Kunsthai Hermann Göring. Diese Beziehungen lässt man als Autor nicht so einfach unter den Tisch fallen, wenn es um die Suche nach einem Kunstwerk aus der preußischen Vergangenheit wie dem Bernsteinkabinett Friedrich I., geht.
Außerdem war das Kunstinteresse in diesen Unternehmerkreisen, die über Milliarden verfügten, sehr groß.
Der Autor erinnert in diesem Zusammenhang an den Enkel des Gründers der Thyssen AG, August Thyssen, Hans Heinrich Thyssen Bornemisza de Kaszon und sein El museo de arte Thyssen-Bornemisza in Spanien. Die Poensgens, Krupps und Thyssens waren eng miteinander verbunden.
1948 schrieb Georg Poensgen für den Buchverlag Wulff aus Überlingen sein Buch „Daphne“ unter dem Pseudonym, „J.P. van Goellecke = Johannes Peter van Goellecke“.
Dieser Titel ist in der Bayrischen Staatsbibliothek zu finden „Daphne“, Untertitel Roman, Autor J.P.van Goellecke. Erscheinungsjahr 1948. Verlag Wulff. Verlagsort Überlingen.“ Eine Google Buchsuche wirft folgenden Hinweis aus:
Eine weitere Verbindung Ernst Poensgens bestand zum Urenkel des „bekannten Historienmalers Alfred Rethel... Von 1908 – 1912 lebt er als Pflegekind in der Familie des Stahlindustriellen Ernst Poensgens... Durch einen russischen Schulfreund erhält er ersten Kontakt zur Anti-Kriegsbewegung...Im September 1931 nimmt Sohn-Rethel eine - durch Ernst Poensgen vermittelte – wissenschaftliche Tätigkeit beim Mitteleuropäischen Wirtschaftstag auf...Im Oktober 1937 übersiedelt er ganz nach London.“
Quelle: www-user.uni-bremen.de/ ~steglich/2bio.html
Im Verbundkatalog für Nachlässe und Autographen „Kalliope“ sind ebenfalls Hinweise über Georg Poensgen zu finden.
„Poensgen, Georg 1898-1974, Wirkungsort Heidelberg, Beruf Kunsthistoriker, von dieser Person 1 Handschriftendatensatz. Dieser Handschriftendatensatz hat folgenden Inhalt: Briefe, Signatur Heidelberg Hs.3716 III F. von Person Georg Poensgen (Verfasser) an Person Radbruch, Gustav. Umfang 1Br. 1.S.
Entstehungsort Heidelberg, Besitzende Institution Universitätsbibliothek Heidelberg.
Mediennummer HS006294457x. Radbruch, Gustav 1878-1949, Beruf Jurist, Politiker. Land Deutschland.1920-1924 Mitglied des Reichtages. Nominiert als Reichsjustizminister.“
Der bei Kalliope aufgeführte „Bestand“ zur Person Georg Poensgen enthält einen weiteren Hinweis über den Nachlass von Georg Poensgen - nicht zu verwechseln mit seinen Erinnerungen.
„Nachlass Georg Poensgen, Bestandstyp – echter Nachlass. Besitzende Institution Universität Heidelberg. Umfang – 2 Kartons. Inhaltsangabe: Vertragsmanuskripte, Dias und Fotos von Gemälden, persönliche Fotos, Notizen zur abstrakten Kunst, Manuskripte, Zeitungsausschnitte, Benutzungshinweis benutzbar.“
Weitere Hinweise über die Vergangenheit Georg Poensgens liegen im Stadtarchiv Freiburg i. Br. im Bestand K1/44 Schriftlicher Nachlass von Prof. h.c. Dr. Joseph Schlippe (1885-1970).
Der wissenschaftliche Nachlass von Prof. h.c. Dr. Joseph Schlippe wurde am 4. Mai 1982 durch Herrn Dipl.-Ing. Bernhard Schlippe aus Lübeck und Frau Margot Loewe geb. Schlippe aus Breisach dem Stadtarchiv Freiburg als Depositum überlassen.
Beschreibung des jetzigen Lagerzustandes:
„Der Nachlass wurde in Absprache mit der Papierrestauratorin des Hauses konservatorisch bearbeitet. Sämtliche Unterlagen wurden entmetallisiert sowie in säurefreie Archivmappen und -schachteln verpackt. Die 1326 Einzelnummern sind in 91 Archivschachteln untergebracht, davon enthalten vier ausschließlich Fotografien.
Der Bestand K1/44 – Nachlass Schlippe – umfasst nach Abschluss der Erschließungs- und Verzeichnungstätigkeiten einen Umfang von 16 Regalmetern.
(K 1/44- 580). Kreisstellen und Bezirkspfleger in (Süd-)Baden, nach Orten (K-U)
Konstanz und Überlingen: Poensgen-Bewerbung als Konservator des Bodenseegebiets / pdf doc, Seite 114, K 1 / 44 - 256. Schürenberg, Lisa. Enthält u.a.: Forschungen über de la Fosse / Straßburg-Exkursion (Schimpf) / Plastiken am Straßburger Münster / Informationen über Georg Poensgen 6 Schr. 1938 - 1948
pdf doc, Seite 333.“ (3)
Nach einer Anfrage des Autors im Kulturamt Stadtarchiv Freiburg Dezernat III kamen von dort folgende Mitteilungen an den Autor.
Übersandt wurden Kopien aus den Faszikeln K1/44 Nr. 256 und K1/44 Nr. 580. Faszikel 256 enthält neben einem Brief, dessen Kopie an den Autor übersandt wurde, einen weiteren Schriftwechsel zwischen Schlippe und Lisa Schürenberg, der aber nicht mehr Georg Poensgen betrifft.
Faszikel 580 enthält neben der maschinengeschriebenen Bewerbung einen handschriftlichen Entwurf. Die Bewerbung Georg Poensgens liegt dem Autor als Kopie vor.
In beiden Faszikeln geht es um die Besetzung der (z.T. ehrenamtlichen) Stellen im Bereich der Konstanzer Denkmalpflege bei denen Georg Poensgen nicht berücksichtigt wurde. Die Bewerbung Poensgens wurde am 1. August 1946 geschrieben. Am 22.11.1947 erfolgte die Ablehnung. Georg Poensgen wohnte zu der Zeit in: 17b Überlingen/Bodensee, Pension Sonnenhalde, Rauensteinstraße 56.
__________________
1. Anja Heuß Seite 68. Anmerkung Pkt. 108.
2. Eine Würdigung des 60. Geburtstages von Georg Poensgen von G.F.. Hartlaub. Heidelberg 1958.
3. Albert Ludwig Universität Freiburg. Universitätsbibliothek Freiburg. Stadtarchiv Freiburg: Nachlässe. Bestand: Ki: Nachlässe von Privatpersonen. Nachlass Schlippe (1885-1970) pdf doc.