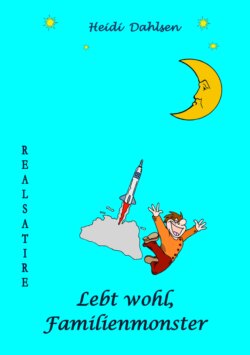Читать книгу Lebt wohl, Familienmonster - Heidi Dahlsen - Страница 6
Leiblich oder adoptiert
ОглавлениеDie unschönen Erlebnisse mit meinen Eltern brachten mich auf die Idee, in unserem Familienstammbuch nach Hinweisen zu suchen, ob ich eventuell adoptiert worden bin. Denn Eltern, die ihr Kind gern haben, verhalten sich nicht so abweisend wie meine.
Lange Zeit dachte ich, mein Name wäre „DUMME” oder „NACHTJACKE mit dem Fichtelhirn”, weil ich, in Verbindung mit einem leichten Schlag auf den Hinterkopf, der das Denkvermögen erhöhen sollte, oft von meinem Vater so genannt wurde. Außerdem nahm ich an, dass ich im Sternzeichen „JAMMERLAPPEN” geboren wurde.
Am liebsten hätte ich mich selbst in ein Kinderheim eingewiesen. Aber man hätte mir sicher nicht geglaubt. Ein Einzelkind und nicht zufrieden. Wie undankbar ist das denn?
Den Vater meines Vaters, also meinen Opa, habe ich zwar gekannt, ich könnte aber nicht gerade behaupten, dass er oft ein Wort an mich gerichtet hat.
Ein Ereignis ist mir jedoch in Erinnerung geblieben.
Ihm gefiel es wahrscheinlich gar nicht, dass ich so ängstlich war. Deshalb wollte er mir sicher nur helfen, als er mir auf seine einfältige Art Mut einflößte, denn: Konfrontation mit der Angst muss ein sicheres Mittel sein, diese zu bekämpfen!!!
Meine Großeltern wohnten in unserem Nachbarort, der nur eine Bahnstation entfernt war.
Ich traute mich im Alter von acht Jahren natürlich noch nicht allein Zug zu fahren, denn die schweren Türen, mit den meist klemmenden Schlössern, bekamen selbst die Erwachsenen kaum auf.
Während einer Familienfeier schnappte Opa mich einfach, schleppte mich ohne Kommentar zum Bahnhof, kaufte eine Fahrkarte und steckte mich in den nächsten Zug Richtung Heimat.
„Hilfe, Eltern! Wo seid ihr? Ihr sollt doch immer auf mich aufpassen und mich beschützen”, schrie es in mir.
Tausend Ängste stand ich aus.
Während der Fahrt probierte ich vor lauter Panik, ob die Tür aufgeht, damit ich es am Bahnhof schaffe, auszusteigen und nicht bis zur nächsten Stadt mitfahren muss. Denn dort hätte ich nicht gewusst, welcher Zug zurück nach Hause fährt. Außerdem hatte ich keinen Pfennig mitbekommen und hätte keine Fahrkarte für die Rückfahrt kaufen können. Schwarzfahren kam für mich nicht infrage, denn das ist ja verboten.
Viele Jahre hatte ich Albträume von Zugfahrten, die ich auf dieses Erlebnis zurückführe.
Es wäre doch eine kinderfreundlichere und erziehungswirksamere Methode gewesen, einfach mitzufahren und mich allein alles ausprobieren zu lassen, mit den aufmunternden Worten: „Siehst du, so einfach ist das. Und wenn die Tür wirklich mal nicht aufgeht, fragst du einfach einen Erwachsenen.”
Meine Eltern hielten es nie für nötig, mit mir über diesen Vorfall zu sprechen. Vielleicht hatten sie mich gar nicht vermisst und sich abends nur gewundert, weil ich schon zu Hause war.
Ich darf gar nicht daran denken, was hätte alles passieren können. Aber die Zack-Zack-Methode ging ja auch auf. Ich Angsthase bin sogar angekommen. Und die Albträume, die sich bei einem Kind daraufhin einstellen könnten, hat man ja nicht selbst. Hauptsache das Kind wird endlich mutiger und selbstbewusster.
Als ich zwölf Jahre alt war, ist mein Opa dann gestorben. Mein Vater sagte zu mir: „Mach das Radio aus, der Opa ist tot.” Den Zusammenhang habe ich nie verstanden. Es gab keine weitere Anteilnahme, nie Gespräche oder Erinnerungen irgendwelcher Art an diesen Mann.
Tot – weg – das war´s.
Vielleicht hatte mein Vater auch keine guten Erlebnisse mit ihm gehabt, aber auch darüber wurde nie gesprochen.
Meine Oma war nach dem Tod ihres Mannes sehr verzweifelt. Sie hatte nur noch einen Wunsch – sie wollte so schnell wie möglich zu ihm auf den Friedhof.
Aber so einfach ist das ja nicht.
Oma war total hilflos und statt ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben, ließ sie sich einfach fallen und wollte nicht mehr leben.
Meine Eltern hätten sich eigentlich um sie kümmern müssen, denn mein Vater hatte keine Geschwister, auf die er die Verantwortung abwälzen konnte.
Sie fuhren manchmal zu ihr, um zu gucken, ob sie noch lebt. Aber nur hopp – hopp, und weg waren sie wieder.
Für meine Eltern war es schon immer sehr wichtig, so oft und so lange wie möglich in Urlaub zu fahren. Als ich noch klein war, mussten sie mich meistens mitnehmen und konnten nur während der Schulferien fahren.
Um das, was ich erlebt habe, beneideten mich einige Freundinnen. Hätten sie gewusst, wie die schönste Zeit des Jahres für mich abgelaufen ist, hätte sich ihr Neid sicher in Grenzen gehalten.
Früh wurde aufgestanden (spätestens sechs Uhr) und schnell gefrühstückt. Mein Vater wollte ja als erster Urlauber „in der Wand” sein. Wanderungen und Klettereien liefen bis zum späten Nachmittag ohne Diskussionen im Schnelldurchgang ab. Es wurde viel fotografiert, damit wir zu Hause in Ruhe nachsehen konnten, wo wir überall gewesen sind und was wir mit eigenen Augen gesehen hätte, wenn … ja, wenn wir mal eine Pause gemacht hätten.
Niemals wurde ich gefragt, was ich gern unternehmen möchte, denn ich war nur das überflüssige Anhängsel.
„Sei froh, dass wir dich mitgenommen haben, und genieße, was du alles erlebst. Andere Kinder wären dankbar ...”, so die Aussage meines Vaters.
Nach dem Abendessen blieb ich allein im Zimmer zurück, denn sie wollten ja auch irgendwann mal „unter sich” sein, wie sie es nannten. Und außerdem sollte ich zeitig schlafen, um Kräfte zu sammeln, damit der nächste Urlaubstag straff und ohne Pausen abgearbeitet werden konnte.
Einmal begleitete uns ein Ehepaar mit seinen beiden Kindern. Dieser Urlaub war für mich angenehmer, denn ich konnte mit den Kleinen zusammen sein und mit ihnen spielen.
Meine Eltern wurden wieder mal nach Hause gerufen, weil meine Oma krank war.
Sie fuhren allein zurück, und ich wurde in der Zwischenzeit in das Familienleben unserer Bekannten integriert. Als die Frau am Abend nachdenklich zu mir sagte: „Elke, wenn es möglich wäre, würden wir dich adoptieren. Aber leider geht das nicht”, machte mich das erst stolz, später traurig. Ich wusste aber nicht so recht, warum. Zum Glück hatte ich nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, denn meine Eltern waren ganz schnell von dem Abstecher in die Heimat zurück und meine familiäre Ordnung war wieder hergestellt.
War ich erleichtert, als ich endlich alt genug war und nicht mehr mitfahren musste. Und meine Eltern waren froh, weil sie mich nicht mehr mitschleppen mussten und außerhalb der Schulferien fahren konnten. Das nutzten sie reichlich und waren noch öfter unterwegs.
Wenn sie zu Hause weilten, musste ich den Haushalt mit allem Drum und Dran erledigen. Ich bekam meinen Plan, und der musste erfüllt werden.
Um die Hausordnung kümmerte sich meine Mutter jahrelang nicht. Montags, mittwochs und samstags wurde diese von mir erledigt.
Auch die Wäsche wusch ich, aber lieber im Sommer.
Früh stand ich auf, erhitzte Wasser mit einem Tauchsieder, sortierte die Wäsche und rumpelte dann kräftig auf dem Waschbrett. Danach musste alles mehrmals in der Badewanne gespült und mit einer kleinen Tischschleuder vorgetrocknet werden.
Meine Mutter spannte mir die Leine, da ich wegen meiner geringen Körpergröße nicht an die Haken kam. Sie musste jedoch darauf achten, dass die Leine gut durchhing, sonst wäre ich da auch nicht rangekommen.
Wenn Sonne und Wind ihren Dienst getan hatten, konnte ich bereits mittags das Erste abnehmen, bügeln, was zu nähen war, nähen und alles fein säuberlich zusammenlegen.
Ich beeilte mich sehr und schaffte es auch meistens bis Mutti von der Arbeit kam. Sie sollte sich freuen, dass die gesamte Wäsche schrankfertig im Schlafzimmer lag.
Scheinbar war das für sie das Mindeste, was ich in meinen Ferien hätte erledigen können und ganz selbstverständlich, denn sie stellte nur verärgert fest, dass der Abwasch noch nicht weggeräumt war. Und ihr Zeigefinger schnellte wieder einmal in die Höhe.
Das Mittagessen kochte ich auch oft. Das wurde immer einer Gütekontrolle durch meinen Vater unterzogen.
„Wer hat gekocht?!!!”, fragte er kurz und knapp.
Sagte ich, dass ich das gewesen bin, antwortete er abwertend: „Man kann es essen.”
Hatte meine Mutter mal eine Mahlzeit zubereitet, kam die Feststellung: „Lecker Schatz, das ist dir wieder vortrefflich gelungen.”
Einmal habe ich mich versündigt und gelogen und einfach behauptet, dass mein Essen Mutti gemacht hätte.
Da hörte ich dann endlich auch einmal, dass ich vortrefflich kochen kann.
Inzwischen hatte auch meine körperliche Entwicklung eingesetzt.
Meine Mutter vermittelte mir, dass eine gesunde Körperhaltung sehr wichtig ist. Sie schlug mir öfter auf den Rücken und sagte: „Steh gerade, sonst bekommst du einen Buckel!”
Da ich den auf keinen Fall wollte, riss ich schnell meine Schultern nach oben.
Ziemlich früh hatte ich Probleme mit meiner großen Oberweite. Mein Vater fand dafür eine ganz einfache Lösung. Er setzte das Brotmesser an und fragte: „Soll ich die Dinger abschneiden, dann bist du die los?”
Meine Mutter stand neben ihm und grinste.
Damit war ich aber noch nicht genug Demütigungen ausgesetzt. Mein Vater war immer für Überraschungen gut und konnte seine dummen Sprüche sogar steigern.
Einmal sahen wir im Fernsehen einen Bericht über einen Vater, der seine Tochter vergewaltigt hatte. Daraufhin sagte er zu mir: „Da kannst du aber froh sein, was dir erspart geblieben ist.”
Was muss ein Vater für abartige Gedanken haben, um so etwas überhaupt aussprechen zu können?
Im Rückblick kann ich nur feststellen, dass ich nicht sehr einfühlsam und liebevoll auf das Leben vorbereitet wurde.
In meiner Freizeit spielte ich oft mit kleineren Kindern, las ihnen vor oder übte mit ihnen für die Schule. Sie wurden für mich zum Geschwisterersatz und standen voll im Mittelpunkt, sodass sie abends fast nie nach Hause wollten. Bei den Spielen mogelte ich und ließ sie gewinnen, damit sie nicht traurig oder sogar wütend werden und einfach gehen. Dann wäre ich ja wieder allein gewesen. Auf diese Art und Weise konnte ich keinen Ehrgeiz entwickeln und lernte bereits als junges Mädchen, dass es gar nicht schlimm ist, ein Verlierer zu sein – Hauptsache nicht einsam.
Als ich körperlich sowie geistig in der Lage war, eine Zugfahrt allein zu überstehen, fuhr ich öfter zu meiner Oma und leistete ihr Gesellschaft.
Sie baute schnell ab, hatte immer öfter Schwindelanfälle. Einmal war sie gestürzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Krampfhaft versuchte ich, meine Eltern auf einem Zeltplatz in der Ferne zu erreichen, um ihnen diese Mitteilung zu machen. Diese Situation überforderte mich einfach, wurde mir ja nie gezeigt und vorgelebt, wie man sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmert.
Meine Eltern kamen angehetzt, fuhren ins Krankenhaus, sprachen mit dem Arzt, gingen ins Krankenzimmer und fragten Oma: „Wie geht es dir?”
Sie sagte, dass sie nach Hause will, denn die Krankenschwestern wären nicht gut zu ihr, würden sie sogar schlagen.
Wir sahen, dass Oma ans Bett gefesselt war, und meine Eltern waren scheinbar fest davon überzeugt, dass sie in guten Händen ist und ihr überhaupt nichts passieren kann.
Ich kann mich nicht erinnern, dass sie sich beschwert oder versucht hätten, an dieser Situation etwas zu ändern.
Sie fuhren anschließend in Omas Wohnung, um den Kühlschrank abzustellen, danach gingen sie in den Stall, schlachteten alle Hühner ab und verarbeiteten diese, denn sie wollten ja nichts verkommen lassen.
Und das alles an einem Tag. Uffz.
Danach eilten sie sofort in den Urlaub zurück, damit sie keine Erholung versäumten.
Mit meinen Sorgen um Oma blieb ich wie immer allein zurück.
Sechs Jahre musste sie sich quälen, bis sie meinem Opa endlich auf den Friedhof folgen konnte.
Jahre später erfuhr ich von einer Freundin, die zu dieser Zeit Gemeindeschwester im Dorf meiner Oma war, dass sie sich um sie gekümmert hatte.
Ich musste sie einfach fragen: „Wann hast du eigentlich meine Eltern kennengelernt?”
„Erst als deine Oma gestorben war. Vorher habe ich die nie gesehen”, lautete ihre Antwort.
Ich staunte nicht schlecht. Meine Eltern haben es nicht einmal geschafft, zu Lebzeiten meiner Oma, mit der Krankenschwester Kontakt aufzunehmen.
Vielleicht waren meine Großeltern auch nur adoptiert?
Wir fuhren immer noch gern ins Kinderferienlager, obwohl fast alle schon in der Pubertät waren.
Eines Tages kam ein großes Paket für meine Freundin an. Ihre Mutter, die gute Genossin, die als Lehrerin in der Schule immer pflichtbewusst gegen den bösen Westen wetterte, hatte ihr die Überraschungen von der Tante aus Wiesbaden umgehend weitergeschickt.
Wahrscheinlich sollte die Tochter nicht auf ihre Gummibärchen verzichten müssen.
Oder sollte das Zeug nichts taugen und schnell verderben? So wurde es uns ja ständig erzählt.
Meine Freundin saß wie eine Prinzessin auf ihrem Bett, hatte den gesamten Paketinhalt vor sich ausgebreitet und ließ sich huldigen. Denn die meisten Kinder hatten kein Glück, so etwas Besonderes jemals zu bekommen.
Sie schnüffelten den herrlichen Duft ein, guckten neidisch und bemühten sich sehr, ganz nett zu ihr zu sein, um wenigstens eine Kleinigkeit zu ergattern.
„Ihre Mutter muss ganz schön unsensibel sein”, dachte ich.
In meinen Zeugnissen stand: „Elke muss lernen, ihre Meinung zu sagen.”
Die sagte ich aber lieber nicht.