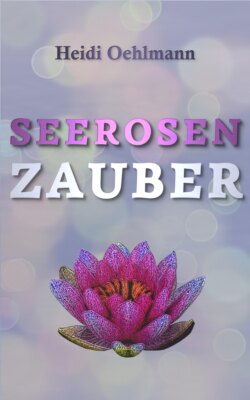Читать книгу Seerosenzauber - Heidi Oehlmann - Страница 3
1. Maja - Freitag
Оглавление»Nein«, grummle ich verschlafen, als das ohrenbetäubende Klingeln meines Handyweckers ertönt.
Als ich damals den Rufton eingestellt hatte, fand ich ihn perfekt. Seitdem bereue ich es jeden Morgen, wenn mich dieser Lärm um Punkt acht Uhr aus dem Schlaf reißt.
Ich würde ihn nur allzu gern durch einen weniger nervigen Ton ersetzen, allerdings habe ich Zweifel, ob ich davon auch wach werde.
Hektisch taste ich nach dem Handy, das auf meinem Nachttisch liegt, und tippe auf dem Display herum.
Nachdem der Klingelton endlich verstummt, atme ich erleichtert auf und überwinde mich, die Augen zu öffnen.
Ich springe aus dem Bett und schleiche nach unten. Im Haus herrscht eine angenehme Stille.
Mein erster Weg führt mich in die Küche zur Kaffeemaschine, die nur noch eingeschaltet werden muss. Im Laufe der Zeit habe ich mir angewöhnt, sie am Vorabend vorzubereiten. So kann ich mich in meine Sportklamotten werfen, bis der Kaffee durchgelaufen ist.
***
Eine halbe Stunde später verlasse ich mit Koffein im Blut das Haus. Wie jeden Morgen laufe ich langsam zum Park. Unterwegs begegnen mir täglich die gleichen gestressten Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Mein Arbeitstag beginnt in etwas mehr als zwei Stunden.
Im Park ist von der Hektik nichts zu spüren. Es ist, als würde man eine neue Welt betreten. Bis auf ein paar andere Jogger und wenige Hundebesitzer, die ihre vierbeinigen Lieblinge ausführen, bin ich allein und genieße die frische Morgenluft. Der kleine See liegt friedlich vor mir. Die Blüten der zahlreichen Seerosen sind noch halb geschlossen. Sie öffnen sich langsam und werden ihre volle Pracht erst zeigen, wenn ich den Park längst verlassen habe. Leider verpasse ich den Seerosenzauber an den meisten Tagen.
Ich erhöhe mein Tempo und versinke in meinen Gedanken. Wie so oft träume ich von meinem eigenen Restaurant. Ich male mir bis ins kleinste Detail aus, wie es aussehen soll und welche Gerichte ich unbedingt auf die Speisekarte setzen will. Jedes Mal sieht mein Laden anders aus und auch die Speisen variieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass es mir schwerfällt, mich zu entscheiden. Natürlich macht das keinen Unterschied, weil es sich um einen Traum handelt, der noch lange nicht greifbar ist.
Seit ich denken kann, will ich nur kochen. Zu einem kleinen Teil konnte ich mir den Traum schon erfüllen. Die Ausbildung zur Köchin habe ich abgeschlossen und arbeite nun in einer Küche. Leider habe ich dort nichts zu melden. Ich bin nur eine von vielen, die Anweisungen befolgen muss. Kreativ ist nur der Küchenchef. Er ist der Einzige, der neue Rezepte entwickeln darf. Wir anderen müssen seine Kreationen nach Anweisung zubereiten. So hatte ich mir meinen Traumjob nicht vorgestellt. Dafür ist die Bezahlung anständig und bringt mich meinem Traum ein Stück näher. Jeden Monat lege ich einen Großteil meines Gehalts zur Seite. Zum Glück muss ich keine Miete bezahlen, da ich im Haus meiner Großeltern lebe.
Ich bleibe stehen, schaue in den Himmel und seufze. Der Mensch, dem ich meine Leidenschaft zum Kochen verdanke, wird das alles nicht mehr miterleben. Meine Oma ist vor acht Jahren an Herzversagen gestorben. Nichts hatte darauf hingedeutet. Im Gegenteil. Anneliese Blum war einer der fittesten Menschen, die ich kannte. Von ihr konnte sich so manch einer der jüngeren Generationen eine Scheibe abschneiden. Sie war wie ein Wirbelwind.
Ich liebte es, mit ihr zusammen in der Küche zu stehen. Trotz meiner Lehre lernte ich von ihr noch einige Kniffe. Ihre Rezepte waren einzigartig. Bereits als kleines Mädchen faszinierte es mich, ihr dabei zuzusehen, wie sie uns die leckersten Speisen zubereitet hatte.
Bei dem Gedanken an unsere gemeinsame Zeit kommen mir die Tränen.
Bevor ich sie mir von den Wangen wischen kann, werde ich hart zur Seite gestoßen. Ich falle hin. Zum Glück ist der Aufprall gedämpft, da ich im Gras lande.
Ich schaue mich nach dem Übeltäter um, in der Erwartung jemand würde mit schuldbewusster Miene vor mir stehen und sich für sein Verhalten entschuldigen. Doch da ist keiner, zumindest nicht in meiner unmittelbaren Nähe.
Ich kann nur die Rückansicht eines Joggers erkennen, der sich von mir entfernt. Sonst sehe ich niemanden. Also muss er mich zur Seite gestoßen haben.
»Hey, du Idiot!«, brülle ich ihm hinterher.
Doch er reagiert nicht. Entweder hat er mich nicht gehört oder er ignoriert mich konsequent.
Kopfschüttelnd schaue ich ihm nach, bis er aus meinem Sichtfeld verschwunden ist.
Wütend erhebe ich mich und untersuche meinen Körper auf Verletzungen. Bis auf ein paar Grasflecken auf der Hose scheine ich unbeschadet davon gekommen zu sein.
Um sicherzugehen, lege ich die ersten Meter langsam zurück, bevor ich wieder in einen Laufschritt verfalle und mein Tempo wiederfinde.
Gedankenverloren laufe ich weiter, bis ich an einer Bank einen Jogger wahrnehme, der dabei ist, sich zu dehnen.
Seine Kleidung kommt mir bekannt vor. Er trägt die gleiche schwarze Hose und ein T-Shirt im identischen Blauton, wie der Flegel, der mich vor wenigen Minuten zur Seite gestoßen hat. Auch seine Rückansicht stimmt überein.
Wutentbrannt stürme ich auf ihn zu, stemme meine Hände in die Hüften und schreie ihn an. »Was stimmt mit Ihnen nicht? Erst schubsen Sie Menschen um und dann halten Sie es nicht für nötig, sich zu entschuldigen! Ich hätte mir sonst was brechen können und Sie hätten mich einfach da liegen lassen. Schämen sollten Sie sich!« Mir liegen noch sämtliche Schimpftiraden auf der Zunge, die ich abfeuern möchte, doch als der Typ sich umdreht, verstumme ich. Er ist der bestaussehende Kerl, der mir je begegnet ist. Seine braunen Augen mustern mich von Kopf bis Fuß. Es fühlt sich an, als würde ich nackt vor ihm stehen.
Während er mich betrachtet, tue ich es ihm gleich und lasse meine Augen über seinen muskulösen Körper wandern. Ich schaffe es gerade noch, ein entzücktes Seufzen zu unterdrücken.
Dem Fremden ist sein gutes Aussehen durchaus bewusst. Er schenkt mir ein wissendes Grinsen, bevor er den Mund öffnet. »Reden Sie mit mir?«, fragt er scheinheilig.
Ich atme tief durch und sammle mich. »Sehen …«, piepse ich.
Das ermutigt den Kerl, noch breiter zu grinsen.
Seine Arroganz macht mich wütend.
Ich räuspere mich und setze zu einem neuen Versuch an. »Sehen Sie hier noch jemanden?«, frage ich mit fester Stimme. »Sie haben mich da hinten«, ich deute mit dem Finger in die Richtung, aus der ich gekommen bin, »einfach umgestoßen und sind weitergelaufen, als ob nichts geschehen wäre! Wollen Sie das jetzt etwa abstreiten?«
»Nein, ich will gar nichts abstreiten.«
»Also geben Sie es zu?«, frage ich verwundert.
»Nein.«
Ich starre ihn ungläubig an. »Sondern?«
»Nichts. Ich muss mich für nichts rechtfertigen, was ich nicht getan habe«, antwortet er noch immer grinsend.
Für einen Moment bin ich unsicher, ob er wirklich der Täter ist. Allerdings glaube ich nicht an Zufälle. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es zwei Typen von dieser Sorte gäbe. Doch ich habe keine Beweise für das, was er getan hat. Zeugen gab es keine. Also steht Aussage gegen Aussage. Somit ist es sinnlos weiter mit ihm zu diskutieren.
Wutschnaubend straffe ich die Schultern und gehe wortlos an dem Typen vorbei. Ich spüre seinen Blick in meinem Rücken. Es fühlt sich unangenehm an. Damit ich seinen Blicken schneller entkommen kann, beschleunige ich mein Tempo in einen ordentlichen Laufschritt.
Obwohl meine Joggingrunde eigentlich noch nicht beendet ist, beschließe ich den Heimweg anzutreten. Ich will raus aus dem Park.
Ich nehme den nächsten Pfad, der aus dem Park auf die Straße führt, und quäle mich durch die überfüllten Straßen. Zwischendurch muss ich etlichen Menschen ausweichen.
***
»Guten Morgen, meine Kleine!«, begrüßt mich mein Großvater, als ich wenig später die Küche betrete.
Er sitzt bereits am Küchentisch und schlürft seinen ersten Kaffee.
»Morgen, Opa«, erwidere ich, während ich zu ihm gehe und ihm einen Kuss auf die Wange gebe.
»Du bist aber heute früh zurück«, stellt er fest. »Ist alles in Ordnung?« Er schaut mich mit einer Mischung aus Neugier und Sorge an.
»Ja, es ist alles gut. Ich wollte vor der Arbeit nur noch etwas erledigen«, rede ich mich raus.
Ich kann meinem Großvater ansehen, dass er mir nicht glaubt, doch er sagt nichts. Er kennt mich eben gut genug und weiß, wie sinnlos es ist, mich in die Enge zu treiben.
»Wo ist Waldi?«, frage ich, um vom Thema abzulenken.
»Ich schätze, in seinem Körbchen.«
Ich nicke wissend.
»Warst du mit ihm draußen?«, erkundige ich mich.
»Ja.«
Ich weiß, dass die beiden nur vor der Tür waren. Wenn Waldi nicht gerade in der Küche ist, um zu fressen, schläft er am liebsten. Der Dackel ist mit seinen elf Jahren nicht mehr der Jüngste und das zeigt er auch. Früher konnte ich mit ihm stundenlang spazieren gehen. Inzwischen bin ich froh, ihn überhaupt nach draußen zu bekommen, damit er sein Geschäft verrichtet. Ab und zu lässt er sich zu einer winzigen Gassirunde überreden, aber nur, wenn die Bedingungen stimmen. Es darf nicht regnen oder zu kalt sein.
»Ich springe schnell unter die Dusche«, sage ich und haste die Treppe nach oben.
»Gut, ich mache uns Frühstück«, ruft mein Opa mir hinterher.
Normalerweise hat er den Tisch bereits gedeckt, wenn ich vom Joggen zurück bin. Das hat sich im Laufe der Zeit so ergeben. Früher hatte meine Oma das Frühstück für uns gemacht. Nach ihrem Tod habe ich es eine Weile übernommen. Doch irgendwann hat mein Opa sich der Sache angenommen. Er meint, ich hätte genug zu tun und er bräuchte auch ein paar Aufgaben. Also überließ ich es ihm. Im Grunde bin ich über jede Kleinigkeit froh, die er mir abnimmt. Inzwischen ist er mit seinen 79 Jahren nicht mehr der Jüngste. Leider macht sich das immer häufiger bemerkbar. In den letzten Jahren ist er ziemlich vergesslich geworden.
Ich habe schon mehrfach versucht, ihn zum Arzt zu schleppen, aber er weigert sich konsequent. In dem Punkt ist mein Opa August stur, wie ein Maulesel. Er meint, dass alles kommt, wie es kommen muss und die Menschen früher auch nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gegangen sind.
Meine Argumentation interessiert ihn nicht. Obwohl es sinnlos ist, gebe ich nicht auf und versuche, ihn in regelmäßigen Abständen zu einem Arztbesuch zu überreden.
***
»Ich muss los«, sage ich erschrocken, als ich einen Blick auf meine Armbanduhr werfe. In einer halben Stunde muss ich auf der Arbeit sein. Da das Restaurant auf der anderen Seite der Stadt liegt, wird es knapp, rechtzeitig zu meiner Schicht anzukommen.
Beim Thema Pünktlichkeit versteht der Küchenchef keinen Spaß. Er ist generell ein humorloser Mensch. Seit ich ihn kenne, habe ich ihn noch nie lächeln sehen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob er dazu überhaupt in der Lage ist. Dafür ist Schreien eine Disziplin, die er perfekt beherrscht. Er brüllt jeden in seiner Küche an, selbst um jemandem etwas mitzuteilen. Als ich in dem Laden anfing, war der Umgang viel herzlicher. Der ehemalige Chef Bill wurde niemals laut, sogar wenn jemand den größten Mist gebaut hatte, blieb er ruhig. Mit ihm zu arbeiten hatte mir immer Spaß gemacht. Deshalb war ich glücklich, dass er mich nach der Lehre als Köchin eingestellt hatte.
Leider ist er vor einem Jahr in Rente gegangen. Ich hätte den Laden gerne übernommen. Nur fehlte mir das nötige Kleingeld, um ihm alles abzukaufen. Also musste er sich nach einem anderen Käufer umsehen. Es gab nicht allzu viele Interessenten. Am Ende war Bill froh, als Eduard auftauchte und das Restaurant übernahm. Mit ihm wechselte nicht nur der Name von Bills Gasthaus in Eduards. Auch die Küche änderte sich von einer bodenständigen in eine gehobene.
Obwohl Eduard so ein Griesgram ist, lieben die Gäste seine Kochkünste. Von seinem ersten Tag an war das Restaurant besser besucht als bei Bill.
Erst vermutete ich, die Leute würden aus Neugier kommen. Vielleicht taten sie es auch, aber da der Ansturm bis heute so geblieben ist, muss es an der Küche liegen.
Selbst der angrenzende Saal ist dauerhaft ausgebucht. Die Leute feiern dort Geburtstage, Hochzeiten und Jubiläen. So weit ich zurückdenke, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es unter Bills Herrschaft jemals so gewesen war. Wenn es zwei Buchungen im Monat gab, war es schon viel.
Mittlerweile wird der Saal sogar wochentags gebucht. Das gab es früher nie.
Ich erhebe mich, verpasse meinem Opa einen Kuss auf die Wange und stürze aus dem Haus. Zum Glück läuft mein Wagen wieder, sodass ich nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin.
In der letzten Woche stand mein kleines in die Jahre gekommenes Auto in der Werkstatt und ich verbrachte viel Zeit an Bushaltestellen. Mein Arbeitsweg hatte wesentlich länger gedauert. Gefühlt gibt es Hunderte von Haltestellen, die der Busfahrer von einem Ende der Stadt bis zum anderen Ende ansteuert. Auch das Einkaufen war anstrengend. Nicht nur, weil die Bushaltestelle ein Stück vom Supermarkt entfernt ist. Es ist auch gewöhnungsbedürftig, die Einkäufe mit sich rumschleppen zu müssen, statt sie einfach auf dem Supermarktparkplatz in den Kofferraum zu räumen und sie vor der Haustür wieder rauszuholen.
Der KFZ-Mechaniker hatte mir mitgeteilt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis mein Auto erneut liegen bleibt. Er hatte mir zuvor schon von einer Reparatur abgeraten. Aber der Kauf eines neuen Autos kostet Geld. Es würde meine Ersparnisse schmälern. Natürlich werde ich irgendwann ein anderes Auto anschaffen müssen. Spätestens, wenn ich selbstständig bin, brauche ich ein zuverlässiges Fahrzeug.
Wenn ich ehrlich bin, versuche ich die Neuanschaffung so lange hinauszuzögern, wie es geht, da es sich bei dem schrottreifen Gefährt um mein erstes Auto handelt. Ich habe es damals von meinen Großeltern geschenkt bekommen. Meine Oma hatte es hauptsächlich ausgesucht. Das macht mir die Trennung besonders schwer. Es ist, als würde ich einen Teil von ihr mit dem Fahrzeug zusammen weggeben.
Ich starte den Motor und bin erleichtert, als mein Wagen gleich beim ersten Versuch anspringt.
***
»Schön, dass du auch schon kommst!«, schreit mich Eduard an, als ich in Küchenmontur die Küche betrete.
Ich sage nichts. Immerhin hat meine Schicht vor fünf Minuten begonnen.
Dafür, dass auf den Straßen heute so viel los war, bin ich relativ gut durchgekommen. Hätte ich mich nicht noch umziehen müssen, wäre ich rechtzeitig in der Küche gewesen.
Am liebsten möchte ich Eduard für seine Kleinlichkeit in die Schranken weisen. Aber ich verkneife es mir. Eduard hat nicht nur seine Prinzipien, gleichzeitig fällt es ihm schwer, Kritik einzustecken.
Vor einigen Monaten beschwerte sich ein Gast. Er meinte, sein Fisch wäre noch roh. Statt sich bei ihm zu entschuldigen, diskutierte Eduard so lange mit ihm, bis er entnervt das Restaurant verließ. Als Köchin weiß ich, dass der Gargrad so gewollt war, aber ich verstehe auch, wenn Menschen ihren Fisch richtig durchgegart haben wollen. Geschmäcker sind eben verschieden.
Die meisten Kellner versuchen, die Kritik von unserem Küchenchef fernzuhalten. Das funktioniert allerdings nur so lange, wie der Gast keine Nachbesserung fordert. Wenn ein voller Teller zurück in die Küche gebracht wird, bekommt Eduard das mit. Er kann noch so beschäftigt sein, das entgeht ihm nie. Es ist fast, als hätte er ein Radar dafür, der anschlägt, sobald etwas nicht stimmt.
Ich stehe vor ihm und schaue betreten zu Boden.
»Was ist? Brauchst du eine Extraeinladung? Oder schaffst du es an deinen Arbeitsplatz?« Er deutet mit dem Messer in seiner Hand auf die andere Seite der Küche.
Statt einer Antwort nicke ich ihm zu und eile davon.
Bevor der Betrieb richtig losgeht, müssen sämtliche Vorbereitungen getroffen werden. Das sind die Momente, in denen ich mir vorkomme, als wäre ich eine Küchenhilfe statt einer ausgebildeten Köchin. Wie jeden Tag liegt auf meinem Arbeitsplatz jede Menge Gemüse, das geschnippelt werden muss.
Neben mir steht mein Kollege John und ist dabei, Fisch zu filetieren.
Er schaut zu mir und nickt mir mitleidig zu, bevor er sich wieder seiner Arbeit widmet.
Wir trauen uns beide nicht, während der Arbeitszeit zu reden. Eduard sieht es überhaupt nicht gern, wenn in seiner Küche Privatgespräche stattfinden. Ein »Wie geht es dir?« ist ihm schon zu viel. Wenn seine Köche miteinander sprechen, dann darf es nur um berufliche Dinge gehen, dabei sollte möglichst laut geredet werden, damit der Küchenchef auch alles mitbekommt.
Private Gespräche müssen wir uns für die Pausen aufheben.
Das Arbeitsklima ist rau, wenn Eduard da ist. Und er ist so gut wie immer in der Küche. Er kommt vor uns und geht erst nach uns. Manchmal habe ich den Verdacht, er schläft hier. Vielleicht hat er in irgendeinem Regal einen Schlafsack versteckt, den er hervor holt, sobald wir weg sind. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er fast täglich eine neue Kreation auffährt. Während des Kundenzulaufs kommt er kaum zum Experimentieren. Das geschieht immer nach Ladenschluss. Die Köche müssen am nächsten Tag vor Dienstbeginn seine neuesten Experimente bewerten. Manches ist wirklich sehr lecker, aber die meisten seiner Schöpfungen sind eher gewöhnungsbedürftig.
Durch meine Verspätung bin ich wohl um ein Urteil herumgekommen. Die anderen werden die Verkostung bereits hinter sich gebracht haben.
Normalerweise bin ich eine Viertelstunde vor Dienstantritt hier. Heute bin ich das erste Mal zu spät gekommen. Ich weiß nicht, warum ich die Zeit beim Frühstück aus den Augen verloren hatte. Vielleicht liegt es an dem Sturz, der mir von diesem arroganten Fremden beschert wurde.
»Maja!«, lässt mich eine laute Männerstimme an meinem Ohr zusammenzucken. Obwohl ich mir angewöhnt habe, in der Küche Ohrenstöpsel zu tragen, ist die Stimme des Küchenchefs immer noch deutlich genug, um mich zu erschrecken. Wenn ich mir nichts in die Ohren stecken würde, wäre ich längst taub. Den Tipp hat mir John gegeben. Er benutzt die Dinger seit dem zweiten Tag.
Ich drehe mich ruckartig um und sehe Eduard mit einem Teller vor mir stehen.
Am liebsten möchte ich ihn schütteln und ihn genauso ins Ohr schreien, wie er es bei mir gemacht hat. Nur wird es ihm nichts ausmachen. Er wird im Laufe der Zeit durch seine eigene Stimme taub geworden sein. Auf Dauer kann diese Schreierei niemand aushalten.
Ich setze ein gequältes Lächeln auf und starre auf den Teller. Darauf liegt …
Nun ja, was ist das eigentlich?
Zwischen zwei hellgrünen biskuitartigen Schichten befindet sich eine weiße Creme.
Eduard nickt mir aufmunternd zu. »Probier!«, fordert er mich lautstark auf.
Zaghaft greife ich nach dem quadratischen Etwas und schnüffele daran. Es fällt mir schwer, die Gerüche zuzuordnen.
Vorsichtig beiße ich ein Stück ab und kaue darauf herum. Das Grüne fühlt sich im Mund tatsächlich an wie Biskuit. Die weiße Masse ist zäh, wie Schmelzkäse ohne Schmelz und so schmeckt es auch.
Eduard schaut mich erwartungsvoll an.
Ich zwinge mich zu einem Lächeln und beiße noch ein Stück ohne die Creme ab. »Brokkoli?«, stelle ich fragend fest.
Eduard nickt mir aufmunternd zu.
»Ein Brokkoli-Biskuit mit Käse-Creme?«, rate ich.
Eduard klatscht freudig in die Hände. »Und?«, fragt er.
Ich überlege, wie ich ihm die Wahrheit möglichst schonend beibringen kann, ich darf nicht allzu viel Kritik ausüben.
»Na ja, das Biskuit ist angenehm im Mund. Der Geschmack ist …« Durch meinen Kopf rattern verschiedene Adjektive.
Abartig. Ekelhaft. Widerlich. Unnütz. Ungenießbar. Eigenartig. Merkwürdig.
Alle Adjektive klingen zu kritisch. Ich muss sie abmildern, ohne die Bedeutung aus den Augen zu verlieren.
Ungewohnt. Außergewöhnlich. Ungewöhnlich.
Eduard schaut mich immer noch fragend an.
Aus den Augenwinkel kann ich Johns mitleidigen Blick sehen.
Ich drehe meinen Kopf ein Stück weiter in seine Richtung. Meine Augen flehen ihn um Hilfe an.
Doch John deutet nur ein Kopfschütteln an.
»Exotisch«, rutscht es aus meinem Mund, bevor ich genauer darüber nachdenken kann. »Ein bisschen wie Brokkolikuchen. Und die Füllung schmeckt nach Schmelzkäse. Sie könnte noch etwas weicher sein«, wage ich zu sagen.
Eduard schaut mich nachdenklich an. »Exotisch? Brokkolikuchen? Weicher?«, murmelt er vor sich hin, allerdings so laut, dass es in der ganzen Küche zu hören ist.
Er dreht sich von mir weg und geht kopfschüttelnd zurück zu seinem Platz.
John grinst mich an. »Gut gemacht«, formt er mit seinem Mund, ohne auch nur einen Ton zu verlieren.
Ich zucke mit den Achseln und widme mich den Auberginen, die vor mir liegen und in Scheiben geschnitten werden wollen.
***
»Ernsthaft, Maja?«, fragt Maike leise lachend, nachdem John mein Testurteil zum Besten gegeben hat. »Exotisch?«
Wir stehen zu viert im Hinterhof und genießen unsere Verschnaufpause nach dem Mittagsansturm. Leider können nur zwei aus der Küche und zwei der Servicemitarbeiter gleichzeitig Pause machen. Ein Teil der Crew muss immer bereitstehen, weil vereinzelt Gäste kommen und Vorbereitungen getroffen werden müssen.
Meist verbringe ich meine Pausen mit John. Mit ihm verstehe ich mich von allen aus der Küche am besten. Heute sind Maike und Charlotte aus dem Service dabei.
»Was habt ihr denn gesagt?«, frage ich neugierig.
Charlotte ist anzusehen, wie unangenehm es ihr ist. Jeder weiß, was sie gesagt hat. Sie traut sich nie, ehrlich zu sein und sagt immer, es wäre gut.
Maike grinst. »Ungewöhnlich«, antwortet sie. Das ist ihre Standardantwort, wenn es ihr nicht schmeckt und sie ein Testurteil abgeben muss.
»War ja klar«, antworte ich grinsend und drehe mich zu John. »Was hast du gesagt?«
Sein Grinsen wird breiter. »Ich habe es als Brokkolisandwich mit zäher Käsefüllung bezeichnet.«
Ich pruste los. »Oh Gott, das hat ihm sicher nicht gefallen.
»Nicht wirklich, aber exotisch finde ich auch gut.«
Ich lächle. »Mir fiel kein anderes Adjektiv ein, was die Abscheulichkeit ausdrückt, dabei aber nicht kritisch ist.«
»Egal, das landet sowieso nicht auf der Karte. Spätestens, wenn sein Manfred ihm die Wahrheit sagt, ist das vergessen.«
Ich nicke zustimmend.
Manfred ist der einzige Mensch, der sich traut Eduard die Wahrheit unverblümt an den Kopf zu knallen. Als Eduards Lebensgefährte ist er dafür auch privilegiert. Leider ist er nie der Erste, der Eduards Kreationen probiert, sonst würden uns so einige Kuriositäten erspart bleiben.
Ich muss allerdings zugeben, dass ihm hin und wieder richtige Leckereien gelingen, die dann auf der Karte landen. Für meinen Geschmack sind diese Geschmacksexplosionen viel zu selten.
Wie aus dem Nichts taucht unser Azubi Josef auf. Seine Miene ist ernst. Er schaut von einem zum anderen und bleibt bei mir hängen.
»Was ist los?«, frage ich.
»Der Chef …«, stammelt Josef.
»Was ist mit ihm?«, erkundigen John und ich uns wie aus einem Mund.
»Er hatte einen Unfall.«
»Was er war doch gerade noch …«, sage ich und deute mit der Hand in Richtung Gebäude.
»Ja, als ihr rausgegangen seid, war er im Büro und ist auf die Leiter gestiegen …«
»Auf das alte Holzteil?«, unterbreche ich ihn.
»Und?«, hakt Maike nach.
»Sie ist unter ihm zusammengebrochen und er ist gestürzt.«
»Oh mein Gott«, quietscht Charlotte.
»Wie geht es ihm?«, erklingt meine Stimme piepsend.
»Die Sanitäter sind gerade bei ihm.«
Ich nicke.
Josefs Blick hält mich gefangen.
Ich spüre, dass er mir etwas sagen will, was mir nicht gefallen wird.
»Du sollst ihn vertreten«, sagt Josef leise.
»Was?«, frage ich mit einer Stimme, die mir fremd vorkommt. »Ich?«
»Ja, du sollst ihn vertreten, bis er aus dem Krankenhaus zurück ist.«
»Ist er noch drin?«, erkundige ich mich. Statt auf Josefs Antwort zu warten, bin ich schon auf dem Weg ins Gebäude.
»Wo ist er?«, rufe ich, als ich die Küche betrete.
Eileen, eine der Küchenhilfen deutet mit dem Kopf auf das Büro.
Ich haste hinein.
Eduard liegt auf dem Boden und stöhnt. Vor ihm hocken zwei Sanitäter.
»Wie geht es dir?«, frage ich.
Eduard schaut zu mir auf und zuckt mit den Schultern. »Du musst mich vertreten! Du bist die Einzige, der ich vertraue.«
Das erste Mal, seit ich ihn kenne, ist seine Stimme leise. Na ja, eigentlich spricht er in einer normalen Lautstärke. Für seine Verhältnisse ist es aber leise.
Ich starre ihn mit offenem Mund an. »O-Okay«, stammle ich. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. »Wie lange muss unser Chef im Krankenhaus bleiben?«, wende ich mich an die Sanitäter.
»Das können wir Ihnen noch nicht sagen«, antwortet der eine, während sie Eduard auf die Trage hieven.
»Soll ich Manfred informieren?«, hake ich nach.
Eduard schlägt sich eine Hand gegen die Stirn. »Ja, das wäre toll. Aber Maja?«
»Ja?«
»Bitte bring es ihm schonend bei! Er soll sich nicht aufregen!«
»Okay, das mache ich«, antworte ich und schaue dem Küchenchef und den Sanitätern nach, wie sie das Büro verlassen.
Ich starre eine Weile auf die Tür, um die Informationen zu verarbeiten. Es ist schwer zu begreifen, dass Eduard nun auf unbestimmte Zeit nicht in der Küche sein wird. Seine Worte wollen mein Gehirn nicht so recht erreichen. Er hat mir nie gesagt, was er von mir hält. Ich hätte nie gedacht, sein Vertrauen zu genießen. Er hat mich immer genauso streng behandelt, wie alle anderen. Seine Worte schmeicheln mir und schockieren mich gleichzeitig.
Nach einigen Minuten fange ich mich endlich und eile zum Schreibtisch. Manfreds Nummer ist in der Adresskartei auf dem Tisch. Ich suche die richtige Seite heraus und wähle seine Handynummer.