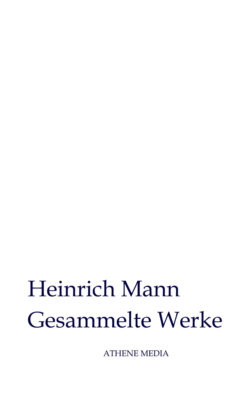Читать книгу Gesammelte Werke - Heinrich Mann - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление„Ich habe mich nun doch entschlossen“, erklärte Buck. „Ich gehe zur Bühne.“
„Und Ihre bürgerliche Stellung? Und Ihre Heirat?“
„Ich habe es versucht, aber das Theater ist vorzuziehen. Es wird dort weniger Komödie gespielt, wissen Sie, man ist ehrlicher bei der Sache. Auch sind die Weiber schöner.“
„Das ist kein Standpunkt“, erwiderte Diederich. Aber Buck war es ernst. „Ich muß zugeben, das Gerücht über Guste und mich hat mir Spaß gemacht. Andererseits: so blödsinnig es ist, es ist nun einmal da, das Mädchen leidet darunter, ich kann sie nicht länger kompromittieren.“
Diederich widmete ihm einen abschätzigen Seitenblick, denn er hatte den Eindruck, Buck nahm das Gerücht zum Vorwand, um sich zu drücken. „Sie werden wohl wissen,“ versetzte er streng, „was Sie da anrichten. Ein anderer nimmt sie jetzt natürlich auch nicht mehr leicht. Es gehört schon verdammt viel ritterliche Gesinnung dazu.“
Buck bestätigte dies. „Für einen wirklich modernen, großzügigen Mann“, sagte er bedeutungsvoll, „müßte [pg 365]es eine besondere Genugtuung sein, ein Mädchen unter solchen Umständen zu sich hinaufzuziehen und für sie einzutreten. Hier, wo auch Geld ist, würde zweifellos der Edelmut zuletzt das Feld behaupten. Denken Sie an das Gottesgericht im Lohengrin.“
„Wieso, Lohengrin?“
Hierauf antwortete Buck nicht mehr; da sie das Sachsentor erreicht hatten, ward er unruhig. „Kommen Sie mit hinein?“ fragte er. – „Wo denn hinein?“ – „Gleich hier, Schweinichenstraße 77. Ich muß es ihr doch sagen, Sie könnten vielleicht –.“ Da pfiff Diederich durch die Zähne.
„Sie sind wirklich –. Sie haben ihr noch nichts gesagt? Vorher erzählen Sie es in der Stadt umher? Ihre Sache, mein Bester, aber mich lassen Sie aus dem Spiel, den Bräuten anderer Leute pflege ich nicht die Verlobung zu kündigen.“
„Machen Sie eine Ausnahme“, bat Buck. „Mir werden Szenen im Leben so schwer.“
„Ich habe Grundsätze“, sagte Diederich. Buck lenkte ein.
„Sie brauchen nichts zu sagen; Sie sollen mir nur in einer stummen Rolle als moralische Unterstützung dienen.“
„Moralisch?“ fragte Diederich.
„Als Vertreter sozusagen des verhängnisvollen Gerüchtes.“
„Was wollen Sie damit sagen?“
„Ich scherze. Da sind wir, kommen Sie.“
Und Diederich, betroffen durch Bucks letzte Wendung, ging wortlos mit.
Frau Daimchen war ausgegangen, und Guste ließ auf sich warten. Buck ging nachzusehen, was sie mache. Endlich kam sie, aber allein. „War nicht auch Wolfgang da?“ fragte sie.
Buck war ausgerissen!
„Das begreife ich nicht“, sagte Diederich. „Er hatte doch etwas ganz Dringendes bei Ihnen vor.“
Hierauf errötete Guste. Diederich wandte sich der Tür zu. „Dann empfehle ich mich auch.“
„Was wollte er denn?“ forschte sie. „Das kommt bei ihm doch nicht oft vor, daß er etwas will. Und wozu bringt er Sie mit?“
„Das sehe ich auch nicht ein. Ich darf sogar sagen, daß ich es entschieden mißbillige, wenn er sich bei einer solchen Gelegenheit Zeugen nimmt. Meine Schuld ist es nicht, adieu.“
Aber je verlegener er sie ansah, desto dringender ward sie.
„Ich muß es ablehnen,“ verriet er schließlich, „daß ich mir mit den Angelegenheiten Dritter soll den Mund verbrennen, noch dazu, wenn der Dritte durchgeht und entzieht sich seinen nächstliegenden Verpflichtungen.“
Gustes aufgerissene Augen sahen die Worte einzeln aus Diederichs Mund hervorkommen. Als das letzte gefallen war, verharrte sie einen Augenblick reglos, und dann warf sie die Hände vor das Gesicht. Sie schluchzte, man sah ihre Wangen aufquellen und die Tränen ihr durch die Finger rinnen. Sie hatte kein Schnupftuch; Diederich lieh es ihr, betreten durch ihren Schmerz. „Schließlich“, meinte er, „ist ja so viel nicht an ihm verloren.“ Da aber empörte sich Guste. „Das sagen Sie! Sie sind derjenige welcher und haben immer gegen ihn gehetzt. Daß er ausgerechnet Sie muß herschicken, das kommt mir mehr wie sonderbar vor.“
„Wie meinen Sie das, bitte?“ verlangte Diederich seinerseits. „Sie mußten wohl reichlich so genau wissen wie ich, geehrtes Fräulein, was Sie von dem betreffenden Herrn zu erwarten hatten. Denn wo die Gesinnung schlapp ist, ist alles schlapp.“
Da sie ihn höhnisch musterte, versetzte er um so strenger:
„Ich habe Ihnen alles richtig vorausgesagt.“
„Weil es Ihnen so paßte“, erwiderte sie giftig. Und Diederich, mit Ironie: „Er hat mich doch selbst angestellt, daß ich seinen Kochtopf sollte umrühren. Und wenn der Kochtopf nicht in braune Lappen eingewickelt gewesen wäre, hätte er ihn schon längst überkochen lassen.“
Da rang es sich los aus Guste. „Haben Sie ’ne Ahnung! Das ist es ja, das kann und kann ich ihm nicht verzeihen, daß ihm immer alles wurscht war, sogar mein Geld!“
Diederich war erschüttert. „Mit so einem soll man sich nicht einlassen“, stellte er fest. „Die haben keinen Halt und laufen einem durch die Finger.“ Er nickte gewichtig. „Wem das Geld wurscht ist, der versteht das Leben nicht.“
Guste lächelte blaß. „Dann verstehen Sie es glänzend.“
„Das wollen wir hoffen“, sagte er. Sie kam näher zu ihm, durch ihre letzten Tränen blinzelte sie ihn an.
„Recht haben Sie ja nun behalten. Was meinen Sie wohl, das ich mir daraus mache?“ Sie verzog den Mund. „Ich hab’ ihn doch überhaupt nicht geliebt. Bloß auf die Gelegenheit hab’ ich gewartet, daß ich ihn loswerde. Nun ist er so gemein und geht von selbst ... Dann machen wir es ohne ihn“, setzte sie hinzu, mit einem verlockenden Blick. Aber Diederich nahm nur sein Schnupftuch zurück, für alles andere schien er zu danken. Guste begriff, daß er noch ebenso streng dachte, wie damals im Liebeskabinett; um so demütiger verhielt sie sich.
„Sie spielen gewiß auf meine Lage an, wo ich nun drin bin.“
Er lehnte ab. „Ich habe nichts gesagt.“ Guste klagte still. „Wenn die Leute Gemeinheiten über mich reden, dafür kann ich doch nicht!“
„Ich auch nicht.“
Guste senkte den Kopf. „Na ja, ich muß es wohl einsehen. So eine wie ich verdient nicht mehr, daß ein wirklich feiner Mann mit ernsten Ansichten vom Leben sie noch nimmt.“ Und dabei schielte sie von unten nach der Wirkung.
Diederich schnaufte. „Es kann auch sein –“, begann er und machte eine Pause. Guste atmete nicht. „Nehmen wir einmal an,“ sagte er mit schneidender Betonung, „jemand hat im Gegenteil die allerernstesten Ansichten vom Leben, und er empfindet modern und großzügig, und im vollen Gefühl der Verantwortlichkeit gegen sich selbst sowohl als gegen seine künftigen Kinder, wie gegen Kaiser und Vaterland übernimmt er den Schutz des wehrlosen Weibes und zieht es zu sich empor.“
Gustes Miene war immer frommer geworden. Sie lehnte die Handflächen aneinander und sah ihn mit schiefem Kopf innig flehend an. Dies schien noch nicht zu genügen, er verlangte offenbar etwas ganz Besonderes: und so fiel Guste plumps auf die Knie. Da nahte Diederich ihr gnädig. „So soll es sein“, sagte er und blitzte.
Hier trat Frau Daimchen ein. „Nanu,“ bemerkte sie, „was ist denn los?“ Und Guste, mit Geistesgegenwart: „Ach Gott, Mutter, wir suchen meinen Ring“, – worauf auch Frau Daimchen sich am Boden niederließ. Diederich wollte nicht zurückstehen. Nach einer Weile stummen Umherkriechens rief Guste: „Hat ihm schon!“ Sie stand entschlossen auf.
„Daß du es nur weißt, Mutter, ich habe mich verändert.“
Frau Daimchen, noch außer Atem, begriff nicht sogleich. Guste und Diederich vereinten ihre Anstrengungen, um sie aufzuklären. Schließlich gestand sie, daß sie selbst, weil die Leute nun einmal redeten, an so etwas schon [pg 369]gedacht habe. „Wolfgang war sowieso ’n bißchen zu miesepeterig, außer er hatte was getrunken. Bloß die Familie, dagegen kommen Heßlings nicht auf.“
Das werde sie sehen, behauptete Diederich; und er kündigte an, daß nichts abgemacht sei, solange das Praktische auch nicht stimmte. Die Ausweise über Gustes Mitgift mußten herbei, dann verlangte er Gütergemeinschaft – und was er nachher mit dem Gelde anfing, da durfte niemand hineinreden! Bei jedem Widerspruch hielt er den Türgriff schon in der Hand, und jedesmal sprach Guste leise und angstvoll zu ihrer Mutter: „Soll denn morgen die ganze Stadt sich den Mund verrenken, weil ich den einen los bin, und der andere ist auch gleich wieder weg?“
Als alles stimmte, ward Diederich jovial. Er aß zu Abend mit den Damen und wollte schon, ohne lange zu fragen, das Dienstmädchen nach dem Verlobungssekt schicken. Dies kränkte Frau Daimchen, denn natürlich hatte sie welchen im Hause, das verlangten die Herren Offiziere, die bei ihr verkehrten. „Überhaupt haben Sie mehr Glück als Verstand, denn den Herrn Leutnant von Brietzen hätte Guste auch gekriegt.“ Darauf lachte Diederich wohlgemut. Alles ging gut. Für ihn das viele Geld, und der Leutnant von Brietzen für Emmi!... Man ward sehr lustig; bei der zweiten Flasche taumelte das Brautpaar auf seinen Stühlen immer einer gegen den anderen, ihre Füße waren umeinandergewickelt bis zum Knie, und Diederichs Hand beschäftigte sich unten. Drüben drehte Frau Daimchen die Daumen. Plötzlich verursachte Diederich ein donnerndes Geräusch und erklärte sofort, er übernehme dafür die volle Verantwortung, es sei in aristokratischen Kreisen üblich, er verkehre bei Wulckows.
Welche Überraschung, als Netzig den Umschwung der Dinge erfuhr! Auf die Erkundigungen der Gratulanten erwiderte Diederich, was er mit den anderthalb Millionen seiner Frau beginnen werde, sei ganz ungewiß. Vielleicht ziehe er nach Berlin, für großzügige Unternehmungen sei es das Angezeigte. Seine Fabrik jedenfalls denke er bei Gelegenheit zu verkaufen. „Die Papierindustrie macht überhaupt eine Krise durch; diese mitten in Netzig gelegene Klitsche hat in meinen Verhältnissen keinen Sinn mehr.“
Daheim gab es eitel Sonnenschein. Die Schwestern erhielten ein erhöhtes Taschengeld, und seiner Mutter gestattete Diederich so viele Rührszenen und Umarmungen, als sie sich irgend wünschen konnte; ja, er nahm willig ihren Segen entgegen. Guste, so oft sie kam, trat in der Rolle einer Fee auf, die Arme voll Blumen, Bonbons, silbernen Beuteln. An ihrer Seite schien Diederich über Blumen zu wandeln. Die Tage entschwebten himmlisch leicht, unter Einkäufen, Sektfrühstücken und den Brautvisiten, einen vornehmen Lohndiener auf dem Bock, und drinnen im Wagen die Verlobten anregend miteinander beschäftigt.
Die schöne Laune, die mit ihrem Dasein spielte, führte sie eines Abends in den Lohengrin. Die beiden Mütter hatten sich dazu verstehen müssen, zu Hause zu bleiben; es war der feste Wille des Brautpaares, der Schicklichkeit zum Trotz allein in einer Proszeniumsloge zu sitzen. Das breite rote Plüschsofa an der Wand, wo man nicht gesehen werden konnte, war eingedrückt und fleckig, es hatte etwas Reizvoll-Fragwürdiges. Guste wollte wissen, daß diese Loge eigentlich den Herren Offizieren gehörte, und daß sie hier Besuche von Schauspielerinnen empfingen!
„Über die Schauspielerinnen sind wir glücklich hinaus“, erklärte Diederich, und er ließ durchblicken, daß er allerdings [pg 371]bis vor kurzem mit einer gewissen Dame vom Theater, die er natürlich nicht nennen könne –. Gustes fieberhafte Fragen wurden rechtzeitig unterbrochen durch das Klopfen des Kapellmeisters. Sie nahmen ihre Plätze ein.
„Hähnisch ist noch wabbeliger geworden“, bemerkte Guste sogleich, und sie nickte nach dem Dirigenten hinab. Er machte auf Diederich einen hochkünstlerischen, wenn auch ungesunden Eindruck. Schwarze, verwirrte Haarsträhnen wippten, indes er mit allen seinen Gliedmaßen den Takt schlug, über seinem großen grauen Gesicht, dessen Fettsäcke mitwippten; und in Frack und Hose wogte es rhythmisch. Im Orchester war großer Betrieb, dennoch gab Diederich zu verstehen, daß er auf Ouvertüren keinen Wert lege. Überhaupt, meinte Guste, wenn man den Lohengrin in Berlin kannte! Der Vorhang ging auf, und schon kicherte sie verachtungsvoll. „Gott, die Ortrud! Sie hat einen Schlafrock und ein Frontkorsett!“ Diederich hielt sich mehr an den König unter der Eiche, der sichtlich die prominenteste Persönlichkeit war. Sein Auftreten wirkte nicht besonders schneidig; Wulckow brachte Baß und Vollbart entschieden besser zur Geltung; aber was er äußerte, war vom nationalen Standpunkt aus zu begrüßen. „Des Reiches Ehr’ zu wahren, ob Ost, ob West.“ Bravo! So oft er das Wort deutsch sang, reckte er die Hand hinauf, und die Musik bekräftigte es ihrerseits. Auch sonst unterstrich sie einem markig, was man hören sollte. Markig, das war das Wort. Diederich wünschte sich, er hätte zu seiner Rede in der Kanalisationsdebatte eine solche Musik gehabt. Der Heerrufer dagegen stimmte ihn wehmütig, denn er glich aufs Haar dem dicken Delitzsch in all seiner verflossenen Bierehrlichkeit. Infolgedessen sah Diederich die Gesichter der Mannen näher an und [pg 372]fand überall Neuteutonen. Sie hatten größere Bäuche und Bärte bekommen und sich gegen die harte Zeit mit Blech gerüstet. Auch schienen nicht alle sich in günstigen Lebensumständen zu befinden; die Edlen sahen aus wie mittlere Beamte des Mittelalters, mit Ledergesichtern und Knickebeinen, die Unedlen noch weniger glänzend; aber der Verkehr mit ihnen wäre unzweifelhaft in tadellosen Formen verlaufen. Überhaupt ward Diederich gewahr, daß man sich in dieser Oper sogleich wie zu Hause fühlte. Schilder und Schwerter, viel rasselndes Blech, kaisertreue Gesinnung, Ha und Heil und hochgehaltene Banner, und die deutsche Eiche: man hätte mitspielen mögen.
Was den weiblichen Teil der Brabanter Gesellschaft betraf, der ließ freilich zu wünschen. Guste stellte spöttische Fragen: welche es denn nun sei, mit der er –. „Vielleicht die Ziege in dem Hängekleid? Oder die dicke Kuh mit dem Goldreifen zwischen den Hörnern?“ Und Diederich war nicht weit davon entfernt, sich für die schwarze Dame mit dem Frontkorsett zu entscheiden, als er noch rechtzeitig bemerkte, daß eben sie in der ganzen Angelegenheit nicht einwandfrei dastand. Ihr Gatte Telramund schien zunächst noch leidlich Komment zu haben, aber eine höchst üble Klatschgeschichte spielte offenbar auch hier mit. Leider war die deutsche Treue, selbst wo sie ein so glänzendes Bild darbot, bedroht von den jüdischen Machenschaften der dunkelhaarigen Rasse.
Beim Auftreten Elsas war es ohne weiteres klar, auf welcher Seite man Klasse voraussetzen durfte. Der biedere König hätte es nicht nötig gehabt, die Sache dermaßen objektiv zu behandeln: Elsas ausgesprochen germanischer Typ, ihr wallendes blondes Haar, ihr gutrassiges Benehmen boten von vornherein gewisse Garantien. Diede[pg 373]rich faßte sie ins Auge, sie sah herauf, sie lächelte lieblich. Darauf griff er nach dem Opernglas, aber Guste entriß es ihm. „Also die Merée ist es?“ zischte sie; und da er vielsagend lächelte: „Einen feinen Geschmack hast du, ich kann mich geschmeichelt fühlen. Die ausgemergelte Jüdin!“ – „Jüdin?“ – „Die Merée, selbstredend, sie heißt doch Meseritz, und vierzig Jahre ist sie alt.“ – Betreten nahm er das Glas, das Guste ihm höhnisch anbot, und überzeugte sich. Na ja, die Welt des Scheins. Enttäuscht lehnte Diederich sich zurück. Dennoch konnte er nicht hindern, daß Elsas keusche Vorahnung weiblicher Lustempfindungen ihn gerade so sehr rührte wie den König und die Edlen. Das Gottesgericht schien auch ihm ein hervorragend praktischer Ausweg, auf die Weise ward niemand kompromittiert. Daß die Edlen sich auf die faule Sache nicht einlassen würden, war freilich vorherzusehen. Man mußte schon mit etwas Außerordentlichem rechnen; die Musik tat das ihre, sie machte einen geradezu auf alles gefaßt. Diederich hatte den Mund offen und so dummselige Augen, daß Guste heimlich einen Lachkrampf bekam. Jetzt war er so weit, alle waren so weit, jetzt konnte Lohengrin kommen. Er kam, funkelte, schickte den Zauberschwan fort, funkelte noch betörender. Mannen, Edle und der König unterlagen alle derselben Verblüffung wie Diederich. Nicht umsonst gab es höhere Mächte.... Ja, die allerhöchste Macht verkörperte sich hier, zauberhaft blitzend. Ob Schwanen- oder Adlerhelm: Elsa wußte wohl, warum sie plumps vor ihm auf die Knie fiel. Diederich seinerseits blitzte Guste an, ihr verging das Lachen. Auch sie hatte erfahren, wie es war, wenn alle einen verklatschten, und den ersten war man los und konnte sich nirgends mehr sehen lassen und hätte überhaupt wegziehen müssen: und [pg 374]da kam der Held und Retter und machte sich aus der ganzen Geschichte nichts und nahm einen doch! „So soll es sein!“ sagte Diederich und nickte auf die kniefällige Elsa hinab – indes Guste, die Lider gesenkt, in reuevoller Unterwerfung gegen seine Schulter fiel.
Das weitere konnte man an den Fingern abzählen. Telramund machte sich einfach unmöglich. Gegen die Macht unternahm man eben nichts. Zu ihrem Repräsentanten Lohengrin verhielt sich sogar der König höchstens wie ein besserer Bundesfürst. Er sang seinem Vorgesetzten die Siegeshymne mit. Der Hort der guten Gesinnung ward schwungvoll gefeiert, die Umstürzler mochten den deutschen Staub von ihren Pantoffeln schütteln.
Der zweite Akt – Guste aß noch immer, sanft hingegeben, Pralinees – brachte zunächst in erhebender Weise den Gegensatz zur Anschauung zwischen dem glanzvollen, ohne Mißton verlaufenden Fest der Gutgesinnten in den vornehm erleuchteten Räumen des Palastes, und den beiden dunkeln Empörern, die stark heruntergekommen auf dem Pflaster lagen. „Erhebe dich, Genossin meiner Schmach“, meinte Diederich bei passender Gelegenheit selbst schon angewendet zu haben. Er verband Ortrud mit gewissen persönlichen Erinnerungen: ein ganz gemeines Luder, darüber war nichts zu sagen; aber irgendwas regte sich in ihm, wenn sie ihren Kerl einwickelte und unter sich hatte. Er träumte.... Vor Elsa, der dummen Gans, mit der sie machte was sie wollte, hatte Ortrud das gewisse Etwas voraus, das die energischen und strengen Damen haben. Elsa freilich konnte man heiraten. Er schielte nach Guste. „Es gibt ein Glück, das ohne Reu“, bemerkte Elsa; und Diederich zu Guste: „Das wollen wir hoffen.“
Den frisch ausgeschlafenen Edlen und Mannen wurde [pg 375]sodann durch den dicken Delitzsch eröffnet, daß sie Dank Gottes Gnade einen neuen Landesfürsten bekommen hatten. Gestern standen sie noch treu und bieder zu Telramund, heute waren sie biedere, treue Untertanen Lohengrins. Sie erlaubten sich keine Meinung und schluckten jede Vorlage. „Den Reichstag bringen wir auch noch so weit“, gelobte Diederich.
Wie aber Ortrud vor Elsa in das Münster treten wollte, empörte sich Guste. „Das hat sie nun nicht nötig, darüber ärgere ich mich immer. Wo sie doch nichts mehr hat, und überhaupt.“ – „Jüdische Frechheit“, murmelte Diederich. Übrigens konnte er nicht umhin, Lohengrin, gelinde gesagt, unvorsichtig zu finden, als er es glatt in Elsas Hand legte, ob er seinen Namen verraten und dadurch das ganze Geschäft in Frage stellen sollte oder nicht. So viel durfte man Weibern nicht zumuten. Und wozu? Den Mannen brauchte er nicht erst zu beweisen, daß er, trotz dem Nörgler Telramund, reine Hände und keinen Fleck auf der Weste habe: ihre nationale Gesinnung war durchaus unverdächtig.
Guste verhieß ihm, im dritten Akt käme das Allerschönste, aber dafür müsse sie durchaus noch Pralinees haben. Als man sie hatte, stieg der Hochzeitsmarsch, und Diederich sang ihn mit. Die Mannen im Festzuge verloren entschieden ohne Blech und Banner, auch Lohengrin hätte sich besser nicht im Wams gezeigt. Diederich ward bei seinem Anblick wieder einmal von dem Wert der Uniform durchdrungen. Die Damen waren glücklich fort, mit ihren Stimmen wie saure Milch. Aber der König! Er konnte nicht wegfinden von dem Brautpaar, biederte sich an und schien am liebsten als Zuschauer dableiben zu wollen. Diederich, dem der König schon immer zu konziliant gewesen war für diese harte Zeit, nannte ihn jetzt einfach eine Nulpe.
Endlich fand er die Tür, Lohengrin und Elsa machten sich auf dem Sofa an die „Wonnen, die nur Gott verleiht“. Zuerst umschlangen sie sich nur oben, die unteren Körperteile saßen nach Möglichkeit voneinander entfernt. Je mehr sie aber sangen, um so näher rutschten sie heran, – wobei ihre Gesichter sich häufig auf Hähnisch richteten. Hähnisch und sein Orchester schienen ihnen einzuheizen: es war begreiflich, denn auch Diederich und Guste in ihrer stillen Loge schnauften leise und sahen einander an mit erhitzten Augen. Die Gefühle gingen den Weg der Zauberklänge, die Hähnisch mit wogenden Gliedern hervorlockte, und die Hände folgten ihnen. Diederich ließ die seine zwischen Gustes Stuhl und ihrem Rücken hinabgleiten, umspannte sie unten und murmelte betört: „Wie ich das zum erstenmal gesehen habe, gleich hab’ ich gesagt, die oder keine!“
Aber da wurden sie aus dem Zauberbann gerissen durch einen Zwischenfall, der bestimmt schien, die Kunstfreunde Netzigs noch lange zu beschäftigen. Lohengrin zeigte sein Jägerhemd! Eben stimmte er an: „Atmest du nicht mit mir die süßen Düfte“, da kam es hinten aus dem Wams hervor, das aufging. Bis Elsa ihn, sichtlich erregt, zugeknöpft hatte, herrschte im Hause lebhafte Unruhe; dann erlag es wieder dem Zauberbann. Guste freilich, die sich mit einem Pralinee verschluckt hatte, stieß auf ein Bedenken. „Wie lange trägt er das Hemd schon? Und überhaupt, er hat doch nichts mit, der Schwan ist mit seinem Gepäck abgeschwommen!“ Diederich verwies ihr ernstlich das Nachdenken. „Du bist gerade so eine Gans wie Elsa“, stellte er fest. Denn Elsa war im Begriff, sich alles zu verderben, weil sie es nicht lassen konnte, ihren Mann nach seinen politischen Geheimnissen zu fragen. Der Umsturz ward vollends zerschmettert, denn Telramunds feiges [pg 377]Attentat mißlang durch Gottes Fügung; aber die Weiber, dies mußte Diederich sich sagen, wirkten, wenn man ihnen nicht die Kandare fest anzog, eher noch subversiver.
Nach der Verwandlung ward dies vollends klar. Eiche, Banner, alles nationale Zubehör war wieder da; und „für deutsches Land das deutsche Schwert, so sei des Reiches Kraft bewährt“: bravo! Aber Lohengrin schien nun wirklich entschlossen, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. „Überall wurde an mir gezweifelt“, durfte auch er sagen. Nacheinander klagte er den toten Telramund und die ohnmächtige Elsa an. Da keins von beiden ihm widersprach, hätte er ohne weiteres recht behalten; dazu kam aber noch, daß er tatsächlich in der Rangliste obenan stand. Denn jetzt gab er sich zu erkennen. Die Nennung seines Namens rief bei der ganzen Versammlung, die noch nie von ihm gehört hatte, eine ungeheure Bewegung hervor. Die Mannen konnten sich gar nicht beruhigen; alles andere schienen sie erwartet zu haben, nur nicht, daß er Lohengrin hieß. Um so dringlicher ersuchten sie den geliebten Herrscher, von dem folgenschweren Schritt der Abdankung diesmal noch abzusehen. Aber Lohengrin blieb heiser und unnahbar. Übrigens wartete schon der Schwan. Eine letzte Frechheit Ortruds brach ihr zur allgemeinen Genugtuung den Hals. Leider deckte gleich darauf auch Elsa das Schlachtfeld, das Lohengrin, statt des entzauberten Schwans von einer kräftigen Taube gezogen, hinter sich ließ. Dafür war der junge, soeben eingetroffene Gottfried in drei Tagen der dritte Landesfürst, dem Edle und Mannen, treu und bieder wie immer, ihre Huldigung darbrachten.
„Das kommt davon“, bemerkte Diederich, indes er Guste in den Mantel half. Alle diese Katastrophen, die Wesensäußerungen der Macht waren, hatten ihn erhoben und tief [pg 378]befriedigt. „Wovon kommt es denn“, meinte Guste, zum Widersprechen aufgelegt. „Bloß weil sie wissen will, wer er ist? Das kann sie wohl verlangen, das ist nicht mehr wie anständig.“ – „Es hat einen höheren Sinn“, erklärte ihr Diederich streng. „Die Geschichte mit dem Gral, das soll heißen, der allerhöchste Herr ist nächst Gott nur seinem Gewissen verantwortlich. Na und wir wieder ihm. Wenn das Interesse Seiner Majestät in Betracht kommt, kannst du machen was du willst, ich sage nichts, und eventuell –.“ Eine Handbewegung gab zu verstehen, daß auch er, in einen derartigen Konflikt gestellt, Guste unbedenklich dahinopfern würde. Dies erboste Guste. „Das ist ja Mord! Wie komm’ ich dazu, daß ich muß draufgehen, weil Lohengrin ein temperamentloser Hammel ist. Nicht einmal in der Hochzeitsnacht hat Elsa von ihm was gemerkt!“ Und Guste rümpfte die Nase, wie damals beim Verlassen des Liebeskabinetts, wo auch nichts geschehen war.
Auf dem Heimweg versöhnten sich die Verlobten. „Das ist die Kunst, die wir brauchen!“ rief Diederich aus. „Das ist deutsche Kunst!“ Denn hier erschienen ihm, in Text und Musik, alle nationalen Forderungen erfüllt. Empörung war hier dasselbe wie Verbrechen, das Bestehende, Legitime ward glanzvoll gefeiert, auf Adel und Gottesgnadentum der höchste Wert gelegt, und das Volk, ein von den Ereignissen ewig überraschter Chor, schlug sich willig gegen die Feinde seiner Herren. Der kriegerische Unterbau und die mystischen Spitzen, beides war gewahrt. Auch wirkte es bekannt und sympathisch, daß in dieser Schöpfung der schönere und geliebtere Teil der Mann war. „Ich fühl’ das Herze mir vergehn, schau ich den wonniglichen Mann“, sangen auch die Männer samt dem König. So war denn die Musik an ihrem Teil der männ[pg 379]lichen Wonne voll, war heldisch, wenn sie üppig war, und kaisertreu noch in der Brunst. Wer widerstand da? Tausend Aufführungen einer solchen Oper, und es gab niemand mehr, der nicht national war! Diederich sprach es aus: „Das Theater ist auch eine meiner Waffen.“ Kaum ein Majestätsbeleidigungsprozeß konnte die Bürger so gründlich aus dem Schlummer rütteln. „Ich habe den Lauer in die Vogtei gebracht, aber wer den Lohengrin geschrieben hat, vor dem nehm’ ich den Hut ab.“ Er schlug ein Zustimmungstelegramm an Wagner vor. Guste mußte ihn aufklären, es sei nicht mehr zu machen. Einmal auf so hohem Gedankenflug begriffen, äußerte sich Diederich über die Kunst im allgemeinen. Unter den Künsten gab es eine Rangordnung. „Die höchste ist die Musik, daher ist es die deutsche Kunst. Dann kommt das Drama.“
„Warum?“ fragte Guste.
„Weil man es manchmal in Musik setzen kann, und weil man es nicht zu lesen braucht, und überhaupt.“
„Und was kommt dann?“
„Die Porträtmalerei natürlich, wegen der Kaiserbilder. Das übrige ist nicht so wichtig.“
„Und der Roman?“
„Der ist keine Kunst. Wenigstens Gott sei Dank keine deutsche: das sagt schon der Name.“