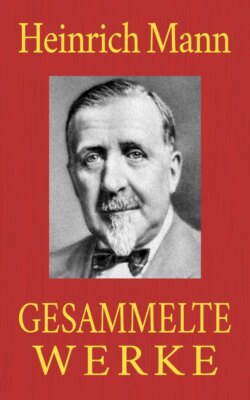Читать книгу Heinrich Mann - Gesammelte Werke - Heinrich Mann - Страница 7
II
ОглавлениеDie Angelegenheiten, welche ihn nach München geführt, hielten Wellkamp dort länger zurück, als er ursprünglich angenommen hatte. Die Verwaltung seines nicht unbeträchtlichen mütterlichen Erbes, um welche es sich auch jetzt handelte, war das einzige Geschäft, das ihm seit seinem Fortgang aus der Heimat oblag, und auch dieses hatte er in einer ihm unter den nunmehrigen Verhältnissen selbst unbegreiflichen Weise vernachlässigt.
In den zwei Wochen, die seit ihrer Trennung verstrichen waren, hatten die Verlobten nur einmal briefliche Grüße ausgetauscht. Aus ihrer kurzen Mitteilung hatte Wellkamp, ohne daß sie es ausdrücklich angab, herausgelesen, wie unbedeutend seiner Braut die bei solchen Gelegenheiten übliche, ausführliche Korrespondenz erschien, welche infolge der Unmöglichkeit, das Wesen des Schreibers ohne Einschränkung oder Übertreibung auszudrücken, über den Mangel persönlichen Verkehrs keineswegs hinweghelfen konnte.
Als er nach Ablauf dieser Zeit seine geschäftliche Abhaltung unvermutet beendet sah, gab der junge Mann dem Gelüste nach, unerwartet bei seinen neuen Angehörigen zu erscheinen, und reiste, ohne sie vorher zu benachrichtigen, ab. Er traf am Abend in Dresden ein.
Schon in früher Stunde machte er sich am nächsten Morgen auf, sich der Familie seiner Braut vorzustellen. Das Wiedersehen mit letzterer machte ihm nach so kurzer Trennung mehr freudiges Herzklopfen, als er gehofft hätte. Es kam hinzu, daß ihn die Ankunft in der Stadt, welche der Ort seiner erneuerten, glücklicheren Existenz sein sollte, zuversichtlicher und harmonischer stimmte. Er sah jetzt mit aller Bestimmtheit nur den einen Weg vor sich, den er zu gehen entschlossen war, und an dessen Ausgangspunkt er sich bereits befand. So fühlte er sich der Erwägung weiterer Möglichkeiten und der Notwendigkeit, einen Entschluß zu fassen, welche für Naturen seiner Art das stärkste Hindernis ist, das sie auf ihrer Bahn antreffen können, überhoben.
Er legte die wenigen Schritte, welche die Grubecksche Wohnung vom Union-Hotel trennten, rasch zurück, indes er zufriedene und interessierte Blicke die Reichsstraße auf und ab sandte, deren durch elegante und solide Luxusbauten bestimmte Physiognomie trefflich zu seinen Empfindungen und Wünschen stimmte.
So ward er doppelt unangenehm berührt durch einen jener böswilligen Zufälle, welche unsere mutigen und fruchtbaren Stimmungen zu unterbrechen lieben, bevor wir ihnen noch die gewünschte Richtung zu geben, sie zu Handlungen auszunutzen vermocht, und welche uns immer wieder gleich unvorbereitet treffen, obwohl sie so häufig sind. Wellkamp hatte das stattliche, vornehm aussehende Gebäude betreten, das augenscheinlich eines von denen war, in welchen das reisende England sein unentbehrliches boardinghouse findet. Aus der im Hausflur angebrachten Tafel ersah er, daß sich im ersten Stock die von ihm gewünschte Adresse befand. Als er aber einen vorübergehenden Groom anhielt, erfuhr der junge Mann, daß die Herrschaften, der Herr Major mit dem gnädigen Fräulein, ausgeritten seien; ihre Rückkehr sei unbestimmt, es könne aber bald sein.
Wellkamp hatte in seinem Ärger über diesen unvorhergesehenen Aufenthalt keine Lust, umzukehren, um zu gelegenerer Zeit wiederzukommen. Er beschloß, gleichwohl hinaufzugehen, um seine Braut und ihren Vater zu erwarten. Übrigens hatte er sich schon auf dem Wege, in seiner freudigen Erwartung, ein Bild nach seiner Laune von dem Interieur hergestellt, welches er jetzt betreten wollte, und worin er sich bereits seiner Braut gegenübersah. Auch die Begrüßung hatte er sich zurechtgelegt, die einzelnen Worte in seinem Ohre klingen gehört. So mochte die Unlust, allen diesen Vorstellungen kurzweg den Rücken zu wenden, sein Bleiben hinreichend erklären. Wenn er indes selbst keinen anderen Grund dafür wahrnahm, so war es doch sicher, daß er droben bei der Meldung des Dieners, die gnädige Frau sei daheim, leise zusammenschrak, als sei ihm eine heimliche Erwartung bestätigt. Einen Augenblick sah er unschlüssig auf das weiße Schild an der Tür, welches den Namen »v. Grubeck« trug; dann gab er den Auftrag, ihn zu melden.
Während er dem Diener folgte, glaubte er sich wundern zu müssen, weshalb er den ganzen Morgen noch mit keinem Gedanken sich mit der Frau beschäftigt, welcher doch jene letzte Unterredung mit seiner Braut gegolten hatte. Er war noch nicht einmal dazu gelangt, sich eine bestimmte Vorstellung von ihrem Äußern zu bilden, was sonst in Fällen, wo man ihn auf eine neue Bekanntschaft vorbereitet hatte, in seiner Gewohnheit lag. Er wußte nicht, daß gerade die Wahrnehmung des Ungewissen, welches für ihn um diese Frau gebreitet lag, ein stärkeres Interesse bezeugte, als er sich selbst zugab.
Aus einem von der Morgensonne hell und freundlich erfüllten Vorzimmer war er in ein kleines Boudoir getreten, dessen dämmeriges Licht ihn, sobald die schwere Portière hinter ihm zusammengeglitten, in den ersten Augenblicken nichts erkennen ließ. Indes sagte ihm eine Empfindung, welche durch eine nur geahnte, keinesfalls festzustellende körperliche Berührung veranlaßt schien, daß er sich nicht allein im Zimmer befinde. Wirklich entdeckte er, als er sich einigermaßen an die Beleuchtung gewöhnt, daß aus einem Winkel hervor der Blick zweier seltsamen Augen auf ihn gerichtet war. Dieser verschleierte und zugleich durchdringende Blick, der hinter fast geschlossenen Lidern alles auffing, was sich ihm näherte, ohne selbst einer Beobachtung zugänglich zu sein – dieser Blick wanderte wie mit langen, tastenden Spinnenfüßen auf Gesicht und Gestalt des jungen Mannes umher, den seine Berührung in eine nervöse Ungeduld versetzte. Es war ihm, als täte man ihm Gewalt an und als müßte er sich ihrer erwehren, ohne doch ausdrücklich zu wissen, worin sie bestand. Unter dem unliebsamen und verlegen machenden Einfluß ihres Blickes verneigte er sich weniger leicht und gewandt, als er anderenfalls getan hätte, vor der Dame, welche in einer Ecke des Zimmers und von einer spanischen Wand halb verborgen, hinter ihrem Teetisch saß. In der blitzschnellen Überlegung jedoch, mit der bei einer solchen ersten Begegnung einer den anderen zu prüfen und zu messen pflegt, fand er dabei die falsche Ironie, welche im Gegensatz zu der wahren, die ein Ausdruck der Überlegenheit ist, sich in Momenten großer Verlegenheit einstellen kann.
»Das sind Sicherheitszündhölzchen«, sagte er sich, indes ihn die beiden rätselhaften Augen, welche sich an den seinigen festgesogen zu haben schienen, nicht losließen. »Dieses spielende, sinnliche Feuerchen hat die glückliche Besitzerin immer in ihrer Gewalt; es kann kein Unheil anrichten, wenn sie es nicht will.«
Der heimliche Spott, mit dem er sich hatte ermutigen wollen, machte ihn schließlich nur beklommener. Er litt unter der haltlosen Furcht, sie möchte seine Gedanken entziffern können. Auch befremdete ihn sein eigenes Schweigen, während er doch zugleich fühlte, daß diese Frau gewohnt sein müsse, nach ihrem Willen eine Unterhaltung anzuknüpfen oder Schweigen herrschen zu lassen.
So war es für ihn eine Erlösung, als sie ihn endlich mit einer langsamen wagerechten Bewegung ihrer Hand zum Sitzen einlud. Während er sich in einem niedrigen Sessel der Dame gegenüber an dem orientalischen Tischchen niederließ, auf dessen geschmackvoll eingelegter Platte das Teegeschirr stand, begann Frau v. Grubeck zu sprechen. Sie teilte ihm zunächst auch ihrerseits mit, daß ihr Gatte mit seiner Tochter eine Promenade mache; indes würden sie vermutlich bald zurück sein.
»Mein Mann«, so fügte sie hinzu, »hat sich außer diesem täglich eingehaltenen Morgenritt auch andere körperliche Übungen zur Gewohnheit gemacht. Wenn man so früh altert wie er, ist die kleine Eitelkeit, es nicht scheinen zu wollen, ja ganz begreiflich, nicht wahr?«
Wellkamp erwiderte auf die flüchtig ausgesprochene Frage mit einer Verbeugung, die anders als die frühere, indes nicht sonderlich verbindlich ausfiel.
Sobald sie ihn angeredet, war ihm die wunderliche Verlegenheit der letzten Minuten völlig benommen gewesen. Was sie gesagt, war unbedeutend, der Spott und die kaum verhohlene Geringschätzung, mit der sie einem ihr gänzlich Fremden in der ersten Viertelstunde von ihrem Gatten sprach, verletzte sein Empfinden. Auch ihre Stimme, welche hoch, aber verschleiert wie ihr Blick war, und in deren leichte Heiserkeit sich bei jenen spöttischen Worten mehrere Male ein schriller Ton gemengt hatte, war ihm unsympathisch.
Vielleicht war es ihr bewußt geworden, daß sie sich ihrem Gegenüber unvorteilhaft vorgestellt. Jener Instinkt mochte es ihr verraten haben, der manchen Frauen behilflich ist, sich gleich bei einer ersten Begegnung in Ton und Haltung dem Geschmack des Mannes anzupassen.
In jedem Falle war es eine ihrem bisherigen Benehmen widersprechende Bewegung, mit dem sie ihm jetzt die Hand entgegenstreckte, ohne Vorbereitung und scheinbar ein wenig verwirrt.
»Aber ich habe ja ganz vergessen«, sagte sie mit einem diskret abbittenden Ton ihrer Stimme, welche sich nun modulationsfähiger erwies, als ihre ersten Worte vermuten ließen. Und während er sich, unschlüssig, wie er ihre veränderte Haltung zu deuten habe, über die dargereichte Hand neigte, setzte sie hinzu: »Ich bin eine so abscheuliche Egoistin; ich hätte doch an meinen Glückwunsch denken sollen. Aber ich muß Ihnen nun auch eine sorgsame Mutter sein – wie meinen Sie?«
»Ich hoffe, mir das Wohlwollen der gnädigen Frau zu erwerben«, entgegnete der junge Mann verbindlich.
Sie bemerkte indes, daß während ihrer letzten, mit leichter Koketterie gesprochenen Worte seine Fingerspitzen, welche noch ihre Hand gefaßt hielten, leise zitterten.
Als er wieder aufblickte, sah er ihre Augen mit einem nachdenklichen Ausdruck auf sich gerichtet.
Die kleine Pause, welche dann folgte, ging beiden fast unbemerkt vorüber, da jeder mit seinen, den anderen prüfenden Gedanken beschäftigt war.
Wellkamp seinerseits hatte in diesen Augenblicken die erste Gelegenheit, sich der Einzelheiten in ihrem Gesichte und ihrer Figur, unter deren Gesamteindruck er sich, seitdem er der jungen Frau gegenübersaß, befunden, zu versichern.
Sie machte in ihrem zugleich eleganten und anspruchslosen Morgenkleide von weißen Spitzen, welches in gut geordneten Falten um ihre etwas zu schlanke, in den tiefen Sessel geschmiegte Gestalt lag, ganz den Effekt einer großen Dame. Auf ihren Knien ruhten, zwei Finger ineinander gelegt, ihre Hände, die den jungen Mann seit ihrer ersten Bewegung lebhaft beschäftigt hatten. Sie waren lang und schmal, jedoch von einer nicht vollendeten, etwas harten Form und, ebenso wie das Gesicht der Frau, von einer eigentümlichen, leicht gelblichen Färbung überhaucht, durch die der Betrachtende den darunterliegenden weißen Teint zu sehen meinte. Das Haar der Dame war trotz der frühen Stunde mit aller Kunst geordnet, wobei besondere Sorgfalt auf eine kluge Verteilung der Stirnlöckchen verwendet war. Die Stirn selbst war ziemlich niedrig und von nicht reiner Form. Um so reiner und tadelloser war der Ansatz der sehr leicht gebogenen Nase, deren feine Flügel leise vibrierten. Ebenso waren Kinn und Mund fein gebildet, wenngleich auch sie der Weichheit entbehrten. Die einander fremden Charaktere der beiden Gesichtshälften ließen in diesem Gesichte die Vermischung verschiedener Racen vermuten.
Dann wurde die Aufmerksamkeit des Beobachtenden wieder von den vielsagenden und doch wieder nichts verratenden Augen angezogen, als die junge Frau aufs neue zu sprechen begann, hastig einsetzend, als werde sie erst jetzt des beiderseitigen Schweigens inne.
Sie tat, zum ersten Mal ausführlicher, Annas Erwähnung.
»Damit Sie wissen, welches Glück Sie haben«, sagte sie, »sollte ich Ihnen eigentlich fortwährend von den Vorzügen Ihrer Braut sprechen. Ich darf es wohl, da ich ja an ihrer Bildung keinen Anteil habe?«
»Ein junges Mädchen lernt zuweilen ebensoviel von einer älteren Freundin wie von einer Mutter.«
»Annas Erziehung bewundere ich umsomehr, als sie sie sich nach dem frühen Tode ihrer Mutter offenbar ganz allein gegeben hat. Ihre beneidenswerte Anspruchslosigkeit haben Sie gewiß schon kennen gelernt. Auch muß Ihnen aufgefallen sein, daß sie eine Menge Dinge weiß, von denen wir andern keine Ahnung haben. Besonders für ein junges Mädchen ist ihr Wissen, glaube ich, außerordentlich. Aber darüber habe ich kein Urteil. Mein Gott, ich bin so dumm gegen sie.«
So schloß sie, mit einer nicht ganz zu verbergenden Ungeduld in der Stimme.
Mochte es nun die von ihm geargwohnte Absicht der Sprecherin, sich durch eine günstige Beurteilung seiner Braut seinen Wünschen anzupassen, sein, die ihn verstimmte – Wellkamp konnte nicht anders, als sich in dem nämlichen Gefühl der Gegnerschaft, das ihn unter dem Eindruck ihres ersten Blickes befallen, innerlich gegen jedes ihrer Worte empören. Hinter ihren scheinbar liebenswürdigen Äußerungen witterte er versteckte Bosheiten auf Rechnung seiner Braut. Überhaupt erkannte seine Empfindung dieser Frau völlig das Recht ab, sich über Anna auszusprechen, sei es immer in welcher Weise. Statt der anfänglichen nervösen Antipathie, welche ihn ein rätselhaftes Interesse zu Zeiten vergessen gemacht hatte, ergriff ihn jetzt offene Feindseligkeit, in der für ihn seltsamerweise etwas erleichterndes lag, gegen die ihm gegenübersitzende Dame. Diese wartete, gelassen mit den an den Seitenlehnen ihres Sessels herabhangenden Quasten spielend, noch immer auf die Erwiderung ihres einsilbigen Gastes, auf den sie unausgesetzt ihren verschleierten Blick gerichtet hielt. Als der junge Mann keine Miene machte, sein Schweigen zu unterbrechen, bot sie ihm mit einem nachlässigen Wink auf das vor ihr stehende Service eine Tasse Tee an. Wellkamp lehnte kurz und wenig höflich ab und war im Begriffe, seinen Vorsatz, bis zur Rückkehr der Reiter auszuharren, aufzugeben, als sich im Nebenraume Annas Stimme vernehmen ließ. Gleich darauf traten die Erwarteten ein.
Wellkamp folgte seinem plötzlich aufwallenden Bedürfnis, den Gegensatz zwischen seiner mehr als kühlen Haltung in Gesellschaft Frau v. Grubecks und dem herzlichen Willkomm, welchen er seiner Braut bot, besonders auffällig zu machen. Er wußte selbst nicht, für wen? So beugte er sich mit rascher Bewegung tief auf Annas kleine, kräftige und leicht gebräunte Hand, die noch halb vom Reithandschuh bedeckt war. Das junge Mädchen hatte sie ihm mit einem glücklich überraschten, kleinen Aufschrei entgegengestreckt, während ihr frisches, nach der gehabten Bewegung lebhafter als sonst gefärbtes Gesicht sich noch um einen Ton tiefer rötete.
Der Major, nach der gesunden Anstrengung ein wenig außer Atem, umarmte den Schwiegersohn mit fast jugendlicher Heftigkeit. Er ließ dabei sein gutes, naives Lachen hören, das Wellkamp gleich bei der ersten Begegnung für den alten Herrn eingenommen hatte. Dann wandte er sich zu seiner Gattin, welche der Szene mit bewegungsloser Miene gefolgt war. Wellkamp bemerkte seinen zugleich respektvollen und ritterlichen Handkuß, sowie die behutsam sondierende Weise, in der sich Herr v. Grubeck nach dem Befinden seiner Gattin erkundigte. Diese lohnte ihm mit einem gnädigen und zugleich unmerklich spöttischen Lächeln, während sie Wellkamp, zu dem ihr Blick zögernd, gleichsam auf sammtenen Sohlen hinüberglitt, anredete.
»Ich muß Ihnen dankbar sein«, sagte sie. »Ich habe meinen Mann nie so artig und auch so – jung gefunden wie jetzt, da er im Begriffe steht, Schwiegervater zu werden.«
Wellkamp, der nicht anders als mit einer Verbeugung geantwortet hatte, wandte sich zu seiner Braut, welche er nach ihren Erlebnissen und ihrem Zeitvertreib seit sie einander nicht gesehen, fragte. Sie berichtete ihm in ihrer ruhigen, offenen und von jeder Sentimentalität freien Art von der frohen Erwartung, mit der sie in der verflossenen Zeit an das jetzige Wiedersehen gedacht habe.
Ihr Vater, welcher inzwischen halblaut und in leicht fragendem Tonfall mit seiner Gattin gesprochen – »Also, wenn Du einverstanden bist, liebe Dora, so bleiben wir zum Frühstück alle beieinander«, hatte er schließlich gesagt – trat nun zu den beiden jungen Leuten, um sich an ihrem Gespräche zu beteiligen. Es wurde vor dem mit einer schweren Gardine von gelbem Damast fast völlig verhangenen Fenster geführt. Anna hatte sich dort, an der Frau v. Grubecks Sitz entgegengesetzten Seite des Gemaches, auf einem niedrigen Divan niedergelassen. Ihr Vater, der mit Wellkamp vor ihr stand, begann diesem zu erzählen, daß er in den letztverflossenen zwei Wochen die Gesellschaft seiner Tochter noch einmal aufs angenehmste genossen habe.
»Sie werden mir nun bald genug meinen lieben Begleiter auf meinen Spazierwegen entführen«, sagte er.
»Hoffentlich sehr bald«, entgegnete jener lächelnd, und überleitend fuhr er fort: »Es ist nur die Frage, ob das viele, was uns noch erübrigt, in so kurzer Zeit zu erledigen sein wird, wie wir es wünschten. Denn ich glaube wohl« – und er wechselte einen Blick des Einverständnisses mit seiner Braut – »daß ich nicht der einzige bin, dem möglichste Beschleunigung erwünscht wäre.«
»Was Du tun willst, tue bald«, stimmte der Major bei, »wir waren uns darüber ja ganz einig. Nun handelt es sich also vor allem um die nötige Einrichtung, und da werden wir uns besonders auf Deinen guten Geschmack verlassen.«
Die letzten, an Anna gerichteten Worte begleitete Wellkamp mit seiner Zustimmung. Herr v. Grubeck bemerkte indes plötzlich sein Versäumnis, in dieser Frage nicht seine Gattin als erste zugezogen zu haben. Während er nun eilig durch das Zimmer schreitend sich ihr näherte, sagte Wellkamp, in der durch das augenblickliche Alleinbleiben sofort hergestellten größeren Vertraulichkeit dichter an seine Braut herantretend:
»Ich bedauere sehr, meinerseits für unsere Ausstattung außer ein paar nebensächlichen Möbeln und Kunstgegenständen nicht die geringste Grundlage liefern zu können. Findest Du es nicht lächerlich, daß ich, so alt ich geworden bin, mich immer gescheut habe, mir eine eigene Einrichtung aufzubürden? So habe ich in der ganzen Welt, auch wenn ich mich gelegentlich auf ein halbes Jahr – länger hielt ich’s ja kaum aus – irgendwo festsetzte, immer in garnierten Mietswohnungen herumgelegen.«
»Nun, dann ist es noch ein besonderer Segen für Dich, daß dies nun bald ein Ende haben wird«, entgegnete Anna mit ihrem stillen Lächeln, das, im Gegensatz zu dem der meisten Frauen, die Wellkamp kennen gelernt, weniger glänzendes und reizendes als beruhigendes und häufig ein weniges nachsichtiges hatte.
Der Major wandte sich, von der anderen Seite des Raumes her, wieder den beiden jungen Leuten zu.
»Aber das ist ja wahr«, rief er mit lauter und fröhlicher Stimme – »da kommt mir erst jetzt die Idee, Kinder, ihr könnt am Ende, bis ihr es bei euch gemütlich habt, hier bei uns unterkommen. Wir haben Platz, und da fällt mir eben noch ein, daß ich von Mr. Bright – das ist nämlich unser Wirt – gehört habe, nebenan werde zum nächsten Ersten die andere Hälfte der Etage frei; zwar ist es die kleinere, aber vielleicht kann sie euch fürs erste genügen.«
Die ungezwungene und rasche Art, wie er diesen Vorschlag machte, ließ vermuten, daß sich der alte Herr mit seiner Gattin im Einverständnis befände. Indes kam keines der beiden Angeredeten auf den Gedanken, daß ihm sein Einfall, jedenfalls ohne daß er selbst es wahrnahm, nahegelegt und untergeschoben sein könnte.
Vielleicht setzte Frau v. Grubeck, als sie nun seine Worte bestätigte, ein wenig hastiger und interessierter ein, als es sonst in ihrer Art lag.
»Natürlich ist hier hinreichend Raum für einen zweiten Haushalt – und außerdem«, fügte sie mit dem Lächeln, dessen rätselhafter Inhalt Wellkamp heute nicht zum ersten Mal beschäftigte, hinzu, »– und außerdem werden wir Alten es dann etwas weniger einsam haben.«
Jedenfalls gab die so herbeigeführte Lösung der Frage allen das Bewußtsein, die Situation ein gutes Stück gefördert zu sehen. Außerdem erfüllte sie den Major mit rückhaltloser Befriedigung darüber, einen Aufschub der endgültigen Trennung von seiner Tochter erreicht zu haben. Letztere selbst begrüßte vor allem die Entfernung des einzigen Hindernisses, welches einer baldigen Verbindung mit dem geliebten Manne entgegengestanden hatte. Auch die Aussicht, ihren Vater auf diese Weise noch eine Zeitlang in unmittelbarer Nähe zu behalten, erfreute sie, obwohl sie andererseits einen schließlichen Wegzug aus dem Hause der Reichsstraße als selbstverständlich ansah und um der ersehnten Entfernung willen aus dem Kreise der ihr unsympathischen Frau ihres Vaters auch wünschte. Wellkamp glaubte seinerseits hierin mit seiner Braut völlig übereinzustimmen, und so fand er keine Erklärung für den leisen, kalten Schauer, der während der Entscheidung, welche die Worte seines Schwiegervaters und Frau v. Grubeck enthielten, durch sein Blut gegangen war und sein Herz berührt hatte. Wenn er zugleich den Wunsch empfunden hatte, die von Herrn v. Grubeck bezeichnete, in der nächsten Nachbarschaft gelegene Wohnung zu seiner ständigen zu machen, so hätte er denselben sicherlich im nächsten Augenblick mit guter Überzeugung ableugnen dürfen, so flüchtig und auch in Gedanken unausgesprochen war er gewesen.
Was Frau v. Grubeck betrifft, so vermutete bei ihr keiner der anderen in dieser Angelegenheit wirkliche Wünsche und Interessen. Auch war die Gleichgültigkeit, die sie gezeigt hatte, wohl nur zur Hälfte unwahr. Der Impuls, jene Entscheidung herbeizuführen, hatte sie selbst, sobald die fragliche Angelegenheit zur Sprache gekommen war, ebenso unerwartet wie unwiderstehlich erfaßt. Wiewohl sie die Gründe desselben noch nicht kannte, hatte ihr Instinkt sie zu gleicher Zeit gewarnt, sich durch unvorsichtiges Befolgen des ersten Antriebes bloßzustellen. Als sie sodann, dank der Fähigkeit des weiblichen geborenen Diplomaten, andere unvermerkt zum Aussprechen der Gedanken, die man selbst nicht laut werden lassen möchte, zu leiten, ihr Ziel erreicht, hatte ihr dieser Erfolg, während er sie heimlich triumphieren machte, zugleich auch eine unbestimmte Furcht eingeflößt. Das Fehlen unmittelbarer, deutlich erkennbarer Gründe für ihre Handlungsweise war dabei kaum zu ihrer Erkenntnis gelangt. Und dies mag wunderbarer klingen als es ist. Denn von wie vielen unserer Handlungen und Äußerungen kennen wir in demselben Augenblicke, wo wir sie tun, in Wahrheit die Gründe? Wir mögen häufig äußerliche Ursachen mit den tieferen Triebfedern verwechseln, und noch öfter mögen wir uns fingierte Gründe statt der tatsächlichen unterschieben, zumal wenn wir, uns letztere zuzugeben, durch unsere Eigenliebe verhindert werden. Es ist gewiß, daß es um unsere Selbsterkenntnis anders stehen müßte, sollten wir in keinem Falle etwas tun, ohne uns zuvor ein Warum aufrichtig beantwortet zu haben. Aber es ist ebenso sicher, daß uns dies nicht zufriedener machen würde.
Hierfür konnte auch diese Frau als Beweis gelten, die mehr als andere gewöhnt war, sich in einsamen Stunden mit sich selbst zu beschäftigen und ihr Innenleben auszuhorchen.
Frau v. Grubeck blieb auch jetzt allein, nachdem ihr Gatte sich mit seinen Kindern in sein »Atelier« begeben, wo Wellkamp in seine Malstudien, die Frucht einer mit Eifer geübten Beschäftigung des alten Herrn, Einsicht nehmen sollte. Als die drei das Zimmer verlassen, erschien der Diener, um das Teeservice abzuräumen. Dann störte niemand mehr die Herrin des kleinen Gemaches, von dessen in dunklen Farben gehaltener und dämmerig beleuchteter Ausstattung sich ihre weißgekleidete Gestalt seltsam abhob, wie sie ohne Bewegung, in unveränderter, graziös-nachlässiger Haltung in ihren Sessel gelehnt, dasaß.
Von der Majolikaplatte der Konsole, aufweiche die junge Frau unverwandt ihren Blick gerichtet hielt, klang das feine, durchdringende Ticken einer Miniatur-Stutzuhr. Ringsumher standen auf Schreibtisch und Etagèren die unzähligen kleinen Zwecklosigkeiten, die scheinbar so nichtssagend sind, während sie in Wahrheit gleichsam den Niederschlag eines feinen und eleganten Frauenlebens bedeuten. Auf das vor der Dame stehende arabische Tabouret hatte der Diener den gelben Romanband gelegt, welcher unter den auf dem größeren Mitteltisch umhergestreuten durch ein Lesezeichen als der zur Zeit im Gebrauch befindliche angedeutet gewesen war. Frau v. Grubeck pflegte die Stunden bis gegen ein Uhr mit Lektüre auszufüllen. Nach dem Frühstück ruhte sie und unternahm zuweilen eine Ausfahrt, um von fünf Uhr ab ihre Zeit der Toilette für das um sieben Uhr stattfindende Diner zu widmen. Der Abend, ein langausgedehnter Abend, sah sie wieder an ihrem gewohnten Platze in ihrem Boudoir, wenn sie nicht, was selten genug geschah, für die letzten Akte in die Oper fuhr. Eine andere Abwechslung brachten ihre Tage kaum mit sich. Und dies war nicht das Leben einer Greisin, sondern dasjenige einer Frau von nicht ganz achtundzwanzig Jahren.
Dora Linter stammte väterlicherseits aus einer deutsch-jüdischen, seit zwei Generationen getauften Familie. Ihr Vater hatte in Rio de Janeiro, wo er sein Vermögen gemacht, eine gefeierte Dame der dortigen Gesellschaft, eine Kreolin, geheiratet. In früher Kindheit mutterlos geworden, war Dora ohne viel andere Gesellschaft als die ihrer Dienerinnen aufgewachsen. Und während das bei seiner auffallenden lichten Blondheit eigentümlich stille und indifferente Mädchen von frühauf an das untätige, bloß vegetierende Dasein der südamerikanischen Damen gewöhnt wurde, wuchs zugleich ihre Verschlossenheit und ihr Trotz. Körperlich und geistig schnell entwickelt, wie sie nach Art der dortigen jungen Mädchen war, schien es nicht ausbleiben zu können, daß sich früh das südländische Blut in ihr zu regen begänne. Gleichwohl befand sie sich bis fast an ihr sechzehntes Jahr in einem Zustande der seelischen Unberührtheit und Ahnungslosigkeit, dessen sie sich später, in den Leiden ihrer durch streitende Triebe gebrochenen Natur, häufig mit schmerzlichem Neide erinnerte. Daß das junge Mädchen so lange in ihrem Sinnenleben ein Kind blieb, mochte nicht zum kleinsten Teil der religiösen Erziehung zu danken sein, der einzigen gründlichen, welche sie überhaupt erhielt, und welche zu frühe Wünsche mit sanfter Hand zurückhielt, während sie zugleich dem Gefühlsleben der Heranwachsenden ihre reiche Nahrung zuführte.
So kam es, daß der erste männliche Umgang, der nach einer fast gänzlich abgeschlossen verlebten Kindheit an sie herantrat, eine eigentümliche Wirkung auf Dora übte. Anfangs empfand sie nichts als Schüchternheit und Furcht vor etwas Unbekanntem. Der junge Mann, ein Angestellter ihres Vaters, den dieser, da er aus guter englischer Familie war, häufig in seine Häuslichkeit einlud, wurde dadurch verleitet, sie als kleines Mädchen zu behandeln. Er gestattete sich ihr gegenüber, in scheinbar spielender Weise, von Anfang an mehr, als er ohne ihre verlegene Haltung getan hätte. Letztere verlor sich nur zu bald. Das junge Mädchen begann zwar nicht zu empfinden, aber zu begreifen. Zugleich stellte sich bei ihr die Lust ein, seine Überlegenheit in ihrem Verkehr zu brechen. So machte sie ihm nun kleine, scheinbar bedeutungslose Zugeständnisse, um sich, sobald er die Miene annahm, dieselben für sich auszunutzen, plötzlich zurückzuziehen. Sie fand in diesem noch halb kindlichen Spiele, außer der Genugtuung, den Gegner – denn so hatte sie ihn von Anfang an im stillen genannt – stets aufs neue nach ihrem Wunsche hoffnungsvoll und ernüchtert zu sehen, das aufregende Vergnügen, welches ihr die zusammenschauernde Furcht vor einer Gefahr gewährte, zu der es sie dennoch fortwährend hinzog. Der junge Engländer mochte seinerseits für eine derartige Verkehrsart, für welche bezeichnenderweise seine Sprache das Wort flirt gefunden hat, nicht mehr hinreichend empfindlich sein. Es war sicher, daß dem eindringlicher werdenden Sensationsbedürfnisse Doras seine Huldigungen am Ende nicht mehr genügten. Halb unbewußt verlangte sie danach, seine Begierde einmal deutlich und ohne Zurückhaltung hervortreten zu sehen, sei es auch nur, um sie mit desto mehr kühler und spöttischer Überlegenheit abweisen zu können. Und dieses Verlangen wurde schließlich unwiderstehlich genug, um sie zu jener Szene zu verleiten, welche ihr in der späteren Erinnerung als die eigentliche Ursache ihres freudlosen und ungenützten Daseins erschien. Wie häufig vergessen wir in dieser Weise die natürliche Folge unseres Geschickes, um ein einzelnes Begebnis, das uns vielleicht einen besonders starken Eindruck hinterlassen, als die für sich und ohne Zusammenhang bestehende Veranlassung alles Folgenden zu betrachten.
Jene Szene spielte eines Abends auf der Terrasse des Hauses, wo Dora in ihrer Hängematte ruhte, welche von dem Verehrer des jungen Mädchens in Bewegung gehalten wurde, während er mit der anderen Hand den unentbehrlichen Fächer führte. Es lag noch viel von der außergewöhnlichen Hitze des Tages in der Luft. Der junge Mann befand sich in einer träumerischen und empfänglichen Stimmung, wie er auf das reizende Mädchen herniederblickte, deren abgerissenes Lachen zeitweilig das einzige vernehmbare Geräusch war in der müden Stille ringsumher. Über ihnen hing eine grotesk bunte Leinenmarquise. Außerhalb dieses Daches sah der wolkenlose Himmel hervor, den die hereinbrechende Dämmerung stahlblau färbte. Zu ihren Füßen breitete sich der Garten aus mit seinen ungeheuren tropischen Gewächsen und der Farbenpracht seiner Blumen. Dies alles und nicht weniger das schöne Mädchen in seiner Gesellschaft erschienen dem jungen Manne unter den Bedingungen einer zeitweiligen Stimmung ungewohnter und märchenhafter als sonst, und zugleich verlockender und begehrenswerter als je zuvor. Als Dora seine unvermutete heftigere Annäherung wahrnahm, konnte sie, wie in einem Rausche des Übermutes und der Neugierde befangen, nicht anders, als ihn durch gesteigerte Herausforderungen ermutigen. Sie hielt damit erst, gewaltsam erschreckt, inne, sobald sie seine körperliche Berührung spürte. Während seine Hände von der Hängematte herab um ihre Schulter und dann um ihren Leib glitten, während seine Bewegungen heftiger und unverhüllt begehrlicher wurden, war ihr Lachen lauter und krampfhafter geworden, um schließlich in ein gewaltiges Schreien überzugehen, in dem so viel tiefstes Grauen und zugleich eine solche grausame Härte lag, daß der junge Mann augenblicklich zurückschrak. Sofort sprang sie auf und war mit wenigen Sätzen in ihrem Zimmer, wo sie sich einschloß, unter unaufhörlichem Geschrei, welches nun das der Wut geworden war, der machtlosen und in ihrem Bewußtsein kaum begründeten Wut gegen den Gegner. Am gleichen Abend, mit Hast und ohne Überlegung, als ob sie dem Instinkt der Selbsterhaltung folgte, berichtete sie ihrem Vater über das Vorkommnis. Sie wußte durch ihre sichtliche Aufregung, sowie durch eine zu seinen Ungunsten gehaltene Schilderung des Vorganges die alsbaldige Entfernung des jungen Mannes herbeizuführen. So konnte sie in der nächsten Zeit, welche ihr nach der nervösen Gereiztheit der vergangenen Wochen Ruhe und Erschlaffung der Sinne brachte, jene Episode beendet und unschädlich gemacht glauben, um erst langsam der Wirkungen, welche sie in ihrem ferneren Innenleben gezeitigt, gewahr zu werden.
Stärker als das Vergnügen, das ihr in dem Umgange mit dem jungen Engländer das Spielen mit der wohl gekannten Gefahr bereitet hatte, war jetzt in ihr die einfache Furcht vor der letzteren. Nach jenen Erfahrungen fühlte sie sich ihrer selbst nicht mehr mächtig; es stand immer vor ihrer Seele, daß sie im Begriffe gewesen, sich zu vergessen. Und während ihr der Gedanke an das Schicksal, dem sie kaum entgangen, bei allem Reizungsbedürfnisse einen körperlichen Widerwillen verursachte, bäumten sich neben ihrem ausgeprägten religiösen Pflichtgefühl auch die sorgsam gepflegten Begriffe der gesellschaftlichen Sitte in ihr auf. Der Gedanke an die Möglichkeit einer abermaligen Versuchung machte sie scheu und ließ sie sich fortan alsbald zurückziehen, wo sie eine beginnende größere Vertraulichkeit zu bemerken meinte. Es vergingen darüber mehrere Jahre, während welcher ihre immer mehr auffallende Verschlossenheit und ihre Neigung, den gesellschaftlichen Verkehr nach Möglichkeit einzuschränken, ihren Vater mit Besorgnis erfüllte. Um durch eine Veränderung ihres Aufenthaltsortes vielleicht eine günstige Einwirkung auf das Wesen seiner Tochter zu gewinnen, und um ihre Zukunft nach seinen Wünschen ordnen zu können, beschloß Herr Linter nunmehr, die auch aus geschäftlichen Rücksichten schon geplante Übersiedelung nach New York auszuführen.
In der Tat durfte sich Dora nach ihrem Eintritt in die dortige Gesellschaft, in welcher sie dank ihrer überlegenen Erscheinung und dem väterlichen Vermögen alsbald eine ausgezeichnete Stellung einnahm, gestehen, daß sich die frühere Gefahr für sie stark verringert habe. Nachdem sie in der Stille ihrer Zurückgezogenheit genug unter den Widersprüchen ihrer Natur gelitten, hatten in dem Kampfe des sinnlichen Verlangens, das jene Episode mächtig aufgeregt, mit ihren kühlen und reflektierenden Geistesanlagen die letzteren den Sieg davongetragen. In ihren einsamen Grübeleien war sie dahin gelangt, ihre Beschäftigung mit den Beziehungen der Geschlechter aus ihrem Blute fast völlig in ihr Hirn zu verpflanzen. Sie war in der Stille eine Meisterin in der Kunst des flirt geworden, jener unfruchtbaren Abart des Kampfes der Geschlechter, welche zugleich, in ihrem eigentlichen Sinne gehandhabt, die für den Angreifer ungefährlichste ist. Dora Linter war vollkommen in der Fertigkeit, den Grad, bis zu welchem sich der Gegner vorgewagt, zu beaufsichtigen, um ihr Verhalten ihm gegenüber dementsprechend einzurichten. Mochte sie nun im einzelnen Falle offen angreifen oder sich zu verteidigen scheinen, mochte sie sich ihm etwa als teilnehmende Freundin zeigen oder ihn eine sentimentale Neigung ahnen lassen, immer sah sie am Ende ihre Absicht, den Mann leiden zu machen, erreicht. Vielleicht brauchte man sie im Grunde kaum ungünstiger zu beurteilen als andere Frauen, denen ihre Natur die Befriedigung ihrer, stets selbstsüchtigen, Sinne auf andere Weise vorschrieb. Jedenfalls aber begann nach den ersten Jahren ihres gesellschaftlichen Lebens das rätselhafte und grausame Wesen ihres Umganges, die Verehrer von ihr fern zu halten. Dies verstärkte wiederum ihre natürliche Bitterkeit und Unlust, indem es ihr vor Augen führte, daß man ihre Art zu leben unliebsam und unumgänglich fand. Es begann an diesem Zeitpunkte in ihrem Gesicht bereits der den Frauen des Südens früh eigene languide Zug hervorzutreten, der zwar fürs erste ihrer Schönheit einen neuen, wunderlichen Reiz hinzufügte. Ihrem Vater, der in letzter Zeit häufiger seine Besorgnis laut werden ließ, auch hier seine Absichten in betreff ihrer Zukunft nicht verwirklicht zu sehen, gestand Dora in dem ihr im Verkehr mit ihrem einzigen nahen Verwandten gewohnten eigentümlich spöttisch-gleichgültigen und ein wenig an Cynismus erinnernden Ton, daß allerdings jetzt weniger als je die Aussicht einer Heirat für sie vorhanden sei. Auch war es nur zum Teil Eitelkeit und viel wirkliche Entschlossenheit, was sie betonen ließ, daß sie kaum noch die Neigung haben könne, einem dieser Männer die Hand zu reichen, die sie in einer fast zehnjährigen gesellschaftlichen Laufbahn zu deutlich kennen gelernt, um noch die einem Verlobten gegenüber gewiß erforderlichen Illusionen zu besitzen.
Nach einer besonders ausführlichen Besprechung dieser Art ergriff Herr Linter, Geschäftsmann von raschem Entschluß wie er war, das immer noch erübrigende und anerkannt wirksame Mittel, sich seiner Vaterpflichten zu entledigen: eine Reise nach Europa. Nach mehrmonatlichem Umherziehen hatten Vater und Tochter in Berlin Aufenthalt genommen, wo sie in bevorzugten Kreisen ohne Mühe die schmeichelhafteste Aufnahme fanden. Während ihr Vater durch neugeknüpfte, hoffnungsvolle Geschäftsverbindungen in rosige Laune versetzt wurde, war auch Doras Stimmung infolge der neuen Unregelmäßigkeit ihres Lebens und durch die ungewohnten Anregungen der Reise von dem bisherigen Druck der Langeweile und Gleichgültigkeit befreit. So wie sie in ihrem neuen Kreise erschien, den schon bemerkbaren Mangel erster Jugendlichkeit durch den vollendeten Ausdruck der großen Dame ausgeglichen und vergessen gemacht, und auf dem Hintergrunde gedacht, welchen die Millionen ihres Vaters bildeten, stand dem jungen Mädchen alsbald die Wahl unter Männern offen, von denen mancher auch ihrem verwöhnten und etwas abgestumpften Geschmack wünschenswert erscheinen konnte. Wenn gleichwohl der bescheidenste Verehrer, der nicht mehr junge Major a.D. v. Grubeck, den Vorzug erhielt, so waren die Gründe, wie in der Mehrzahl der nicht seltenen Verbindungen eines unbedeutenden Mannes mit einer zu hohen Ansprüchen berechtigten Frau in der tieferen Natur der letzteren zu suchen.
In der Tat sah Dora eine Ehe, wie sie sie nun einging, als die ihren Bedürfnissen einzig angemessene an. Sie berechnete, nur durch das moralische Übergewicht über den Gatten auch die Herrschaft über die eigene Natur erlangen zu können. Das ewig unfruchtbare Reizungsbedürfnis, welches bisher fast allein ihr Gefühlsleben ausgemacht hatte, hoffte sie auf solche Weise befestigen zu können. Hierfür und für alles andere sollte ihr das Bewußtsein der Überlegenheit über die immer noch kräftige Männlichkeit Grubecks Ersatz bieten. Nebenbei, ob sie es nun eingestand oder nicht, teilte sie ein wenig den Respekt vor Herkunft und Titel, welchen ihr Vater, gleich den meisten Deutsch-Amerikanern, unter den Lebensgewohnheiten der Fremde nicht nur bewahrt, sondern sogar verstärkt hatte. So glaubte Dora damals, in der Ehe, welche nach so vielen Kämpfen doch ein Ziel und einen Friedensschluß bedeutete, jedenfalls Ruhe und vielleicht Befriedigung zu finden. Aber sehr rasch, sobald man sich in Dresden niedergelassen, und der alte Herr Linter abgereist war, um die 250.000 Dollar, die er seinem Schwiegersohne hinterlegt, mit möglichster Eile wieder einzubringen, mußte die junge Frau bemerken, daß sie sich in einem Punkte verrechnet hatte. Sie hatte nicht vorausgesehen, daß das eheliche Leben das lange still gebliebene Verlangen ihrer Sinne wieder erwecken würde, ohne ihm doch genügen zu können. An der Seite des ungeliebten Gatten begannen alsbald die Kämpfe von neuem, welche jenem ersten Erlebnisse ihrer Mädchenzeit gefolgt waren. Und wie damals, war auch jetzt das Ergebnis, daß sie sich zurückzog und abschloß in einer peinigenden Furcht, in ihrem jetzigen Gefühlszustande einer Versuchung notwendig erliegen zu müssen, zu welcher sie von ihren versteckten Wünschen gedrängt ward. Auch darin wiederholte sich ihr Schicksal, daß sie, wie damals den jugendlichen Verehrer, nun den Gatten für das Unglück ihrer nie befriedigten Natur verantwortlich machte.
Herr v. Grubeck ahnte seinerseits sehr bald den Haß, der aus den zwischen seiner Gattin und ihm liegenden schweigenden Vorwürfen zuweilen in einem schnellen Wort aufleuchtete. Die Folge war, daß er sich, so viel wie es ihm unauffällig tunlich erschien, von Dora zurückzog, während er zugleich in ihrer Gesellschaft seine Aufmerksamkeiten verdoppelte, beides in einem nicht ganz unberechtigten Schuldbewußtsein, das dahin führte, ihn der Frau gegenüber stets gedrückter und willenloser zu machen.
Die Neigungen der Gatten trafen sich darin, an einem bei allen Annehmlichkeiten der großen Stadt dennoch nicht allzu verkehrsreichen Orte wie Dresden ein behagliches und möglichst zurückgezogenes Leben zu führen. Mit dem für ganz nach außen gekehrte, auf Tatkraft gestellte Naturen, wie die seine so melancholischen Gefühl des herannahenden Alters nahm das Bequemlichkeits-Bedürfnis des Majors zu, der sich mehr und mehr gegen die Pflichten einer nicht um ihrer selbst willen geliebten Häuslichkeit abschloß. Dagegen wurde die Zurückgezogenheit Frau v. Grubecks unmittelbar durch die Verhältnisse und die Stimmung ihres Ehelebens bedingt. Immer beunruhigender und aufreibender ward ihr Zustand der nervösen Angst vor der Annäherung irgendeiner Versuchung. Sie fürchtete, einer Gelegenheit eines verführerischen Umgangs nicht widerstehen zu können, so sehr hatte der aufs neue entfesselte Streit ihrer Triebe sie des notwendigen Sicherheitsgefühles beraubt. Wie die in unserer Natur begründeten Eigenschaften mit dem zunehmenden Alter stets bestimmtere Züge anzunehmen und schärfer hervorzutreten pflegen, so war jetzt die Scheu Doras vor dem geringsten Verstoß wider die gesellschaftliche Moral ins krankhafte gewachsen. Hin und her gezerrt von ihrer leidenden, unbefriedigten Begierde und von der tiefen Angst, die sie sich selbst einflößte, gelangte sie allmählich zu den seltsamsten Widersprüchen. Sie vermochte sich den gefährlichen Träumereien nicht zu entziehen, in welchen sie die intimen Seelenschilderungen der von ihr bevorzugten französischen Romane ausspann, während sie andererseits heftig zusammenschrak, sobald die geringste Anspielung auf die Dinge, mit denen sie sich fortwährend innerlich beschäftigte, vor ihr laut wurde. Es war dies vielleicht die nämliche Regung, die den Verbrecher ergreifen mag, der erfährt, daß ein anderer bei einer Tat ergriffen ist, über welche er selbst seit langem brütet.
Ihr Gatte, der in der ersten Zeit ihrer Ehe noch einigen Verkehr mit früheren Kameraden und anderen ehemaligen Berliner Bekanntschaften pflegte, glaubte sie zuweilen durch kleine Mitteilungen aus der Lästerchronik erheitern zu sollen. Einmal kündigte er Dora an, daß ein junger Offizier, mit dem er sich befreundet, ihr vorgestellt zu werden wünschte.
»Es ist ein netter, übrigens sehr verzogener Junge«, sagte er. »Man nennt ihn hier seit kurzem mit der kleinen Frau v. Wirtz zusammen, obwohl er überhaupt erst seit vier Wochen in Dresden ist. Er ist scharf vorgegangen, wie es scheint.«
»Solche Geschichten finde ich eher traurig als interessant«, fiel Dora ungeduldig ein, »und es liegt mir nicht daran, sie zu hören. Auch verlangt mich gar nicht danach, diesen Herrn hier im Hause zu sehen.«
Herr v. Grubeck ließ unter ihrem unmutigen Blick seinen kurzen Hals ganz zwischen den Schultern verschwinden, und zu der Ratlosigkeit, mit der er die übertriebene Empfindlichkeit seiner Gattin ansah, kam in diesem Falle die Verlegenheit, dem jungen Manne den schon versprochenen Eintritt in sein Haus nachträglich versagen zu müssen.
Zu gleicher Zeit und unter den nämlichen Umständen entwickelte sich Doras Religiosität, welche, durch die ertötende Bitterkeit ihrer seelischen Erfahrungen allerdings der zarten, tröstlichen Verinnerlichung beraubt, Züge des Aberglaubens annahm.
Schließlich trug zu ihrem Bedürfnisse, jede gesellschaftliche Bewegung zu vermeiden und ihre Tage durchaus in häuslicher Ruhe zu verbringen, ein unscheinbarer Zug bei, der aber bewies, daß dieser Frau, die unaufhörlich mit ihrer tiefsten Natur im Kampfe lag, darum die oberflächlichsten Wünsche des weiblichen Herzens nicht fremd waren. Sie konnte nur durch eine sitzende Lebensweise ein kleines Gebrechen, das unbedeutende Lahmen ihres linken Fußes, dem Gatten dauernd verbergen. Vielleicht daß sie sich diesen ihren Wunsch mit der Einsicht erklärt hätte, nur dadurch, daß sie ihren Fehler nicht sichtbar werden ließ, ihre unbeschränkte Überlegenheit über den Mann bewahren zu können. Vielleicht auch, daß diese Erklärung nur zur Hälfte unberechtigt gewesen wäre. Ihr fehlender Teil war aber in der seltsamen Eitelkeit zu suchen, sich auch diesem von Anfang an ungeliebten und auf die Dauer sogar verachteten und gehaßten Manne gegenüber nicht die geringste Vernachlässigung ihrer Haltung zu verzeihen.
Es war dies ein Hervortreten jener auffälligen Erscheinung, welche fast an eine seelische Doppelexistenz mancher Frauen glauben machen könnte. Es ist die Beobachtung, daß auch bei der eigenartig gebildeten, in gewissen Beziehungen von der Allgemeinheit abgesonderten Frau sich unter bestimmten Bedingungen ihrer Lage und ihrer Stimmung Züge der allgemein weiblichen Denk- und Empfindungsart zeigen, die ihren alltäglichen seelischen Gewohnheiten zu widersprechen scheinen. Unter der gewöhnlich sichtbaren Natur eines vielleicht höchst originellen Einzelwesens regt sich unter solchen Verhältnissen die andere Natur, das Gattungswesen. So kam es auch, daß das ursprüngliche Weib in Dora einen stillen aber heftigen Haß unterhielt gegen die erste Gattin des Mannes, an dem sie doch ihrer eigenen Meinung nach nicht genügend Interesse nahm, um eifersüchtig auf jene zu sein, die er geliebt. Den der Verstorbenen zugedachten Haß hatte sie alsbald in doppelter Härte auf das überlebende Kind derselben übertragen, wobei es besonders ins Gewicht gefallen, daß dieses ein Mädchen war. Die durchgängige Verschiedenheit der Natur, welche zwischen Mann und Frau zur Ergänzung führen kann, mußte hier ein wechselseitiges Abstoßen bewirken. Doras ganzes Wesen hatte sich von Anfang an feindlich zusammengezogen bei der Berührung mit diesem Mädchencharakter, dessen harmonische Ruhe sie nicht begriff und, vielleicht durch einen geheimen Neid, wie eine persönliche Beleidigung empfand. Trotz der unausgesetzten Rivalität der beiden Frauen war es indes zwischen ihnen nie zur offenen Aussprache gekommen. Man ging sich meist schweigend aus dem Wege. Anna, die ihrerseits ganz die gleiche instinktive Feindseligkeit seit der ersten Begegnung empfunden hatte, war dabei zu sehr an Überlegung und gerechtes Abwägen gewöhnt, um ihren absprechenden Trieb gegen ein ihr fremdes Geschöpf nicht wenigstens äußerlich zu besiegen. Dagegen fühlte Dora sich unsicher und ratlos vor der überlegenen Ruhe und Offenheit der Gegnerin, dahinter sie geheime Listen suchen zu müssen glaubte. Nichtsdestoweniger hatte sich in dem stillen und erbitterten Kampfe, der zwischen den beiden Frauen geführt ward, zumal Dora daran gewöhnt, all ihr Tun und Lassen mit Hinsicht auf die Wirkung einzurichten, welche es auf die Rivalin hervorbringen mußte. Es war, als ob ihr die Berechnung, mit der sie durch ihr ganzes Sein und Gebahren die Sympathien des jungen Mädchens verletzte, einen Teil der Befriedigung ersetzen mußte, die ihr sonst das überlegte Spiel zwischen den Geschlechtern gewährt hatte.
So hatte sie denn die Nachricht von Annas Verlobung mit sonderbar zusammengesetzten Empfindungen aufgenommen. Während sie sich einerseits durch die Entfernung eines fortwährenden Anreizes ihrer Kampflust nahezu beraubt vorkam, war es ihr doch angenehm, die Gegnerin zur Ehe bestimmt zu wissen, in welcher sie, die nie über ihre eigene Natur und über ihre persönlichen Erfahrungen hinausdachte, stets nur Leiden und Disharmonie erblickte.
Solche Überlegung war es, auf welche die einsame Frau auch an diesem Morgen zurückkam, als sie in der Stille ihres Zimmers die Bedeutung der vorhergegangenen Unterredung durchdachte. Sie sagte sich, daß die Wirkung ihrer Feindschaft wohl imstande sein werde, die Verhaßte auch in die Ehe zu verfolgen. Und doch mischte sich in das Lächeln des Triumphes, das auf der Miene der noch immer regungslos Dasitzenden erschien, ein Schatten von Zaghaftigkeit, als einen Augenblick als klares Bild die Möglichkeit vor ihr auftauchte, wie. Gleich darauf hatte sie den Gedanken von sich geschoben und mit ihm die Ängstlichkeit, die er ihr verursacht, und die sich an das unvermutet mit erschreckender Deutlichkeit vor ihr erscheinende Bild Wellkamps geknüpft hatte. Sie wiederholte sich, daß der Instinkt, der sie in der vergangenen Stunde bei ihrem Eingreifen in die Pläne des jungen Paares geleitet, ausschließlich derjenige der Feindseligkeit gegen Anna gewesen sei. Sie betonte dies mit der Hartnäckigkeit, mit der wir bei solchen Gelegenheiten uns selbst belügen können, indem wir unser Verhältnis zu den Interessen eines anderen in den Vordergrund stellen, um uns zu verschweigen, daß wir uns selbst mit im Spiele befinden, mit unsern eigensten Interessen und Wünschen.