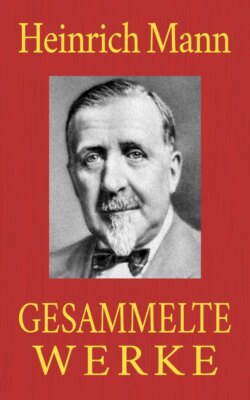Читать книгу Heinrich Mann - Gesammelte Werke - Heinrich Mann - Страница 22
V
Ein demokratischer Adel
Оглавление»Warten Sie mal, ich glaube, es wird gegessen«, sagte Diederich Klempner.
Der alte feine Herr, dem Andreas bald nach seinem ersten Erscheinen in diesen Räumen gegen die Schulter gestoßen hatte, schritt würdevoll mitten durch die gefüllten Salons. Man machte Platz, und er näherte sich der Hausfrau. Gleich darauf begann die Menge der Gäste ihren Durchzug durch das getäfelte Zimmer mit den Gobelins, wo das Buffet stand. Andreas, der mit Klempner neben der Tür stehenblieb, um dem Vorbeimarsch zuzusehen, ging nicht mehr unbeachtet im Strome unter. Er hatte im Verlauf der letzten Viertelstunde Namen und Geltung erlangt. Mit Stolz hielt er die prüfenden Frauenblicke aus, und jedesmal, wenn einer der Herren auf ihn zutrat, sich verbeugte und einen Namen nannte, schlug ihm das Herz höher. Es war ein Triumph, und Andreas fand, daß er ihn verdient habe. Die Laune einer mächtigen Herrin zog eine allen sichtbare Glorie um sein Haupt. War es nur eine Laune? Er mußte sich wohl so betragen haben, daß sie ihn treffen konnte!
Einer der ersten, die vorüberkamen, war ein ungewöhnlich starker Herr, mit schwarzer Perücke und einem glattrasierten Gesicht, das aussah wie das eines abgeschminkten Schauspielers. Er führte Lizzi Laffé am Arm. Klempner merkte, wie Andreas in Erregung geriet.
»Gefällt sie Ihnen?« fragte er mit merklicher Genugtuung. Andreas hatte Lizzi gar nicht beachtet. Er erkundigte sich: »Ist das nicht Herr Jekuser?«
»Wer denn sonst?« sagte Klempner. »Sie kennen wohl Ihren Verleger noch nicht?«
Beinahe überwältigt sah Andreas dem Besitzer des »Nachtkurier« nach, einem der Despoten der Literatur, einem der Beherrscher der öffentlichen Meinung, einem Mächtigen, gegen den der große Chefredakteur Doktor Bediener nur ein Sklave war, und der nun gleich der Masse der anderen Sterblichen über die Galerie des Treppenhauses den Weg in den Speisesaal wanderte.
Türkheimer kam mit der jungen Frau Blosch, Herr Liebling führte die russische Weltreisende Fürstin Bouboukoff, auf die Klempner Andreas aufmerksam machte. Die Dame hatte Schlitzaugen, die wie zwei Kohlenstriche aussahen, und sie hielt eine Zigarette im Munde, auf die Liebling mit leicht mißbilligender Nachsicht herabblickte. Hinterher schlürfte der wie immer entzückt lächelnde Wennichen, mit Frau Adelheid am Arm.
Die Paare folgten endlos einander, untermischt mit jungen Leuten, Börsenbesuchern, Journalisten oder Herren von unbekannter Beschäftigung, die sich ohne Dame zu Tisch zu setzen dachten.
»Da sind unsere Leute«, sagte Diederich Klempner.
»Wir sind natürlich übriggebliebene Herren. Türkheimers sorgen dafür, daß man seine Bequemlichkeit hat. Aber Süß hat vielleicht – Sie bleiben doch an unserem Tisch?« fragte er.
»Mit Vergnügen!« erklärte Andreas.
»Sehn Sie mal. Süß hat die kleine Bieratz. Das gibt ’nen Hauptspaß.«
Süß näherte sich mit einem wunderbar schlanken und zarten jungen Mädchen, das in seinem lichtblauen, schmucklosen und durchsichtigen Kleidchen aussah wie eine Sylphe. Das schmale, feine Gesicht wurde von schwerem aschblondem Haar madonnenhaft eingerahmt, und die großen blauen Augen blickten voll Unschuld geradeaus. Aber da kam Ratibohr, glatzköpfig und nervös, an ihr vorüber. Er wandte sich um und lächelte der kleinen Fee auffordernd zu. Und sogleich, mit einer Bewegung, die Andreas entzückend harmlos und kindlich fand, ließ sie den Arm ihres Begleiters los und ergriff den Ratibohrs.
»Nanu, das war doch früher nicht!« rief Klempner halblaut.
Einen Augenblick stand Süß mit merkwürdig blödem Gesicht da, dann schien er den beiden nachstürzen zu wollen. Aber Duschnitzki, der herbeieilte, legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Keine Dummheiten, Süß!« sagte er.
Er trat mit seinem noch ziemlich verstörten Freunde auf Klempner und Andreas zu, und die vier Herren begaben sich ihrerseits über die Galerie, inmitten einer Doppelreihe von Lakaien, in den Speisesaal.
Andreas blickte erstaunt durch den ungeheuren kahlen Raum, den Dutzende von Tischen füllten und den er mit den übergroßen Räumen eines Monstre-Restaurants verglich. Die Wände waren glattweiß, nur hier und da mit Goldrosetten verziert. Die Decke, mit dunkelrotem Stoff ausgeschlagen, trug einen sehr hoch angebrachten Kronleuchter. Im übrigen war das elektrische Licht verpönt, es standen Kerzen, mit roten Schirmen versehen, auf allen Tischen.
Teller und Gabeln klapperten bereits, auf allen Seiten wurde laut gesprochen, aber Andreas’ Tischgenossen schwiegen noch. Es lag etwas in der Luft. Plötzlich brach Süß los: »So ’ne Kanaille!« rief er laut. Andreas sah sich um, aber im wachsenden Lärm hatte niemand es gehört.
»So ’ne Kanaille! So ’ne …« Süß gebrauchte ein noch härteres Wort, so daß Andreas vor Schreck auf seinem Sitz aufhüpfte. Klempner lachte.
»Wen meinen Sie denn?« fragte er.
»Frage!« schrie Süß. »Die Bieratz doch!«
Andreas fand im stillen, daß die Ungezogenheit, die Süß so sehr aufbrachte, weniger der Kleinen als Ratibohr zuzuschreiben sei.
»Fräulein Bieratz hatte sich wohl Herrn Ratibohr schon früher verpflichtet?« vermutete er bescheiden.
Süß kicherte giftig, Duschnitzki schlug sein weiches melodisches Lachen an, bei dem seine mandelförmigen Sammetaugen mitlachten. Klempner belehrte freundlich den jungen Mann: »Ratibohr hat acht Millionen.«
Andreas zuckte zusammen.
»Hier liegen wohl mehr Millionen auf dem Fußboden umher, als ich Markstücke in der Tasche habe?« fragte er, und er glaubte zu scherzen.
»Hier sind wir Millionäre oder Schubjacks«, erklärte Duschnitzki, und Klempner setzte hinzu: »So ist es. Der Mittelstand stirbt aus.«
Andreas fand die von Duschnitzki beliebte Unterscheidung nicht sehr schmeichelhaft, denn er traute seinen Tischgenossen gerade so viele Millionen zu wie sich selbst. Da der gute Ton es aber zu erfordern schien, lachte er herzlich. Klempner suchte Süß zu trösten.
»Die Bieratz ist doch schließlich nur ein schlechter Abklatsch der Pariser falschen Engel mit den falschen Haar-Bandeaus«, bemerkte er.
»Wem sagen Sie das?« erwiderte Süß, der sich aufheiterte.
»Ist egal«, wandte Duschnitzki ein. »Für ’ne junge Schauspielerin ist doch Tugend das Modernste.«
»Gegen die gepumpte Tugend will ich nichts sagen«, versetzte Klempner. »Das Widerliche ist für mich die falsche Anspruchslosigkeit. Haben Sie wohl bemerkt, daß Werda Bieratz auf ihrem billigen Kleidchen kein einziges Schmuckstück trägt? Nicht mal in den Ohren hat sie Brillanten nötig, sie ist so schlau, die Ohren unterm Haar zu verstecken.«
»Sagen Sie mal«, so unterbrach ihn Süß, »ist es wahr, daß Lizzi Brillanten an ihren Strumpfbändern hat?«
»Warum denn nicht?« entgegnete Klempner nicht ohne Genugtuung. »Sie können sich noch mehr Stellen ausdenken, wo Lizzi Brillanten trägt, und es wird immer stimmen.«
»’s ist aber ’ne abgelegte Mode«, sagte Duschnitzki. »Auf totes Kapital, wie Brillanten, gibt keiner mehr was, und für ein junges Mädchen, wie Werda Bieratz, ist es der höchste Schick, Geld auf der Bank zu haben.«
»Werda soll ’ne halbe Million besitzen«, bemerkte Süß voll Achtung.
»Das ist ja, was ich meine!« rief Klempner und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Es macht Ihnen Spaß, meine Herren, mir zu verstehen zu geben, daß Lizzi älteres Genre ist. Meinetwegen, ich habe nichts dagegen. Aber ich will Ihnen sagen, worin der Unterschied der Generationen eigentlich besteht.«
»Kennen wir!« bemerkte Duschnitzki. »Lizzi hat lange Zeit einen Grafen gehabt, bis der unter die Notleidenden ging.«
»Und als Lizzi zur Bühne kam«, fuhr Klempner fort, »war es Sitte, nicht zu rechnen. Lizzi hat von den Millionen, die ihr durch die Hände gegangen sind, nichts übrigbehalten als ihre Brillanten.«
»Und jeder einzelne ist ein Verdienstzeichen!« rief Süß begeistert.
»Die neue Generation dagegen«, sagte Klempner, »hat das fröhliche Ausgeben nicht gelernt, weil sie es immer nur mit Jobbern zu tun hat, denen die armen Mädchen jeden lumpigen Tausendmarkschein mühsam abkämpfen müssen.«
Andreas ward rot und sah auf seinen Teller. Er meinte, Klempner müsse das Standesbewußtsein seiner beiden Nachbarn beleidigt haben. Aber Süß und Duschnitzki lachten höchst belustigt.
»Die armen Mädchen!« wiederholten sie.
»Eine glückliche sozial-psychologische Hypothese!« sagte Duschnitzki. »Prost!«
»Und so gibt es in der Generation der kleinen Bieratz eine Menge schmutziger Geizhälse und Wucherer. Ich habe gehört, der Engel leiht zu zwanzig Prozent an arme Beamte!« so schloß Klempner triumphierend.
Andreas fand Klempners Prahlerei mit Lizzi Laffé indiskret und wenig ruhmvoll. Lizzi war ja noch ganz passabel, etwas schwer zwar, und ihre blonde Korpulenz machte sich nicht so gut wie bei Frau Türkheimer die brünette. Aber unter dem Puder zeigten sich doch schon rote Flecken in Lizzis Gesicht, und was für einen tadellosen Teint hatte Adelheid!
Er begann, sie in der Menge aufzusuchen, doch der Nachbartisch stand ihm im Wege. Dort saß Rechtsanwalt Goldherz mit der Fürstin Bouboukoff, Liebling, einer anderen, sehr tief ausgeschnittenen Dame und einem jungen Manne, der ein merkwürdig bewegliches Clowngesicht hatte. Süß erzählte Andreas ins Ohr eine äußerst schmutzige Geschichte über die ausgeschnittene Dame, die Fürstin und den jungen Mann, der der Sohn der Fürstin sein sollte. Augenblicklich führte die Bouboukoff mit den beiden anderen einen Prozeß, bei dem der große Goldherz als Vertreter der Fürstin mitwirkte. Die Parteien schienen, da sie miteinander soupierten, einen fröhlichen Waffenstillstand abgeschlossen zu haben.
Andreas hörte unaufmerksam zu. Er blickte zwischen dem korrekten Rücken Lieblings und dem bloßen Nacken der ausgeschnittenen Dame hindurch. Dort hinten saß Jekuser, breit in seinen Stuhl zurückgelehnt, daß die wuchtige Wölbung seiner weißen Weste weithin glänzte. Die schwarze Perücke des mächtigen Mannes war ein wenig in den Nacken geschoben, er goß still und heiter ein Glas Wein nach dem andern hinab. Sein Gesicht – war es das eines Schauspielers oder eines Caesaren? – lachte voll breiten Behagens, aber die beweglichen kleinen Augen straften, wie Andreas meinte, seine Harmlosigkeit Lügen. ›Das ist einer, für den es hier keine Geheimnisse gibt‹, dachte der junge Mann voll Bewunderung. Duschnitzki, der sanft seinen Arm berührte, redete ihn an.
»Sie irren sich. Die schöne Hausfrau sitzt auf der anderen Seite.«
»Ist doch ’n großartiger Kopf!« sagte Andreas.
»Wer?«
»Jekuser.«
Anfangs schwiegen die anderen. Dann äußerte Süß kurz und abweisend: »Was ist denn schließlich der Jekuser?«
»Ist doch auch nur ’n ganz gewöhnlicher Hausierer«, erklärte Klempner. Duschnitzki setzte mit liebenswürdigem Lächeln hinzu: »Er sammelt Annoncen, wie andere Lumpen sammeln.«
Andreas wurde sich bewußt, eine gewisse peinliche Stimmung erregt zu haben. Was hatten seine drei Nachbarn gegen Jekuser? Offenbar gar nichts. Aber es war schlechter Ton, irgend jemand oder irgend etwas offen zu bewundern. Andreas nahm sich vor, dieses Gesetz nicht wieder zu verletzen, in Gesellschaft wenigstens niemals. Frau Türkheimer gegenüber war es vielleicht etwas anderes? Da, wo er einen ungewöhnlichen Eindruck machen wollte, durfte er doch nicht den Allerweltsgeschmack nachahmen. Dort war es vielleicht hohe Politik, sich so zu zeigen, wie er wirklich war?
Das frugale Abendessen bestand aus einem Hummersalat und einer kalten Kalbsschnitte. »Nur gerade der gesunde Nährwert, das ist das Feinste«, erklärte Duschnitzki. Aber am Hummersalat war ungeheuer viel Senf, der Andreas zum Weinen brachte, während ihm die scharfe Kräutersauce, die man zum Kalbsbraten aß, die Eingeweide verbrannte. Er mußte deshalb mehr trinken, als ihm eigentlich lieb war, denn es stand ihm als Schreckbild vor Augen, was daraus werden würde, wenn er sich in betrunkenem Zustande kompromittierte. Er beneidete die anderen, die sich ihrem Leichtsinn hingeben durften, falls sie welchen hatten, denn sie befanden sich hier gewissermaßen in gesicherter Stellung. Er, Andreas, aber wagte gerade seine ersten, tastenden Schritte.
Während ein paar geeiste Ananasscheiben herumgereicht wurden, schlug drüben jemand ans Glas. Gleich darauf erhob sich Waldemar Wennichens kleines lächelndes Haupt mit dem tanzenden weißen Flaum auf der kahlen Stirn hoch über seine Umgebung. Der berühmte Dichter sprach jetzt nach dem Essen mit noch mehr erstickter Fistelstimme als vorher, auch war die Stille im Saal nicht mustergültig. Man verstand so viel, daß es sich um die Verbindung zweier Patrizierhäuser, um einen demokratischen Adel und um ähnliche Dinge handelte. Als Wennichen in die Menge zurückgetaucht war, sprach es sich herum, daß dieses Fest eigentlich eine Art Vorfeier sein sollte für die Hochzeit der Tochter des Hauses, Fräulein Asta Türkheimer, mit dem Freiherrn von Hochstetten.
Alsbald suchten viele Blicke das Brautpaar auf. Andreas bemerkte, daß Fräulein Asta ein recht unzufriedenes Gesicht machte. Wennichens Rede mußte ihr gar nicht gefallen haben. Asta war hübsch, litt aber für Andreas keinen Vergleich mit ihrer Mutter. Ihre Figur, in der sich die Fülle auch schon anzeigte, schien doch mehr zur Untersetztheit zu neigen, ihr brünetter Teint war nicht so rein, die zusammengewachsenen Brauen verfinsterten das Gesicht, und der große Mund hatte etwas Willkürliches, das Andreas bange machte.
Der Bräutigam, der Asta gegenübersaß, war eben der Herr mit spärlichem Haar und schütterm weißblonden Spitzbart, dem Fräulein Türkheimer entgegenging, als Andreas ihr bald nach seinem Erscheinen auf die Schleppe getreten hatte. Hochstetten hielt eine schmale, unendlich lange und bleiche Hand an die Schläfe gelegt. Er saß schläfrig über den Tisch geneigt und sprach mit seiner Braut, ohne daß sein Gesicht sich bewegte. Lange, hängende Kiefer und eine feine gebogene Nase gaben ihm ein durchaus edles Pferdeprofil. Seine großen mattblauen Augen träumten, man mochte Hochstetten beobachten, wann man wollte, immer nur vor sich hin, woran wahrscheinlich bloß Blutleere schuld war. Andreas ward dies klar, als am Nebentisch, wo Rechtsanwalt Goldherz saß, die laute Bemerkung fiel: »Müde Rasse!«
Der junge Mann bewunderte im stillen den großen Verteidiger. »Müde Rasse!« In einem solchen Ausdruck lag die abgeschlossene wissenschaftliche Weltanschauung, für die Goldherz so häufig praktisch Verwendung fand und die vor Gericht seine Überlegenheit über den Staatsanwalt begründete.
Andreas hatte inzwischen mehr Sekt getrunken, als ihm lieb war. Etwas anderes kam nicht auf den Tisch, denn Klempner hatte erklärt, daß es bei dieser rapiden Abfütterung nicht der Mühe wert sei, sich in einen Wein zu vertiefen, der Verständnis und Sorgfalt erfordere. Die Gedanken des jungen Mannes begannen zu vagabundieren. Von Asta, Hochstetten und Rechtsanwalt Goldherz kehrten sie, ehe er es sich versah, zu Frau Türkheimer zurück. Der leichte Champagnerrausch half seinem sanguinischen Temperament, die Schüchternheit des Neulings zu besiegen, und plötzlich, zu seiner eigenen Überraschung, sagte er sich rundheraus, daß er Adelheid besitzen wolle. Er erblickte augenblicklich gar kein Hindernis. Denn er stellte sich mit stiller Genugtuung eine lange Reihe von Liebhabern vor, die sie vor ihm gehabt haben mußte. War es nicht ganz natürlich, daß jetzt auch er an die Reihe kam? Eben noch hatten alle durch ihre plötzliche Beachtung ihn merken lassen, daß die Königin ihm, dem armen Pagen, das Taschentuch zugeworfen habe. Auch fand er sich ja im denkbar günstigsten Augenblick ein, gerade als Ratibohr die vierzigjährige Dame in einsamer Trauer zurückgelassen hatte. Wie viele Tröster würde sie wohl noch finden? Sich von ihr in Gnaden aufnehmen zu lassen, war eigentlich eine zu leichte Aufgabe und nicht besonders ruhmvoll. Aber als erste Stufe zum ferneren Emporkommen mochte man es mitnehmen. Denn dies war kein Idyll, und es handelte sich nicht darum, Frau Generalkonsul Türkheimer auf eine Liebesinsel zu entführen. Es hieß ein moderner junger Mann sein, wie zum Beispiel Asta ein modernes junges Mädchen war. Ja, auch Asta war bei der Sache zu bedenken und daneben Türkheimer, der Schwiegersohn, wer weiß, vielleicht die Eifersucht anderer Bewerber, das Übelwollen vieler, die Meinung einer ganzen Gesellschaft. Asta vor allem flößte ihm eine unbestimmte Furcht ein. Ohne es zu wissen, hatte Andreas sich mehrmals nach ihr umgesehen.
»Der sollten Sie den Hof machen«, sagte plötzlich Duschnitzki, der ihn teilnahmsvoll prüfend betrachtete.
»Dem Fräulein Asta? Warum denn?« fragte Andreas.
»Um ihre wohlwollende Neutralität zu erlangen.«
»Sehr richtig«, bemerkte Klempner. »Sie wissen wohl nicht, daß Asta die Liebhaber ihrer Mutter als ihre persönlichen Feinde betrachtet? Dem Ratibohr hat sie einen Streich gespielt.«
»Ein bösartiger Charakter, sage ich Ihnen!« rief Süß mit Tränen in der Stimme. Der reichliche Sektgenuß machte ihn weich und melancholisch. Andreas erkundigte sich: »Ist Asta eifersüchtig auf ihre Mutter?«
»I wo! Sie verachtet die Mama!«
»So moralisch?«
»Moralisch aus Snobismus«, erklärte Klempner. »Asta fühlt das Bedürfnis, ihre soziale Stellung zu verbessern. Ihre Mutter könnte drei alte Grafen auf einmal haben, und sie würde sie ihr nicht übelnehmen. Aber gegen die jungen Talente hat sie nun mal ein Vorurteil.«
Andreas dachte an Kaflisch und sagte mit Betonung: »Sie ist eben ein modernes Weib, mehr intellektuell als Geschlechtswesen.«
»Modern besonders im Geldausgeben«, versetzte Duschnitzki. »Sie kostet Türkheimer geradesoviel wie seine Mätressen.«
»Und das sollte eine Tochter doch nicht!« fügte Süß aufs höchste bekümmert hinzu. Duschnitzki fuhr fort: »Und dabei verachtet sie auch Türkheimer mitsamt seinen Geschäften, und sie sagt es jedem, der es hören will!«
»Die Unglückliche! Sie ist aus der Art geschlagen!« jammerte Süß.
»Sie kauft sich einen Namen! Was ist denn so ’n abgetragener Name heute wert?«
»Kunststück!« meinte Klempner. »So ’nen Baron und gar ’nen Geheimrat vom Neuen Kurs kann sich doch jetzt schon der gute Mittelstand leisten, seit der Adel sich den Liberalismus anschafft, den wir abgelegt haben!«
Es wurden Schalen mit Zigarren und Zigaretten auf den Tisch gestellt. Andreas, der Feuer brauchte, ließ sich den silbernen Kandelaber herüberschieben. Dieser bestand aus einer fein ziselierten Säule, an der Colombine lehnte, die sich von einem Herrn küssen ließ. Pulcinella stand dabei und hielt den Leuchter, den er auf den Rand der Säule schob. Andreas sah die Welt rosenfarbig und verspürte Lust, sich für irgend etwas zu begeistern, erinnerte sich aber noch rechtzeitig, daß dies für unpassend galt. Er sagte daher einfach: »Eine recht nette Arbeit!«
Duschnitzki bestätigte dies: »Nichts dagegen einzuwenden!«
Klempner begann sogleich seine weinselige Beredsamkeit über die Bedeutung zu verbreiten, die der Pulcinellafigur in der Geschichte der Menschheit zukam. Er sah in ihr den komisch aufgefaßten Typus des reinen Naturkindes, das ohne moralisches Vorurteil an die Dinge herantritt, zu Niederträchtigkeiten in seiner Unschuld ebenso geneigt wie zu Heldentaten, und er verglich sie mit Parsifal und Siegfried, die denselben Charakter von der tragischen Seite darstellten. Sein Blick glitt verschleiert und unsicher zu Andreas hinüber, er schien plötzlich eine Entdeckung zu machen und rief aus: »Sie, mein Lieber, haben eigentlich was davon!«
Andreas war zu versöhnlich gestimmt, um auf Klempners Anzüglichkeit einzugehen. Er fragte: »Wer ist der Künstler?«
Süß belehrte ihn mit rührseliger Entrüstung.
»Menschenskind, Sie kommen aus Gegenden, wo man Claudius Mertens nicht kennt? Blicken Sie mal dorthin, und Ihr Auge wird einem großen Manne begegnen!«
In der bezeichneten Richtung entdeckte Andreas einen breitschultrigen Herrn mit gutmütigem Gesicht, blondem Vollbart und nachlässig gebundener Krawatte. Er hielt das Bein übergeschlagen und eine Hand daraufgelegt, die ungewöhnlich kräftig aussah und so breite gedrungene Finger hatte, daß Andreas zweifelnd das zerbrechliche Kunstwerk vor sich auf dem Tische betrachtete.
›Wie hat er das gemacht?‹ fragte er sich. Er äußerte: »Claudius Mertens? Ich habe den Namen nie gehört.«
»Sie sind entschuldigt«, erklärte Duschnitzki. »Claudius ist über einen gewissen Kreis hinaus fast unbekannt, und das ist sein Ruhm. Er stellt nichts aus und arbeitet nur für ein paar Häuser wie Türkheimers, die ihn kolossal dafür bezahlen, daß er die Modelle seiner Werke vernichtet.«
»Merkwürdig!« meinte Andreas.
»Das ist das Feinste!« jammerte Süß. »Was für ’n großer Mann!«
»Wollen Sie das Claudius-Kabinett sehen?« wurde Andreas von Klempner gefragt.