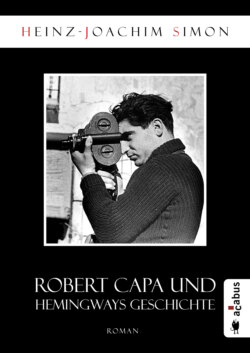Читать книгу Robert Capa und Hemingways Geschichte - Heinz-Joachim Simon - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4.
Armut hat keine Romantik, genau so wenig wie der Krieg. Anderweitige Behauptungen sind Kitsch. Selbst wenn man jung ist und zurechtkommt und sich durchschlägt, bleibt von den Tagen der Armut etwas zurück, eine Wunde, die nie ganz ausheilt. Auch wenn sie nicht offensichtlich ist, so ist sie doch da. Man schleppt sie mit sich ein Leben lang und versucht den Schmerz zu lindern, den ewigen Hunger zu stillen, den Hunger nach Leben. Wenn man Schriftsteller ist, brüllt man seinen Schmerz hinaus mit der Frage Warum? und sucht mit durstigen Zügen das nachzuholen, was man versäumt hat. Wenn man in Bildern denkt, sucht man in Farben und Sujets die Wahrheit und lässt sich, arriviert, dann Malerfürst nennen oder Jahrhundertgenie.
Noch träumte er nur davon, wie es sein würde. Seine Fantasie ließ ihn die Annehmlichkeiten der großen Hotels und der berühmten Restaurants erleben. In den warmen Sommernächten hörte er sehnsuchtsvoll das perlende Lachen der Frauen auf den großen Boulevards. Bevor er es erlebte, kannte er bereits die rauschhaften Momente, ahnte dahinter die Tragik, wie in den Erzählungen von F. Scott Fitzgerald.
Doch die Wirklichkeit sah für André Friedmann noch anders aus, obwohl er im Romanischen Café die Nähe der Männer suchte, von denen er annahm, dass sie den Gipfel erklommen hatten. Schriftsteller, Journalisten, Maler und Philosophen saßen neben Scharlatanen und Versagern. Nur durch Tische getrennt wurde überall gesonnen, deklamiert, gefordert und gezweifelt.
Im Romanischen Café konnte man umsonst Zeitung lesen und wurde auch nicht bedrängt, wenn man den ganzen Abend nur bei einem Glas Wasser blieb, das man mit Zucker veredeln konnte. Oft wurde er, meist von Zeitungsleuten, zum Schachspiel eingeladen, worin er bald eine Meisterschaft erreichte, die ihn zu einem begehrten Mitspieler machten, dem man gern einen Kaffee oder Cognac spendierte. Selbst im so genannten „Schwimmerbassin“, dem Teil des Restaurants, der für die Arrivierten reserviert war, wurde man auf das stets freundliche oder verschmitzt lächelnde Gesicht aufmerksam, und schließlich durfte er auch dort sitzen, wenn ihn einer von der Vossischen Zeitung oder der Frankfurter zu sich gewunken hatte. Selbst Nerz, der meist gestrenge Zerberus und Portier, freute sich, wenn André durch die Pendeltür trat und diesen nach dem Wohlbefinden von Weib und Kindern befragte.
Sie saß am Fenster vor der Veranda, und das Licht von draußen verlieh ihrem Haar eine Aura gleißenden Goldes. Sie sah in ihrem dunklen Kostüm elegant und reich aus: das Sinnbild der Mädchen, die er nicht mehr anzusprechen wagte. Doch es war Eva, seine Eva aus der Varoshâz–Straße, die er einmal in einem Boot geküsst hatte. Es gab keinen Zweifel. Trotzdem zögerte er, zu ihr zu gehen, so sehr fiel seine Erscheinung gegen sie ab. Doch die Erinnerung an den unwiederbringlichen Moment im Boot ließ ihn schließlich doch aufstehen. Als er vor ihr stand, sah sie fragend hoch, und ein Leuchten flog über ihr Gesicht, und sie sprang auf und umarmte ihn.
„André, du bist es tatsächlich!“
„Ja. Leibhaftig!“, sagte er ungeschickt und drückte sie nach einem Zögern an sich, und sie ließ es geschehen und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
„Vater hat mir geschrieben, dass du fort musstest“, sprudelte sie aufgeregt heraus. „Dass du hier in Berlin bist, wusste ich nicht.“
„Ich musste Hals über Kopf Budapest verlassen. Leider hatte ich deine Adresse nicht“, log er.
Doch er kannte den Namen ihres Fotoateliers. Er hatte sie nur deswegen nicht aufgesucht, weil er anfangs anderes im Kopf hatte und sich später seines abgerissenen Zustandes schämte. Ihr Held aus Kindertagen durfte sich nicht in dieser Aufmachung zeigen.
„Komm, setz dich zu mir! Setz dich“, drängte sie und zog ihn auf den Korbstuhl gegenüber.
„Ich habe leider kein Geld, um dich einzuladen“, gestand er unglücklich.
Am besten, sie wusste gleich, wie es um ihn stand.
„Das macht doch nichts. Ich lade dich ein. Mach dir darüber keine Gedanken.“
Sie winkte den Ober heran.
„Was möchtest du trinken?“, fragte sie ihn.
„Ein Kaffee wäre schön. Nein, vielleicht eine Schokolade?“, fragte er hoffnungsvoll, denn sie würde auch seinen Hunger stillen.
„Eine Schokolade“, sagte sie zum Ober, worauf dieser höflich nickte.
„Bist du oft hier?“, fragte sie und griff nach seiner Hand, und er sah, wie in ihr Gesicht ein schmerzlicher Ausdruck trat.
Er tat ihr leid, und das machte seine Scham nicht geringer.
„Ja. Oft. Es ist ein gutes Café.“
„Dir geht es nicht gut, nicht wahr?“, fragte sie und musterte bekümmert den schlecht sitzenden Anzug und sein verhärmtes Gesicht.
Nur die Augen, so fand sie, erinnerten noch an den alten unbekümmerten Frechdachs, an Bandi, wie sie ihn im Viertel nannten, den Schrecken der Varoshâz.
„Ich habe keine Arbeit“, stammelte er. „Ich helfe nur manchmal in einem Atelier aus. Laufburschenarbeit. Aber wenigstens dir scheint es gut zu gehen.“
„Ja. Ich werde die Lehre im Fotoatelier im nächsten Jahr beenden. Sie wollen mich übernehmen. Ich habe schon einige Arbeiten in der Vossischen untergebracht.“
„In der Vossischen?“, staunte André. Sie war also schon weiter als er und hatte das Tor für eine gesicherte Zukunft bereits aufgestoßen.
„Das freut mich für dich. Dann bist du eine richtige Fotografin.“
„Bald. Und was willst du aus dir machen?“,
„Ich werde wohl als Zigeuner enden. Keine Ahnung!“, erwiderte er und versuchte ein Douglas–Fairbanks–Lächeln und erzählte von seinem Studium, das er nun wegen Geldmangels abbrechen müsse, was nur die halbe Wahrheit war. Der Journalismus, zu dieser Überzeugung war er nun gekommen, war wohl doch nicht das Richtige für ihn. Er spürte keine Leidenschaft, mit dem Wort zu arbeiten, und er wollte nichts tun, was keine Begeisterung in ihm auslöste.
„Aber was soll aus dir werden?“, fragte sie besorgt und drückte seine Hand.
„Ich warte noch auf mein Damaskus, würde ich sagen, wenn ich Christ wäre. Vielleicht sollte ich wie du Fotograf werden“, ergänzte er leichthin.
Es war nur so eine spontane Idee, und sein Lachen sollte ihr sagen, dass sie seine Worte nicht ernst nehmen solle.
„Wenn das so einfach wäre. So etwas bedarf eines Studiums oder zumindest einer Lehre, und obendrein muss man Beziehungen haben. Es gibt hier in Berlin bereits zu viele Ungarn, die versuchen, mit fotografieren über die Runden zu kommen.“
„Wenn ich wenigstens eine Arbeit hätte, die mir regelmäßig Geld bringt. Alles andere wird sich schon ergeben.“
„Stimmt. Erst einmal brauchst du eine feste Anstellung. Ich werde mich mal umhören. Aber da du nichts gelernt hast, wird es nichts Großartiges sein.“
„Hauptsache, ich habe erst einmal eine Anstellung. Danke, dass du mir helfen willst.“
Er drückte ihre Hand.
„Das ist doch selbstverständlich! Du bist doch mein Bandi, der Schrecken der Varoshâz Straße“, sagte sie zärtlich und fuhr sich mit der Hand durch ihr blondes Haar.
André dachte wieder an die Nacht auf dem Boot.
„Was hast du von zu Hause gehört?“, fragte er verlegen.
„Es geht immer schlechter“, erwiderte sie seufzend.
Sie schwärmten noch lange von Budapest und ihrer Kindheit und von den guten Tagen in der Varoshâz–Straße, als sie noch keine Not kannten, die Sonne über dem Viertel lag und die Wildgänse dicht über die Donau flogen. Die Nacht im Boot übergingen sie. Sie lachten viel, da André immer komischere Begebenheiten einfielen. Meist stand der Vater, der elegante Tunichtgut und Lebemann Dezsö Friedmann im Mittelpunkt, und so wie André es erzählte, war es ein lustiges Leben, wenn dieser morgens die Nachbarn mit einem Geldbündel in der Hand zusammentrommelte und Champagner kommen ließ, was bei der Mutter regelmäßig großes Zetern auslöste, das ihn jedoch wenig beeindruckte und am Nachmittag wieder aus dem Haus trieb, um sich am nächsten Tag wie gewohnt ins Haus zu schleichen, weil sich die gewonnenen Reichtümer wieder mal in Luft aufgelöst hatten.
„Auch mein Vater überlegt, ob die Familie Ungarn verlässt“, sagte sie traurig. „Aber in Deutschland sieht es nicht besser aus. Wohin soll man sich wenden?“,
„Vielleicht nach Amerika?“,
„Die haben dort gerade auf uns Ungarn gewartet.“
„Nirgendwo wartet man auf uns.“
Als es Zeit war aufzubrechen, erhob er sich mit ihr und begleitete sie hinaus auf die Glasveranda. Sie merkte ihm an, dass er erwartete, dass sie ihn zu sich einlud.
„Ich bin mit jemandem zusammen, André“, gestand sie zögernd. „Ich glaube, das solltest du wissen.“
„Ach ja“, tat er unbeeindruckt.
Doch er war bestürzt. Die Vertrautheit, die eben noch zwischen ihnen gewesen war, verflog schlagartig. Er hatte während des Gesprächs gehofft, dass die Erinnerung an die Nacht im Boot und die gemeinsamen Kindertage sie hier in der Fremde zusammenführen würden. Er war nicht in sie verliebt, doch dies wusste er erst später, als er wirklich liebte. Sie war ihm zu sehr vertraut, ein Kamerad. Eine Jugendliebe eben, aber er hatte geglaubt, dass sie sich hier in Berlin neu entdecken würden.
„Sei nicht traurig“, sagte sie hastig, weil sie ihn kannte und durchschaute und wusste, dass die Eröffnung ihm wehgetan hatte.
„Wir müssen Realisten sein. Ich bin ein Jahr älter als du, und das damals, das war eine Kinderliebe. Ich muss an mein Fortkommen denken. Er ist der Sohn des Tuchhändlers Groskoj. Du wirst den Namen kennen. Er beliefert auch deine Mutter. Er studiert hier Wirtschaftswissenschaft. Ein ernster junger Mann mit Ambitionen. Ich darf ihn nicht enttäuschen.“
„Verstehe. Natürlich“, murmelte er und starrte auf seine abgenutzten Schuhe.
„Mein guter alter Bandi“, sagte sie traurig. „Wir sind nicht mehr in Budapest. Die schönen Kindertage sind vorbei.“
„Dann werden wir uns nicht wieder sehen?“
„Warum denn nicht?“, sagte sie eifrig. „Ich wollte dir nur klar machen, wie es um mich steht. Gib mir deine Adresse. Ich werde dir eine Nachricht zukommen lassen, wenn ich höre, wo eine Stelle frei ist. Ich lasse dich nicht im Stich, Bandi.“
Sie tauschten ihre Adressen aus. Sie wohnte in Charlottenburg, in einer wohlanständigen Gegend. Das war etwas anderes als die Hackeschen Höfe.
Nachdem sie sich getrennt hatten, fühlte er sich leer und unnütz. Langsam ging er die Straße zum Wittenbergplatz hoch. Es fing an zu regnen. Der Wind kam von Osten. Er schlug den Kragen hoch und stapfte durch die Regenlachen und fühlte seine Füße nass werden. Er fühlte sich von der Welt verlassen und dachte daran, wie es einmal gewesen war, damals auf dem Boot, als Eva sich an ihn drückte. Er seufzte. Sie hatte recht. Diese Tage kehrten nicht wieder. Als ihn ein Mädchen ansprach, ob er mit ihr gehen wolle, zog er unglücklich die Schultern hoch und ging wortlos weiter.
Am nächsten Tag ging André ins Museum. Wie immer sonntags. Die Museumsangestellten kannten ihn bereits. Vor dem Dom, zwischen Zeughaus und Spreekanal, gab es eine Bratwurstbude, die ihm für ein paar Pfennige das sonntägliche Mittagsmahl sicherte. Für diese Minuten des Genusses nahm er sich Zeit, aß mit Bedacht und kaute jeden Bissen gründlich. Trotzdem blieb das Hungergefühl. Dann ging er über den weiten Platz am Alten Museum mit dem riesigen Standbild des Kaisers Friedrich Wilhelm vorbei zu den Kolonnaden der Nationalgalerie und weiter zum Pergamonmuseum und schritt fast feierlich die Stufen hoch, nickte der Kassiererin zu und löste die ermäßigte Studentenkarte, um nun mit innerer Sammlung die andere Welt zu betreten.
Zuerst begrüßte er Hadad, den alten Wettergott, mittlerweile ein guter Bekannter, der übermannsgroß die Halle dominierte und auf André herabsah, archaisch, grausam und unerschütterlich. Trotzdem mochte er ihn, nicht für das, was er einst den Menschen bedeutet haben mochte, sondern für die Verlässlichkeit, die er ausstrahlte. André war sich sicher, dass er noch in tausend Jahren dort stehen würde, ebenso wie die großen sphinxartigen Figuren mit Königsköpfen vor der Prozessionsstraße zu Babylon.
Er ging an den blau gekachelten Mauern mit den Löwen vorbei zum Ischtartor und bewunderte die Fabelwesen, die Drachen und Einhörner, und wie jedes Mal erfasste ihn ein Schauer, denn sie erinnerten daran, dass einst nur wenig weiter der Etemenanki mit dem Tempel des Bel Marduk stand, in dem Nebukadnezar opferte und viel später Alexander. Und nichts als diese Straße war von der großen Stadt, der Hure Babylon, wie sie die Bibel nennt, geblieben. Die Tempelmädchen tanzten nicht mehr. Nur die bunten Steine, die man einst Berlin schenkte, kündeten von diesem Land und der Stadt und vom Anfang der Zeit. Er durchschritt das Tor und war nun dort angelangt, wo er sich am wohlsten fühlte, im griechischen Mythos. Er bewunderte das Tor von Milet und lief weiter und war endlich unter den Heroen, die rings um den Pergamonaltar auf ihn herabsahen. Er setzte sich auf die Treppe und hielt Zwiesprache mit ihnen, beklagte sein Schicksal und sprach zu ihnen, als wären unter den Titanen die Götter, die ihm verpflichtet waren, die ihn und sein Schicksal doch kennen mussten. Er hatte unter den Figuren seine Favoriten, heroische Gestalten mit Engelsflügeln und Gesichtern, die von Heldenmut und edler Gesinnung kündeten und selbst in der Niederlage den Anspruch des Guten hochhielten, dass das Böse zu überwinden war. Er hatte ein sehr persönliches Verhältnis zu den Figuren, das nichts oder nur wenig mit dem zu tun hatte, was sie den Menschen zu Pergamon einst bedeuteten.
Hier blieb er viele Stunden, sah den Besuchern zu und lauschte den Führungen, selbst wenn Braunhemden, was selten genug geschah, die Heiligkeit des Ortes störten. Diesmal waren es schwarz Uniformierte, die in blanken hohen Stiefeln hereinmarschierten und Lärm machten und André in seinen Betrachtungen störten, der nun am Eingang zum nächsten Saal saß und zu seinem Favoriten, einem von den Göttern gestürzten Engeltitanen hoch sah. An der Spitze der Schwarzhemden ging ein schmalbrüstiger wichtig blickender Mann mit einer Nickelbrille, nickte gewichtig und rief den hinter ihm drängenden Männern zu, dass auch sie von der gleichen Art seien und die wahre Kunst nur so aussehen könne.
„Arisch, meine Herren! Alles arisch. Sieht man sofort. Sehen Sie sich die Köpfe an. So sehen arische Menschen aus, die sich nicht mit anderen Völkern vermischt haben. Was heute dort in Griechenland lebt, hat zweitausend Jahre der Vermischung hinter sich. Deswegen ist es nur richtig, dass diese wunderbaren Kunstwerke bei uns zu sehen sind.“
„Der hat keine Ahnung, dass der Pergamonaltar einst in der Türkei stand“, sagte jemand hinter André und stieß geräuschvoll die Luft aus.
André wandte sich um. Ein kleiner Mann mit einem Buckel, einem Homunkulus ähnelnd, mit dicken Augengläsern, hinter denen sich vergrößert blaue Augen zeigten. Seine dunkle Kleidung mochte einst elegant und teuer gewesen sein, wies aber nun Flecke auf. Das graue, vorn schüttere Haar war hinten zu lang und umrahmte seinen Kopf wie einen Heiligenschein. Er erinnerte André an einen Professor, was bei ihm unangenehme Gedanken an die Hochschule auslöste.
„Aber damals lebten dort Griechen“, antwortete André. Das Kunstwerk ist reinster Hellenismus.“
Der Alte nickte.
„Gut in der Schule aufgepasst. Aber mit dem arischen Unsinn hat es nichts zu tun.“
„Wer sind diese Männer in den schwarzen Uniformen? Es sind doch Nazis, oder?“
„Sie kennen sie nicht?“
„Nein. An den Armbinden mit dem Hakenkreuz sehe ich, dass sie Nazis sind.“
„Das ist der sogenannte Reichsführer der SS mit seinen Schlägern. Hitlers Leibtruppe.“
„Sie sehen martialisch aus!“, sagte André und sah auf einen großen blonden Mann hinter dem oberlehrerhaft mit erhobenem Zeigefinger dozierenden Anführer.
Ein Mann, der dem Bildhauer Breker gefallen hätte. Das Gesicht eines Kriegers mit starken Kinnbacken, einer kräftigen Nase und blauen Augen.
„Die Auslese des Hühnerzüchters!“, kommentierte der Homunkulus.
„Hühnerzüchter?“,
„Das Männlein vor der Gladiatorentruppe dort war einmal Hühnerzüchter.“
„Diese Kerle verderben mir die Stimmung“, klagte André.
„Sie werden noch mehr verderben!“, sagte der Gnom und wiegte sorgenvoll den zu großen Kopf.
Die Gruppe ging nun fast im Gleichschritt in den nächsten Raum, es klang wie der Marschtritt von Regimentern, drohend, herausfordernd und mitleidlos.
„Sind Sie Student? Ich habe Sie schon öfter hier gesehen“, sagte der Gnom.
„Ich … ich studiere Politik und Journalismus.“
Es war das einzig Respektable, was er vorweisen konnte, und wenn es auch nicht mehr so ganz stimmte, da er seit Wochen nicht mehr die Vorlesungen besuchte, so hatte er doch immer noch einen Studentenausweis.
„Dann werden Sie wissen, was in Deutschland falsch läuft.“
„Nicht nur in Deutschland. Ich komme aus Ungarn“, setzte André hinzu.
„Ach ja? Es sind viele Ungarn in Berlin.“
„Für uns war Berlin immer ein verheißungsvoller Traum, die Stadt der Kultur, Spreeathen.“
„Das wird es nicht mehr lange sein, wenn die dort an die Macht kommen. Studieren Sie nicht nur die Machtpolitik. Studieren Sie das wirkliche Deutschland, was dieses Land einst ausmachte: Lessing, Herder, Kant. Kant vor allem.“
„Ich habe davon in Deutschland nicht mehr viel vorgefunden.“
„Aber es ist immer noch da. Man muss es nur entdecken.“
Der Gnom blinzelte ihm zu und ging dann zum Saal mit dem Tor von Milet. Auch André erhob sich und wandte sich in entgegengesetzter Richtung den Statuen zu, die sein Bild von Griechenland geprägt hatten. Das geheimnisvolle Lächeln des Kouros gab ihm die Ruhe zurück, die der Auftritt der Schwarzgekleideten gestört hatte.
Als André vor einem Alexanderkopf stand, sprach ihn der arisch aussehende Mann, den er hinter dem Anführer der Schwarzen gesehen hatte, an.
„Der Kopf eines Kriegers. Ein wahrhafter Held und Mensch. Er hat mit seinen Feinden kein falsches Mitleid gehabt.“
„Immerhin wollte er die Völker vermischen.“
Der SS–Mann fuhr zurück, als habe André etwas Blasphemisches gesagt.
„Vermischen? Niemals! Davon ist mir nichts bekannt.“
„Haben Sie nicht von der Massenhochzeit zu Susa gehört?“
„Das schon. Dem Sieger gehören die Weiber.“
„So primitiv war es nicht. Er wollte die Verbrüderung der Völker.“
„Sie sind wohl ein ganz Linker, was?“, fragte er nun feindselig.
„Man ist nicht links, nur weil man sich in Geschichte auskennt.“
„Na, mit solchen Ansichten ist Schluss, wenn wir die Macht übernommen haben. Dann wird deutsche Geschichte gelehrt, deutsche Philosophie, deutsche Kunst. Wahrscheinlich haben Sie die falschen Professoren gehabt. Sie sind doch Student?“,
André nickte und wiederholte das, was er dem Gnom gesagt hatte. Gegenüber den römischen Statuen hörte er den Hühnerzüchter von Cäsar schwärmen, als Mann der Tat.
„Alle tausend Jahre kommt ein Mensch, der alle überragt und mit dem eine neue Epoche beginnt!“, tönte der Führer der SS.
„Auf den kann er noch lange warten“, kommentierte André trocken.
„Was? Wusste ich es doch, dass Sie keiner von uns sind. Haben Sie noch nichts vom Führer gehört?“, stieß der Blonde hervor. „Der nationalsozialistischen Studentenschaft gehören Sie jedenfalls nicht an.“
Er zog seinen breiten Gürtel hoch und wippte mit den Fußspitzen auf und ab, als wolle er André einem peinlichen Verhör unterziehen.
„Nein. Aber auch nicht den Kommunisten.“
„Also einer, der im entscheidenden Kampf unseres Volkes nicht Stellung beziehen will. Oder sind Sie gar Ausländer? Ihr Deutsch hört sich ja ein wenig hart an.“
„Ich bin Ungar.“
„Ach so. Dann kennen sie sich bei uns noch nicht so gut aus. Verstehe.“
Die hochmütige Miene lockerte sich.
„Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Lesen Sie Mein Kampf. Dann wissen Sie alles, was man über Politik wissen muss, und lassen Sie sich nicht von den liberalen Schmierfinken anstecken. Werden Sie einer, der deutsch denkt. Ganz Europa wird eines Tages deutsch denken. Das ist unsere geschichtliche Aufgabe. Ihr habt ja im Horthy einen prächtigen Mann. – Warum sind Sie nach Berlin gekommen?“
André hatte nicht vor, den SS–Mann darüber aufzuklären.
„Weil ich Deutschland liebe“, sagte er stattdessen. „Ich liebe die deutsche Kultur. Goethe, Schiller, Hölderlin und Heine.“
„Heine? Das war ein verdammter degenerierter Jude. Mann, Sie sind auf dem Holzweg! Jeder weiß doch, dass der ein liederliches Leben führte, gegen Deutschland hetzte und an der Syphilis verreckt ist.“
„Er hat die schönsten deutschen Verse geschrieben. Nur Nietzsches Sprache hatte manchmal die gleiche Höhe.“
„Na, wenigstens kennen Sie den Verfasser vom Willen zur Macht. Er hat den Übermenschen vorausgesagt, und nun ist er unter uns und wird Deutschland zur alten Größe führen. Der Führer verkörpert alles, was Nietzsche und Wagner sich ersehnt haben.“
„Ihr Nietzsche hat Wagner wegen seines Antisemitismus verurteilt.“
„Mann, da war er ja schon krank. Hitler und Wagner, das sind die beiden Seiten der Medaille. Ist alles wissenschaftlich bewiesen. Wagner erkannte bereits, was der Führer nun zu seiner Aufgabe gemacht hat: Wir werden die Untermenschen aus Deutschland, aus ganz Europa verjagen. Der Jude wird verschwinden, wie Bazillen werden wir sie austilgen. Auch ihn, Adolf Hitler, wird man den Großen nennen und mit Alexander vergleichen.“
„Alexander hat in den Persern jedenfalls keine Untermenschen gesehen.“
Der SS–Mann lief rot an. Seine Augen funkelten. Er wischte sich erregt das blonde Haar aus dem Gesicht.
„Ich halte Ihnen zugute, dass sie ein Ausländer sind. Auch Sie werden sich eines Tages entscheiden müssen. Jeder in Europa wird sich entscheiden müssen. Der Kampf zwischen den Übermenschen und den Minderwertigen wird kommen, und es wird ein Kampf sein, wie es am Pergamonaltar zu sehen ist. Unsere Stunde naht. Wir werden siegen!“
„Das ist noch nicht raus.“
„Sie sehen jüdisch aus. Tatsächlich. Jetzt kapiere ich. Sie sind ein Jude!“, keuchte der SS–Mann.
„Und wenn? Was wollen Sie jetzt tun?“, fragte André lächelnd und hoffte, dass es selbstsicher genug aussah.
Douglas Fairbanks ließ sich nicht einschüchtern, von Jack London ganz zu schweigen.
„Verschwinde aus Deutschland, Jud! Wenn ich dich einmal auf der Straße erwische, dann wird das keine angenehme Begegnung für dich.“
Er sah zu seinen Kumpanen hinüber, die gerade dabei waren, die römische Abteilung zu verlassen. Der SS–Mann drohte mit der Faust und nickte André höhnisch zu und lief seinen Leuten hinterher.
Als er das Museum verließ, fühlte er diesmal nicht die Befriedigung und Ruhe, die er sonst nach seinen Besuchen im Museum hatte. Er ahnte nicht, dass er an diesem und am vorhergehenden Tag zwei Menschen begegnet war, die seinem Leben eine neue Richtung geben würden, im Guten wie im Bösen.
Seine Odyssee hatte begonnen, und es sollte sich erfüllen, wovon er träumte.
Es begann damit, dass eine Karte kam.
„Aha, mein Zigeunerprinz hat schon eine Prinzessin“, sagte die Wirtin und schob ihm am Frühstückstisch die Karte zu.
Sie hatte André ermuntert, die Küche zu benutzen, was dazu geführt hatte, dass sie seit dieser Zeit zusammen frühstückten, was für ihn den Vorteil hatte, Wurst, Brot und Käse umsonst zu bekommen, so als wäre er ihr Sohn, obgleich sie vielleicht hoffen mochte, dass er sich auf anderes einließ, was er allerdings bisher erfolgreich zu vermeiden wusste. Sie war schließlich so alt wie seine Mutter.
Eva schrieb ihm, dass sie Erfolg gehabt habe und ihn am Sonntag bei Lutter & Wegener erwarte, wo sie ihm die Einzelheiten erzählen wolle.
Er stieß einen Jauchzer aus.
Die Wirtin sah ihn erstaunt an.
„Gute Nachrichten von der Liebsten?“
„Sie ist eine Jugendfreundin und hat vielleicht eine Stelle für mich.“
„Das ist gut. Dann kannst du endlich mal wieder deine Miete bezahlen.“
„Vor allem kann ich mir dann bald Schuhe kaufen.“
„Na gut. Schuhe brauchst du wirklich. Aber nach dieser Ausgabe solltest du mal an die Miete denken.“
Er wusste, dass davon kein Wort mehr sein würde, wenn er ihren verliebten Blicken nachgab. Aber das brachte er dann doch nicht fertig.
Mit Herzklopfen betrat er zum vereinbarten Zeitpunkt die berühmte Weinstube und machte sich Sorgen über die Preise.
Eva war nicht allein. Ein hochgewachsener Mann mit bleichem Gesicht, einem länglichen Kopf und großen Kuhaugen hinter der Brille saß neben ihr.
„Setz dich, das ist Imre. Ich habe dir von ihm erzählt.“
André setzte sich unter den misstrauischen Blicken ihres Begleiters. Es war offensichtlich, dass er André nicht mochte. Dies beruhte auf Gegenseitigkeit.
Sie reichte ihm einen Zettel mit groß geschriebenen Buchstaben.
„Melde dich dort. Es ist die Fotoagentur Dephot, gleich hier in der Jägerstraße, Ecke Friedrichstraße. Sie hat einen ausgezeichneten Ruf und sucht jemand fürs Fotolabor. Eine Ganztagsstelle. Du hast dann ein festes Einkommen.“
„Sie wollen auch Fotograf werden?“, fragte Evas Begleiter.
„Vielleicht. Weiß noch nicht“, erwiderte André.
„In Ihrem Alter sollten Sie aber wissen, was Sie aus Ihrem Leben machen wollen.“
„Ja. Sollte ich eigentlich“, gab André zu.
„Er wird schon noch darauf kommen“, entschuldigte Eva ihn.
„Sie sind Jude?“, fragte Imre mit einem verkniffenen Zug um den Mund.
Er verbarg seine Missbilligung über diesen Freund der Verlobten nicht.
André nickte lächelnd. Nach seiner Erfahrung verblüffte dieses lächelnde Eingeständnis selbst eingefleischte Antisemiten erst einmal. Warum war Evas Freund so feindselig? Er schien nicht zu wissen, dass das Modeatelier Friedmann Kunde seines Vaters war. Oder es war ihm gleichgültig und er sah in seinem Gegenüber mit diesem unverschämten Lächeln nur einen gefährlichen Nebenbuhler.
„Nicht, dass ich was gegen Juden haben“, ergänzte Imre nun eilig. „Unser Arzt ist auch Jude. Ein tüchtiger Mann. Aber für Juden könnte es in Deutschland bald ungemütlich werden.“
„Ein Kulturvolk wie die Deutschen wird sich nie diesen Barbaren in die Arme werfen“, kam Eva André zu Hilfe. „Mir scheint, dass die Nazis ihren Zenit schon überschritten haben. Und außerdem, selbst wenn, Bandi kommt immer durch. Er ist ein Pirat!“, ergänzte sie lachend.
Imre lächelte süßsauer.
„Für Juden wird es überall in der Welt in nächster Zeit schwer werden.“
Der Kellner kam. Eva winkte André beruhigend zu und bestellte eine Flasche Riesling.
„Kennst du den Inhaber von Dephot?“, fragte André, nachdem er sich für die Einladung bedankt hatte.
„Ja. Guttmann. Er sieht etwas komisch aus, aber er ist der Beste in Deutschland. Die besten Fotografen Berlins arbeiten für ihn. Er hat tolle Verbindungen. Auch mir hat er schon geholfen.“
„Sieht komisch aus?“
„Ja. Er sieht ein bisschen aus wie der Glöckner von Nôtre Dame.“
„Guttmann? Klingt nach einem Juden!“, warf Imre ein.
Der Kellner brachte die Flasche und zeigte sie Imre. Dieser nickte nach einem flüchtigen Blick auf das Etikett. Der Kellner entkorkte die Flasche und schenkte ein, worauf Imre mit demonstrativer Kennermiene einen Schluck trank und anschließend herablassend nickte.
„Könnte kälter sein.“
„Ich stelle ihn sofort in einen Kübel mit Eis“, bot der Kellner an.
„Eine solche Hilfstätigkeit im Labor hat doch keine Zukunft“, nahm Imre, ohne den Kellner weiter zu beachten, das Gespräch wieder auf.
So ein Scheißkerl bist du also, dachte André. Mit dem Geld des Vaters im Rücken glaubst du, dir alles erlauben zu können. Es tat ihm leid, dass sich Eva an einen solchen Kerl hängen wollte.
„Es ist ja nur ein Anfang. Er kann vielleicht mehr daraus machen. Vielleicht wird er tatsächlich auch noch Fotograf“, nahm Eva die Verteidigung wieder auf.
„Warum studieren Sie nicht weiter? Eva sagte mir, dass Sie an der Hochschule für Politik eingeschrieben sind.“
„Kein Geld!“, entgegnete André lapidar.
„Ach so. Aber Politik ist auch kein Studium, das für einen Juden besonders aussichtsreich ist, wenn die Nazis erst einmal die Macht übernommen haben. Man muss den Tatsachen ins Auge sehen.“
„Hör auf, Imre“, mahnte Eva.
„Warum gehen Sie nicht nach Ungarn zurück?“,
„Das kann er nicht“, sagte Eva unglücklich und warf André einen scheuen Blick zu.
„Warum nicht?“
„Er hat an Demonstrationen teilgenommen“, klärte Eva ihn auf.
„Ach, so ist das. Jude und Kommunist. Nun, dann haben Sie sich Ihre Lage selbst zuzuschreiben.“
„So kann man es sehen“, gab André zu. „Aber ich bin kein Kommunist. Die sind genau so verrückt wie die Nazis. Statt sich mit den Sozialdemokraten zu verbünden, bekämpfen sie diese, als käme von ihnen die Gefahr. Nein, mir kommen sie wie Marionetten vor.“
„Sie sind eine Gefahr“, bestätigte Imre ernst. „Wenn wir nicht aufpassen, unterwandern sie ganz Europa. Aber Männer wie Horthy und Hitler werden dies verhindern.“
„Imre ist kein Nazi“, warf Eva schnell ein, als sie Andrés ablehnende Miene bemerkte.
„Nein. Natürlich nicht“, bekräftigte Imre. „Von Hitler mal abgesehen sind das alles Rüpel. Aber Hitler, der hat schon was. Man muss Hitler engagieren, soll er ruhig aufräumen und Ordnung schaffen. Von Bürgerlichen eingerahmt, kann er keine Dummheiten machen.“
„Und wenn er sie alle reinlegt, Hindenburg, Papen und Konsorten?“
„Dann haben die Deutschen immer noch die Reichswehr.“
„Und die ist gegen Hitler?“
„Nein. Das nicht. Aber …“
„Wer soll ihn dann aufhalten, wenn er Dummheiten macht? Hitler darf man, das sind seine eigenen Worte, nicht mit einem Demokraten verwechseln. Er will die Revolution und die Demokratie abschaffen.“
„Das ist doch nur Propaganda. Er wird die Wirtschaft von den Fesseln des Versailler Vertrages befreien, und dies wird nicht nur Deutschland zugutekommen, sondern auch Ungarn“, erwiderte Imre bestimmt und nickte Eva gewichtig zu. Kurz darauf entschuldigte er sich und ging zu den Toiletten.
„Wie findest du ihn?“, fragte Eva mit bangem Lächeln.
„Ich bin sicher etwas voreingenommen“, wich André aus.
„Sag mir deine Meinung.“
„Er wird sicher ein tüchtiger Geschäftsführer.“
„Ja. Er ist sehr tüchtig“, sagte sie erleichtert. „Ein ernsthafter fleißiger Mensch.“
„Das glaube ich gern. Aber er wird dich unglücklich machen!“, setzte André traurig hinzu. „Judenhasser sind engstirnige Menschen.“
„Du bist eifersüchtig“, erwiderte sie.
„Mag sein.“
„Er liebt mich.“
„Warum soll er dich nicht lieben? Du bist eine schöne Frau. So etwas schmückt. Aber er wird dich …“
Er brach ab, weil Imre zurückkam.
Der Verlobte setzte sich, nahm das Weinglas auf und prostete André zu.
„Trinken wir darauf, dass Ihnen aus Evas Empfehlung Gutes entsteht.“
„Ja. Trinken wir darauf!“, stimmte Eva freudig zu. „Siehst du!“, setzte sie hinzu und funkelte André an.
„Was soll er sehen?“, fragte Imre misstrauisch.
„Ach, André glaubt, dass du etwas gegen Juden hast.“
„Nein. Natürlich nicht!“, ereiferte sich Imre. „Natürlich sind sie etwas anders als wir. Es gibt schon zu denken, dass so viele von ihnen Anwälte, Ärzte, Kaufleute und Zeitungsleute sind. Viele haben mit ihnen schlechte Erfahrungen gemacht. Ich mag sie nicht bei den Geschäften. Ich sage dies ganz offen. In Amerika geben sie den Ton an und hetzen gegen die nationalen Kräfte. Aber meine distanzierte Haltung zu den Juden hat nichts mit Ihnen, lieber André, zu tun. Manche von ihnen, so unser Arzt in Budapest, sind ehrenwerte Leute. Und ein Jugendfreund von Eva kann sich meiner Sympathie immer sicher sein“, setzte er gönnerhaft hinzu.
„Das freut mich“, sagte André schmallippig.
„Na siehst du!“, triumphierte Eva.
Als Imre seine Hand auf ihre legte, war André dies peinlich, und er verabschiedete sich bald. Obwohl Eva ihm geholfen hatte, fand er sie doch sehr verändert. Die Nacht im Boot schien nicht passiert zu sein. Wie kann sie so einen Kerl zum Mann nehmen, dachte er zornig, als er über den Gendarmenmarkt ging und zum Schillerdenkmal hinübersah. Er war überzeugt davon, dass sie sich für den falschen Moor entschieden hatte. In Schillers Räuber waren die Herzen reiner. Aber immerhin hatte sie ihm geholfen. Das musste man ihr zugute halten. Wenigstens das, und verteidigt hat sie dich auch, dachte er unglücklich.
Am nächsten Morgen ging er gleich zur Friedrichstraße und fand an der Ecke zur Jägerstraße das Schild mit der Aufschrift
Dephot, Fotoagentur, Inhaber Simon Guttmann.
Als er die Tür öffnete, befand er sich in einem dunklen Flur mit vielen überquellenden Briefkästen, der zu einer Tür mit einer milchigen Scheibe führte, die die gleiche Aufschrift wie draußen aufwies. Er klopfte und trat ein. Es war ein großer dunkler Raum, fast ein Saal, mit vielen Schreibtischen, die mit Fotos übersät waren. In der Mitte des Raumes standen mehrere Männer um einen Leuchtkasten zusammen, die sich nun zu ihm umdrehten.
„Ich möchte zu Herrn Simon Guttmann“, sagte er zu der Runde.
„Dich kenne ich doch!“, sagte ein kleiner Mann, und André ging auf, dass er im Pergamon–Museum den Besitzer der Fotoagentur getroffen hatte.
Er trug den gleichen beschmutzten Anzug wie damals und hatte einen schwarzen Hut auf. Seine blauen Augen funkelten vergrößert hinter den Brillengläsern.
„Ich bin auf Empfehlung von Eva Besayhö hier“, sagte André ein wenig eingeschüchtert von den Männern mit ihren Fotoapparaten, die ihn neugierig musterten.
„Du bist das also. Ich denke du studierst.“
„Ich brauche Arbeit.“
„Na schön. Dann setz dich dort hin und warte ein Weilchen.“
Guttmann wandte sich wieder den Männern zu. Sie diskutierten eine Weile über eine Kundgebung der Kommunisten, die zu erwartenden Straßenschlachten und wie man sie am besten aufzunehmen habe.
„Ich will keine Panoramaaufnahmen, wo die Menschen klein wie Fliegenschiss sind. Dauernd liefert ihr mir einen solchen Mist! Ihr müsst nahe rangehen, müsst die Angst in den Gesichtern zeigen, müsst zeigen, wie die Polizisten zuschlagen. Nahaufnahmen, meine Herren! Wie soll ich Bilder bei den Zeitungen unterbringen, wenn die Menschen wie Fliegenschiss aussehen? Solche Fotos regen nicht auf. Mensch, Kinder, ihr nennt euch Fotografen. Amateure machen manchmal bessere Fotos.“
„Bist du endlich mit deiner Suada fertig, Simon?“, fiel ihm ein hagerer Mann mit einem ausgemergelten Gesicht in die Parade und stieß seinen Hut zurück. „Wir kamen bisher nicht näher heran, weil die Polizisten uns nicht näher ranließen. Du musst uns nicht unser Handwerk erklären, verdammt noch mal!“
„Ach, hör mir mit den Entschuldigungen auf, Janos! Immer habt ihr Entschuldigungen parat. Aber das Einzige was zählt ist, ob man dicht dran ist. Alles andere sind Ausreden.“
Sie stritten noch eine Weile. Schließlich gingen sie grummelnd an ihre Schreibtische zurück und sortierten ihre Bilder.
Simon Guttmann winkte André zu sich und wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch.
„Setz dich. Du willst also im Labor arbeiten. Woher kennst du denn Eva? Ist ein feines Mädchen. Hat eine Zukunft. Bist du ihr Freund?“
„Nein. Wir kennen uns aus Budapest. Wir waren Nachbarn.“
„Noch ein Ungar! Hörst du, Janos. Ein Landsmann von dir.“
„Dann geh mit ihm pfleglich um, du Sklavenschinder. Eigentlich sollte ich ihn vor dir warnen“, rief der Hagere zurück.
„Werde ich mit dir auch solchen Ärger haben?“, knurrte Guttmann und sah André unschlüssig an.
„Bestimmt nicht!“, versprach André eifrig. „Ich werde hart arbeiten.“
„Das wirst du auch müssen. Faulpelze kann ich nicht gebrauchen. Also, weil wir beide die ollen Griechen lieben: Du hast die Stelle. Der Dienst beginnt um acht. Zuerst befeuerst du jeden Morgen die Öfen. Dann holst du die Post, anschließend sortierst du die Fotos. Danach hilfst du beim Entwickeln. Von halb eins bis halb zwei ist Mittagspause. Aber du hast nur eine halbe Stunde, weil du mit den Fotos zu den Zeitungen marschierst und sie bei den Redakteuren abgibst. Danach kommst du wieder und machst das Labor und die Büros sauber. Aber untersteh dich, auf den Schreibtischen herumzustöbern, schon gar nicht auf meinem. Dann holst du Kohle für die nächsten Tage. Der Betrieb geht hier manchmal bis neunzehn Uhr. Auch danach sind noch oft welche hier, und du holst ihnen, wenn sie wollen, einen Imbiss. Es wird Tage geben, da bist du bis weit nach Mitternacht in der Agentur. So ist das nun einmal bei uns. Wirst du das durchstehen?“
„Ich scheue keine harte Arbeit“, beteuerte André.
Guttmann grunzte.
„Wir werden sehen, Bürschchen. Wir werden sehen. Aber reich wirst du bei uns nicht. Viel Arbeit, wenig Geld, darauf läuft es hinaus. Aber wenigstens wirst du dich nicht langweilen.“
„Sei nicht so geizig, Simon!“, schrie der Ungar herüber, während er einen Film in den Apparat legte. „Der Junge ist kein Sklave.“
„Halt du dich da raus und bring ordentliche Fotos, die sich verkaufen lassen, dann kann ich auch mehr zahlen.“
Er nannte einen Betrag, der wenig genug war, André aber davor bewahren würde, zu hungern. Vielleicht konnte er, wenn er das Geld zusammenhielt, sogar bald ein paar Schuhe kaufen.
„Morgen früh fängst du an, und dann werden wir sehen, ob du was taugst!“, sagte Guttmann und deutete mit einem Nicken an, dass André entlassen war.
Ob er mit dem angebotenen Lohn einverstanden war, fragte er nicht.
André fand den Beginn bei Dephot nicht gerade verheißend. Aber eine Wahl hatte er nicht. Wenigstens hatte er eine feste Anstellung. Es gab Millionen, die dies nicht von sich behaupten konnten. Noch ging ihm nicht auf, dass er einen Anfang gemacht hatte und er dabei war, seinen Weg zu gehen. In einem Film aus Hollywood wäre die Musik lauter geworden.