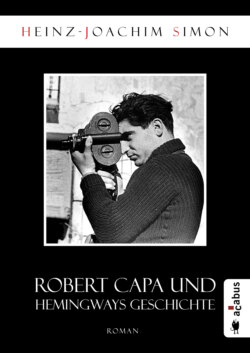Читать книгу Robert Capa und Hemingways Geschichte - Heinz-Joachim Simon - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.
Es regnete, als er in Berlin eintraf. Auch wenn er später an die Stadt zurückdachte, sah er sie im Regen mit dem Licht der Neonreklamen auf dem Asphalt der nass glänzenden Straßen. Dann glaubte er den Wind zu spüren und die Kälte, und dann hörte er wieder die peitschenden Rhythmen aus den Kneipen am Alexanderplatz.
Es war ein früher Morgen, als er auf den Platz vor dem Anhalter Bahnhof trat. Der Regen fuhr ihm ins Gesicht, und er musste sich gegenüber bei einem Kaufhaus unterstellen. Die Gesichter der vorbeihastenden Menschen sahen mutlos und grau und verbittert aus. Aber ihn erfasste eine nie gekannte Erregung, und er spürte die Atemlosigkeit dieser Stadt, ihr Fieber, das ihn sofort mitzog, und er erkannte das Potenzial, das diese Stadt bot. Er war bereit, es mit ihr aufzunehmen.
Wie Geräuschkaskaden stürmte der Großstadtlärm auf ihn ein: das Klingeln der Straßenbahnen, das drängende ungeduldige Hupen der Automobile und der Schrei der Zeitungsverkäufer Hitler vor den Toren!
Das alles klang gefährlich und neu und aufregend. Er mochte diese pulsierende Stadt, ihre Unrast, die Schreie, die hastig hervorgestoßenen Wortfetzen, den schnoddrigen Tonfall. Das war doch etwas anderes als die Behaglichkeit der k. u. k. Monarchie, der Nachklang einer vergangenen Zeit, die Melancholie verlorener Größe. Er mochte Berlin sofort. Er kannte Paris noch nicht. Aber für ihn war die Ankunft auf dem Anhalter Bahnhof der Eintritt in das Leben, von dem er geträumt hatte.
Unschlüssig stand er vor dem Kaufhaus und sah die Straßenschluchten hinunter und wartete, dass der Regen nachließ. Er wollte seine Kleider nicht verderben und hatte noch die Worte des Vaters im Ohr, wie wichtig respektables Aussehen war.
Der Regen ging langsam in ein Tröpfeln über. Er schob sich die Mütze zurecht und lief über die Straße zu der Imbissbude Mutter Schreinecke. Zwar sah der Imbiss etwas baufällig aus, doch das Dach schützte vor dem nassen Wind. Eine verwelkt aussehende Frau mit schlecht gefärbten blonden Haaren und einem Damenbart sah ihn herausfordernd und missbilligend an. Sie schien nicht gerade ihren besten Tag zu haben.
„Wat willst’n?“
Für einen guten Kunden schien sie ihn nicht zu halten. Er verstand sie nicht gleich und sah sie ratlos an.
„Nu mach schon. Wenn de nüscht willst, kannste hier nicht rumstehn.“
Er bestellte einen Kaffee und eine der knusprig aussehenden Bouletten. Es kostete mehr, als er erwartet hatte, aber er machte sich darüber keine Sorgen, denn die Großtante war, wie die Mutter es erhofft hatte, großzügig gewesen. Die Großtante hatte ihn sofort ins Herz geschlossen und ihm sogar zu verstehen gegeben, dass er bleiben könne. Auch der Onkel hatte durchklingen lassen, dass er ihn in seiner Fabrik gebrauchen könne. Sie hatten keine Kinder. Es wäre ein Budapest der Luxusklasse gewesen. Die Großtante hatte ihn nur widerwillig ziehen lassen.
Der Kaffee war dünn und schmeckte sehr streng, aber er wärmte. Die Boulette war zu fett und an den Seiten ein wenig angebrannt, aber nicht sehr, und das Fleisch schien gut zu sein und sättigte sofort.
Musik erklang. Er sah erstaunt die Straße hinunter. Eine graue Masse kam heran, und nun hörte er auch das Lied.
„Schon wieder die verdammten Nazis“, sagte ein grobschlächtiger Mann neben ihm, der genau so wie André eine Schiebermütze trug und mit genussvoller Miene eine Bratwurst verspeiste und dabei die heranmarschierenden braunen Kolonnen nicht aus den Augen ließ.
„Pack! Alles Pack!“, kommentierte die blonde Wirtin hinter dem Tresen.
Wir werden weiter marschieren, bis alles in Stücke fällt,
denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt!, sangen die Kolonnen trotzig hinter dem SA–Mann mit dem Schellenbaum.
Ein kleiner Mann in einem dunklen Mantel und einem Bowler auf dem Kopf stellte sich an den Imbissstand, verlangte eine Erbsensuppe mit Brötchen und rief, statt sich der Suppe zu widmen, immer wieder: „Heil Hitler! Heil! Heil!“,
„Essense mal lieber, die Suppe wird sonst kalt“, forderte ihn die Wirtin auf.
„Wennde weiter so rumkrakeelst, kriegste wat uff deene komische Mütze!“, sagte der Breitschultrige und schob sich den Rest seiner Bratwurst in den Mund.
„Sie haben wohl etwas gegen die nationale Bewegung!“, protestierte der kleine Mann und schob kampflustig seine Nickelbrille zurück.
Der Breitschultrige musterte die etwas schäbige Eleganz des Kleinen und brummte:
„Det kannste laut sagen: sind allet Verbrecher, jawoll!“
„Sie sind wohl ein Roter?“
„Ick maloche bei Siemens, und wenn de kiebig wirst, kriegste wat uff de Birne.“
Der kleine Mann lief rot an und winkte aufgeregt zu den Kolonnen hinüber.
„He, Volksgenossen, hier ist einer von der Kommune!“, krähte er.
Kurz darauf lösten sich zwei Braunhemden aus der Kolonne und kamen zu ihnen hinüber.
„Wat is hier los?“, schrie der Kleine mit dem mächtigen Bauch über dem Gürtel.
Er wurde von einem langen Hageren begleitet, sodass sie André an Stan Laurel und Oliver Hardy erinnerten. Doch lustig waren die beiden nicht. Angriffslustig stemmte der Dickbauch die Hände in die Seiten.
„Hier ist ein Kommunist!“, sagte der kleine Mann und wies mit dem Löffel auf den Siemensarbeiter.
„Is doch nich wahr: Ick bin Sozi, aber leiden kann ick euch bede och nich!“, erwiderte er trotzig.
„Das Schwein will Senge haben“, sagte der Dickbauch zu seinem Kollegen, worauf dieser gemein grinste.
„Det jibt’s doch nich, det sich’n Roter hier am Anhalter Bahnhof rumdrückt. Könn’ wa jar nich leiden.“
„Macht keene Makenkes nich“, mischte sich die Blondierte ein. „In meen Etablissement wird nich jedroschen, sonst ruf ick die Polizei.“
„Nu kriech ik aber Angst, Muttchen. Rufse nur!“, höhnte der Dickbauch.
„Denn kricht die och noch wat uff’n Dutt“, setzte der Lange hinzu.
Plötzlich zogen sie ihre Schlagstöcke aus ihren Blusen und schlugen ohne Warnung auf den Arbeiter ein. Dieser war jedoch nicht so ohne Weiteres kleinzukriegen und wehrte sich, und es gelang ihm, den Langen zu Boden zu schlagen. Doch nun erwischte ihn der Dickbauch an der Schläfe, und der Arbeiter sank mit einem Stöhnen zusammen.
„Lasst den Mann in Ruhe! Hört auf!“, rief André und hielt den Dickbauch am Arm fest und hechtete auf seinen Rücken, als dieser weiter auf den Wehrlosen einschlagen wollte.
Der SA–Mann drehte sich erstaunt um und rief dem Langen zu, der sich gerade aufrappelte, dass er ihm diese Kröte vom Hals schaffen solle.
André ließ sich zurückfallen, sodass der Faustschlag des Langen ins Leere ging.
„Jetzt jehn se och noch auf Kinder los!“, kreischte die Blondierte.
André lachte herausfordernd und rief den SA–Männern zu:
„Habt ihr auch gute Beine?“,
Er schnappte seinen Koffer und lief über die Straße zum Bahnhof zurück. Die Braunhemden verfolgten ihn bis zur Bahnhofshalle.
Es gelang ihm, im Gedränge die Verfolger abzuschütteln. Das fängt ja gut an, dachte er und setzte keuchend den Koffer ab. Gut, dass die beiden SA–Männer mit ihren hohen Stiefeln nicht besonders gut zu Fuß waren. Da kommst du aus Budapest, weil die Faschisten hinter dir her sind, und gerätst hier an das gleiche Pack. Aber er war deswegen nicht bekümmert. Seine Mutter hätte es eine Dummheit genannt, dass er sich eingemischt hatte, aber der Vater hätte ihm sicher zugestimmt. Man darf bei einem Unrecht nicht wegsehen. André war zufrieden mit sich. Jack London hätte sicher genau so gehandelt. Mit wiegendem Schritt ging er selbstbewusst zur Imbissbude zurück.
Wohlwollend lächelte ihm die Blondierte zu. Der SA–Zug war weitergezogen. Nur noch von der Ferne hörte man die Blaskapelle. Der Mann mit der Nickelbrille war fort, genau so wie der Siemensarbeiter.
„Habense dich nich an den Kanthaken gekricht?“
„Nein. Dafür war ich zu schnell.“
„Diese Halunken. Diese verdammten braunen Halunken, und nun werdense immer mehr.“
„Ja. Bei uns in Budapest auch.“
„Ach, daher kommste. Nun versteh ick. Siehst ja och aus wie een Zigeuner. Sprichst aber jutes Deutsch, besser als die Röck. Kannste och Csardas tanzen wie die Marika?“,
„Nein. Ich bin kein Zigeuner“, sagte er unzufrieden und runzelte die Stirn.
Nicht dass er etwas dagegen hatte, für einen Zigeuner gehalten zu werden, aber in Anbetracht seiner Situation wäre es ihm doch lieber gewesen, sie hätte ihn für einen Deutschen gehalten. Schließlich wollte er hier leben, und dass es bei den Deutschen genau so rau zuging wie in Budapest, hatte er ja nun gleich erfahren. Soviel erkannte er sofort, dass für die Deutschen nur Deutsche zählten. Auch daran galt es, sich zu gewöhnen.
„Nun sei man nich gleich muksch“, sagte die Blondierte und lächelte mütterlich. „Ick geb dir eenen Kaffee aus.“
Sie schob ihm das dampfende Getränk über den Tresen, und er bedankte sich und wärmte sich die klammen Finger an dem heißen Kaffee.
„Tut gut. Der Wind ist hier verdammt unangenehm.“
„Det is er, meen Kleener. Det ändert sich hier erst im Mai. Wat willst’n in Berlin?“,
„Ich will studieren. Aber vorher muss ich mir Arbeit suchen.“
„Oh je, Kleener. Da haste dir aber eene schlechte Zeit ausjesucht. Arbeit ham hier nich ville, und alles andere och nich.“
„Ich nehme jede Arbeit an.“
„Uff die Idee sind och schon andere jekommen. Jungchen, jeh zurück nach Hause. Berlin is keen gutes Pflaster für nette Jungs. Hier kommste nur unter die Räder.“
„Ich nicht. Ich ganz bestimmt nicht!“, sagte André, trank den Kaffee aus, bedankte sich noch einmal, lüftete die Mütze und lief die Straße weiter.
An der nächsten Ecke wurde er von einer Frau angehalten, die seiner Meinung nach nur aus reichem Hause sein konnte, so elegant wie sie aussah. Sie war schön, und ihr Lächeln gefiel ihm, und der Duft ihres Parfüms erinnerte ihn an Eva.
„Bist du fremd hier? Suchst du eine Unterkunft?“, fragte die Frau und legte ihm die weiße Hand auf die Schulter.
„Ja. Ich bin eben angekommen. Ich komme aus Budapest. Aber danach war ich in Wien“, erklärte er eifrig.
„Ein Pusztajunge, sieh mal an. Dafür sprichst du aber gut Deutsch. Du brauchst also ein Zimmer.“
„Aber es darf nicht teuer sein.“
„Ich kenne eine gute Pension, spottbillig. Mit einer Wirtin, die ein Herz für junge Leute hat. Ich begleite dich gern dort hin.“
„Das würden Sie tun? Vielen Dank“, sagte André und lächelte sie auf die Art an, von der er glaubte, dass sie kühn und mutig aussah und den Frauen gefiel. Die Eitelkeit und andere Gefühle gaben ihm den Eindruck, dass dies nicht vergebens war. Er kam sich wie ein Abenteurer vor, der nach Klondike unterwegs war, um Gold zu finden. Dieses Berlin sollte sein Klondike sein, und das Lächeln und Verhalten der Frau schienen diese Vorstellungen zu bestätigen. Sie hakte sich bei ihm unter und deutete auf den S–Bahn–Eingang auf der anderen Straßenseite. Der Druck ihres Armes an seiner Seite löste bei ihm Glücksgefühle aus, und er glaubte gleich bei seiner Ankunft in Berlin jemanden gefunden zu haben, der ihm die Prinzessin sein würde. Er war bereit, ihr Ritter zu sein. Er musste dies nur weiterentwickeln. Aber große Erfahrung hatte er darin noch nicht.
„Ich heiße André Friedmann“, sagte er gewichtig, als würde er sagen, er sei Jack London oder Sir Walter Scott.
„Ach ja. Ich heiße Helga Schüssel. Wat willst’n in Berlin?“
Als er es ihr sagte, lachte sie kehlig, und ein Schauer lief ihm über den Rücken.
„Aha, ein kommender Studiosus, etwas Besseres biste also. Wat willst’n studieren?“,
„Politik und Journalismus.“
„Politik? Det kann man studieren? Ick dachte immer, det besteht nur aus Quasseln, Brüllen und Streiten.“
„Ich will ein guter Journalist werden“, sagte er selbstbewusst. Er fand, dass sich die Geschichte gut anließ, und warf ihr verliebte Blicke zu.
„Kriegt man dafür jenug Penunze?“
Er verstand erst nicht, was sie meinte und sah sie ratlos an.
„Knete, Piepen: Geld!“, erklärte sie.
„Oh ja, wenn man gut ist. Wenn man so gut wie Kisch ist, der rasende Reporter, dann hat man schon sein Auskommen.“
„Kisch? Nie jehört. Aber ick lese keene Zeitungen. Steht ja doch nur drin, dass es mit Deutschland bergab jeht. Mit allem jeht’s bergab.“
Sie drängte sich mit ihm an den Fahrkartenschalter und sah ihn herausfordernd an.
„Nu? Wat is denn? Du musst schon für mich blechen, wenn ick dir zur Pension begleiten soll.“
Er fand es zwar seltsam, dass er für diese reich aussehende Dame mit dem klaren hoheitsvollen Gesicht zahlen sollte, aber schließlich zahlte der Herr in Begleitung einer Dame. Er nickte ergeben und kramte sein Geld hervor. Die Großtante hatte ihm deutsches Geld mitgegeben, sodass er erst einmal nicht auf das Geld der Mutter zurückgreifen brauchte.
„Zweimal Neukölln“, sagte die Frau.
Auf dem Bahnsteig waren viele Braunhemden, aber ihre Fahnen waren eingerollt, und wie sie Zigaretten rauchend zusammenstanden, sahen sie auch nicht mehr gefährlich aus. Sie fühlten sich nun außer Dienst, und interessanter als Parolen war die Frau an Andrés Seite, der sie bewundernde Blicke zuwarfen.
„Sie sind sehr schön“, wagte André ein Kompliment und errötete dabei.
„Du verstehst was von Frauen?“, fragte seine Begleiterin, warf das Haar zurück, lachte wieder ihr kehliges Lachen und erwiderte die Blicke der sie bewundernden SA–Männer.
„Nicht sehr viel“, erwiderte André, und die Frau kicherte und stieß ihn in die Seite.
„Wirste noch lernen. Dafür braucht man keen Jymnasium.“
In Neukölln stiegen sie am Hermannplatz aus und gingen die Hermannstraße hoch. Seine Begleiterin führte ihn zu einem Haus aus der Gründerzeit mit vielen allegorischen Figuren an den Wänden. Einst mochte es durchaus ein hochherrschaftliches Aussehen gehabt haben, aber das war lange her, und nun blätterte der Putz ab. Das Weiß des Hauses hatte sich in ein trostloses Grau verwandelt. Im Flur, der gekachelt war, schlug ihnen feuchte Kühle und der Geruch von Essen entgegen. Seine Begleiterin klingelte an der Tür im Parterre, und diese tat sich bald auf, und eine Frau mit einem verlebten Gesicht, die grauen Haare zu einem Knoten zusammengebunden, sah sie fragend an. Sie trug eine verschmutzte Schürze über einem mächtigen Busen.
„Ach, du bist es, Helga. Haste jemanden gekobert?“
Die Wirtin musterte André ausgiebig. Das, was sie sah, schien sie nicht besonders zu begeistern.
„Wie lange willste denn bleiben?“
„Lange. Wenn das Zimmer recht ist. Ich will in Berlin studieren.“
„Ein Student?“
Ihre Miene lockerte sich.
„Also, auf Dauermiete?“,
„Ja. Wenn mir das Zimmer zusagt und wir uns über den Preis einigen können!“, sagte André bestimmt.
Die Wirtin warf Helga Schüssel einen amüsierten Blick zu und zwinkerte ihr zu.
„Unser Herr hat Ansprüche. Na, dann kommense mal.“
Sie führte ihn durch einen langen Flur und öffnete die letzte Tür. In Budapest hätte er zu dem Zimmer Besenkammer gesagt. Es hatte kein Fenster. Nur ein Bett war darin und ein kleiner Tisch und ein Korbsessel.
„Hier stört Sie keener, hier könnse in Ruhe Ihre Bücher studieren.“
„Es hat kein Fenster!“, sagte André matt.
„Na, det Adlon könnse nich verlangen. Nich für zehn Mark, oder könnse mehr zahlen? Dann hab ick noch jleich neben de Küche eene jute Stube, könnse och haben. Kostet aber det Vierfache.“
André schüttelte den Kopf. Nein, große Ansprüche konnte er nicht stellen, und für den Anfang mochte es reichen. Er sah seine Begleiterin mit der Wirtin tuscheln, und diese gab ihr einen Zehner.
Helga Schüssel wedelte sich mit dem Geldschein Luft zu und lachte hell auf Andrés verwunderten Blick.
„So ist das Leben, mein Jrünschnabel. Du bist in Berlin. Hier muss jeder sehen, wo er bleibt!“, sagte sie und stolzierte hinaus.
André schämte sich. Er war einer Schlepperin aufgesessen, die sich ein Zubrot damit verdiente, seiner Wirtin Gäste zuzuführen.
Zwar war sein Stolz ein wenig angeschlagen, aber er war jung genug, dies bald zu vergessen. Noch am gleichen Nachmittag machte er sich zur Hochschule auf. Ohne Schwierigkeiten wurde er nach Vorlage seines Reifezeugnisses immatrikuliert. Die Deutsche Hochschule für Politik war eine der letzten Lehranstalten, an denen noch nicht die Nazis das Sagen hatten, und wo man Ausländern gegenüber keine Vorurteile oder gar Zulassungsbeschränkungen kannte. Es gab an dieser Hochschule noch einen wachen Geist. Es wurde zwar heftig kontrovers diskutiert, aber ohne dass dies in Schlägereien ausartete. André wusste nicht, dass diese Hochschule für Politik bereits eine Insel war.
Anfangs besuchte er regelmäßig die Vorlesungen. Doch André war ein zu unruhiger Geist und zu ungeduldig, und bald langweilte er sich. Es fiel ihm immer schwerer, den theoretischen Erörterungen zuzuhören und sich mit den Krisen des Neunzehnten Jahrhunderts zu befassen. Er war kein guter Student. Selbst die Vorlesungen über Journalismus und die Kunst des Schreibens besuchte er nur, wenn einer der Dozenten aus der Praxis kam, etwa von der Vossischen Zeitung, der Frankfurter Illustrierten oder anderen angesehenen Publikationen.
Stattdessen lernte er Berlin kennen und trieb sich viel in den Cafés und Kneipen am Alexanderplatz herum. Bald kannte er auch die Bars und Clubs, in denen Jazz gespielt wurde, und er begeisterte sich am Basin Street Blues oder dem Tiger Rag oder gar dem hymnischen When the Saints go marching in. Das war die Musik, die er liebte, und schon bald konnte er die richtigen Tanzschritte dazu. Er hatte keine Schwierigkeiten, in die Clubs hineinzukommen, da er älter aussah, als er war, und hinzu kam seine Ungezwungenheit, diese selbstbewusste Körperhaltung und sein unverschämtes Grinsen, das eine Weltgewandtheit vortäuschte, die er nicht hatte, gleichwohl aber die Türsteher für ihn einnahm. Und wenn er, André, dann sein Douglas Fairbanks Lächeln aufsetzte, so hielten sie ihn für einen Good fellow und machten ihm keine Schwierigkeiten. Zu dieser Zeit trank er noch nicht viel, einmal, weil er sich noch nichts daraus machte, zum anderen weil er es sich nicht leisten konnte. So saß er den ganzen Abend an einem Bier. Wenn die Kellner einmal ungeduldig zu ihm herübersahen, zog er die Achseln hoch und breitete unverschämt grinsend die Arme aus, und sie erkannten wohl, dass er zu ihnen gehörte und auch nur ein armer Hund war, und ließen ihn in Ruhe. Wichtig war ihm nicht der Alkohol, sondern das nächtliche Leben, das im Jazz kumulierte und im Lächeln der Frauen. Noch wurde er nicht von ihnen erkannt und war nur ein verwunschener Prinz, der Ausschau hielt.
So vertrödelte er ein halbes Jahr und lernte Berlin kennen und den Jazz, das Lächeln der Frauen, aber den Professoren der Politikwissenschaft blieb er ein Fremder. Doch verloren war dieses Jahr nicht. Er lernte zu beobachten und die Momente einzufangen, in denen sich das Leben verdichtete und in Bahnen lenkte, deren Ziel unbekannt war, aber über Glück und Unglück entschied. Er sah zu, wie Frauen Männer eroberten oder ihnen verfielen. Momente vielfältigen überbordenden Lebens. Ein hastig geflüstertes Wort. Ein bezeichnender Blick zu den Toiletten hin. Das verstohlene erste Berühren der Hände. Das Perlen von Wassertropfen auf den Schnapsgläsern. Nacht für Nacht zog er den Duft von Bier, Schnaps und verschwitzten Leibern ein, sah, wie weibliche Schenkel gegen den Unterleib der Männer drückten, sah ihre hochroten Köpfe und auch anderes, verbotene Geschäfte, wie Kokain den Besitzer wechselte, wie Hehlerware verramscht wurde. Er lernte, wie gefährlich es war, nicht sein Wort zu halten oder gegen die Regeln der Halbwelt zu verstoßen. Hier am Alexanderplatz lebte er in einem Schattenreich, das nichts mit der Gesellschaft oder der hilflosen Politik der Wilhelmstraße zu tun hatte. Hier galten die Parolen der Nazis oder Kommunisten nichts, und wenn einer das Parteiabzeichen trug, so war dies bedeutungslos. Er war im Inneren des Schattenreiches ein geduldeter Zuschauer, bedeutungslos, aber auch ohne den Wunsch hier mitspielen zu wollen. Er lernte und vervollkommnete das, was ihm bereits der Vater mit seinen Genen mitgegeben hatte. Immer seltener ging er in die einem Renaissancepalast nachempfundene Hochschule und hörte sich an, warum Bismarck ein großer Deutscher war und sich der Kaiser noch dümmer angestellt hatte als die Franzosen und Engländer. In der journalistischen Abteilung hörte er die Regeln über kurze Sätze, über Prägnanz und das Vermeiden von Adjektiven. Er genoss also das Studentenleben und machte sich keine Sorgen über die Zukunft. Aber es war nicht so, dass dies zur Stumpfsinnigkeit geführt hätte. Er sah sehr wohl die Veränderungen in Deutschland, wie der Terror zwischen Nazis und Kommunisten zunahm und die Eliten dabei waren, das Land in den Ruin zu steuern. Eine seltsame bleierne Stimmung lähmte das Land. Aber noch nahm er nicht Partei.
Ein Kommilitone, dem er seinen Eindruck schilderte, lachte dazu leichtfertig.
„Wir warten auf die Barbaren. Die Regierenden wissen nicht mehr weiter, und nun warten sie auf eine Erlösung. Irgendeine. Egal, woher sie kommt. Irgendetwas muss passieren.“
„Und wenn nichts passiert?“
„Dann wird es so weitergehen wie bisher. Sie wurschteln sich von Tag zu Tag. Genießen wir die Endzeit …. bevor die Barbaren kommen.“
In der Studentenschaft war die Einstellung, so fand André, recht frivol. Die Jugend wusste, dass sie etwas Neues wollte, aber was dies war, wusste sie nicht. Doch ist es nicht so, dass jede Generation das Alte, Dahergebrachte ablehnt, wenn nicht gar verachtet und zu etwas Neuem aufbrechen will? Und das Neue, das noch nie da Gewesene waren die Barbaren in ihren braunen Uniformen und dem Marschtritt und dem Horst–Wessel–Lied. Unter ihren Stiefeln würde die Welt erzittern.
Dann kam der Brief, der seinen Berlinaufenthalt in eine kritische Phase münden ließ. Längst war das Geld der Großtante und das der Mutter bis auf einen kleinen Rest aufgebraucht. Die Mutter schrieb ihm, dass sie kein Geld mehr schicken könne, da die Geschäfte immer schlechter gingen. Man habe das Atelier bereits verkleinern und viele Näherinnen entlassen müssen, und der Vater sei keine große Hilfe, im Gegenteil, seine Spielschulden hätten alle Reserven aufgebraucht. Aber er solle auf Gott vertrauen und auf seine Eigenschaften und dem Vorbild der großartigen Gentlemen ihrer Familie nacheifern und tüchtig studieren und was aus sich machen. Sie habe Vertrauen zu ihrem Ältesten. Sicher würde er in Deutschland eine Arbeit finden, die es ihm erlaube, sich zu ernähren und weiter zu studieren.
Nun begannen die Tage, an denen er Hunger kennenlernte. Manchmal fand er Arbeit in kleinen Hotels oder Restaurants als Tellerwäscher, aber der Lohn war so gering, dass es sich kaum lohnte, aufzustehen, wenn es regnete. Ohnehin hatte er sich angewöhnt, bei schlechtem Wetter erst am Abend aufzustehen, um dann die Nacht in einem der Lokale am Alexanderplatz zu verbringen und Jazz zu hören, der einen forttrug in ein anderes Land mit weißen Herrenhäusern und Säulen und reich geschmückten Frauen in Krinolinen. Die dürftigen Unterkünfte der Negersklaven kamen nicht in diesen Bildern vor, obwohl es doch ihre Musik war, die er hier hörte. Und wenn dann der Mahagony Blues oder Muskat Ramble erklang, wippte sein Fuß mit, und er vergaß den Hunger. Mittlerweile kannte er auch genug Leute, die sein unverschämtes Lachen mochten und ihn wie ein Maskottchen betrachteten und ihm gern ein Bier oder sogar einen Schnaps ausgaben. Es kümmerte ihn nicht, dass es kleine Ganoven waren, Drogenhändler oder Zuhälter, und er ließ es sich gefallen, dass sie ihm kameradschaftlich über das Haar fuhren. Andere Sympathiekundgebungen ließ er nicht zu, und die warmen Brüder merkten bald, dass der gut aussehende Junge dafür nicht zu haben war, und ließen ihn in Ruhe. Unter Trompetenstößen mit dem heißen drängenden Rhythmus des Schlagzeugs ließ er sich jede Nacht in eine andere Welt gleiten, die ihm alle Herrlichkeiten zeigte und so anders war als der trostlose Tag.
Mit der Miete war er im Rückstand, und er musste sich in der Wohnung der Wirtin wie eine Katze bewegen. Sie hörte ihn nie, wenn er heimkam. Tagsüber war er meistens schon früh in den Berliner Straßen unterwegs, um am Großmarkt eine Arbeit zu ergattern, die mit ein paar Pfennigen oder Früchten belohnt wurde. Sorgen machte ihm, dass es mit seinen Schuhen nicht zum Besten stand und man ihnen ansah, dass er langsam auf der untersten Stufe angelangt war, was selbst sein mutwilliges Lächeln nicht vertuschen konnte. Dann wurde sein Hunger so groß, dass er dem Hund der Wirtin zum Konkurrenten wurde. Es war eine recht vollgefressen aussehende Dogge, ein unsympathischer Hund, der ihn mit triefenden Lefzen und rot unterlaufenen Augen stets misstrauisch anknurrte. Die Wirtin nannte ihn Cäsar, André dagegen nannte ihn Winston, und das traf es besser, denn mit seinem kompakten Körper sah er dem John Bull der Engländer sehr ähnlich. Winston oder Cäsar wurde vortrefflich versorgt und mit Koteletts gefüttert, die die Wirtin jeden Abend vom Fleischer holte und für die Rundlichkeit des Tieres gesorgt hatten. Andrés Hunger und Lebenswille brachten ihn dazu, das fettleibige Tier jeden Morgen vom Fressnapf wegzulocken und sich selbst das Fleisch einzuverleiben. Eine Zeit lang stillte das Hundefutter den ärgsten Hunger, und der ehemals so fette Cäsar wurde immer dünner. Die Wirtin fiel aus allen Wolken, als der Tierarzt ihr mitteilte, dass der Hund unterernährt sei. Dies führte dazu, dass sie André überwachte und ihn schließlich erwischte, als er sich ein Kotelett heißhungrig einverleibte, was zum sofortigen Rauswurf sorgte.
Daraufhin kam er für ein paar Wochen bei einem Kommilitonen unter, einem etwas spillerigen Burschen namens Heinz–Dieter Sartorius, der Gedichte schrieb, die nach dessen wortreichen Erklärungen an Baudelaire erinnern sollten, aber nicht viel taugten, jedoch morbide genug waren, um von einigen rechtsgerichteten Blättern veröffentlicht zu werden. Sie wechselten sich ab, wer im Bett schlief oder auf der Couch und dies funktionierte eine Zeit lang recht gut. Wenn auch André es recht störend empfand, dass der gute Sartorius in der Nacht beim Dichten auf und ab ging und im Absinthrausch besessen fluchte, wobei er theatralisch mit den Zähnen knirschte und sogar mit den Fäusten drohte, um sich dann an den Schreibtisch zu stürzen und die Verse laut deklamierend aufs Papier zu werfen.
Vielleicht müssen Dichter so sein, sagte sich André und beneidete den Dichter ein wenig um seine Kunst. Er wusste wenigstens, woran er sich zu halten hatte. Er selbst wusste immer noch nicht, wie es weitergehen sollte. Mittlerweile waren ihm Zweifel gekommen, ob das mit dem Journalismus das Richtige für ihn war und zu den Sternen führen würde. Aber genau dorthin wollte er hin. Den Glauben daran hatte er noch nicht verloren. Doch so sehr er seine Kleider auch pflegte, so sah er doch immer mehr wie ein Stadtstreicher aus. Sein Äußeres war in dieser Zeit nicht dazu angetan, dass sich die Mädchen nach ihm umdrehten, und er kam sich bereits so vor, wie er aussah: wie ein hoffnungsloser Versager. Er kannte nun Hunger und Kälte und Einsamkeit. Aber dann kam schließlich doch ein wenig Poesie in sein Leben, wenn es auch der Einblick in ein anderes Leben war, das ihm zu einem Traumbild verhalf.
Vor der Treppe der Hochschule fand er ein kleines rotes Buch, auf dem in goldenen Buchstaben One Year Diary stand. Er hob es auf, aber es war niemand zu sehen.
Er war wieder einmal zu spät zu den Vorlesungen gekommen, die Tür zum Hörsaal war bereits verschlossen gewesen. Er hatte sich bereits mit dem Gedanken befasst, zum Romanischen Café aufzubrechen.
Er schlug das Tagebuch auf. Auf der Innenseite war in einer sorgfältigen, fast kindlichen Schrift eingetragen, wem es gehörte: Gerda Pohorylle. Er setzte sich auf die Treppe und las die Eintragungen. Sie war wohl ein lebenslustiges Mädchen und erzählte von Begegnungen mit interessanten, meist älteren Männern, und alle schienen sie reich zu sein und die kleine Lolita zu verwöhnen. Er schätzte sie auf vierzehn, höchstens sechzehn Jahre. Fasziniert las er das Tagebuch bis zum Ende. Auf einer der letzten Seiten erfuhr er, dass sie siebzehn geworden und den Freund ihres Vaters liebe. Eine Liebelei, die auch zur Entjungferung führte. Schließlich war sie enttäuscht worden.
Ich hasse die Männer. Sie sind alle Egoisten, schrieb sie am Ende des Tagebuches. Doch es stand auch, dass sie nun jemanden vom Rundfunk kenne, der sehr nett sei. Es war ein Name, den er, André, auch schon mal gehört hatte, wenn er auch nicht wusste, in welchem Zusammenhang. Und dann fand er noch einen sorgfältig zusammengefalteten Brief, in dem Gerda ihrer Freundin schrieb, dass Richard ein Blender, Vielschwätzer und Besserwisser sei und es mit ihm keine Zukunft gäbe und sie nun wisse, dass man mit einem Mann niemals glücklich werden könne und die Freundschaft zu einer Freundin allemal vorzuziehen sei. Sie hatte den Brief nicht abgeschickt, und er fragte sich, warum. Das alles war etwas unreif und zeigte ihm das Porträt eines egozentrischen verwöhnten Mädchens. Doch das Foto, das aus einer Seitentasche im Einband herausfiel, beeindruckte ihn sehr. Es zeigte ein Mädchen mit dem jugendlichen Gesicht der Garbo und mit Haaren, die ihm bis auf den Rücken fielen.
Er las noch häufig in dem kleinen roten Tagebuch und begann einen Roman, in dem Gerda Pohorylle im Mittelpunkt stand. Er sollte ihn nie beenden. Doch das Schreiben half ihm eine Zeit lang über die vielen schlimmen Stunden hinweg. Heinz–Dieter, der sich auch bald des Tagebuchs annahm, schuf ein zartes Gedicht über die Unbekannte, das in einer seriösen Zeitschrift wie der Frankfurter Illustrierten veröffentlicht wurde, und André wünschte sich, dass das Mädchen es lesen würde. Aber in ihren Kreisen las man vielleicht keine Zeitungen. Ihr Vater schien im Diplomatischen Dienst zu stehen. Sie erzählte in dem Tagebuch viel von ihren Pferden, vom morgendlichen Ausritt und Cocktailpartys und Picknicks mit Champagner und von anderen mondänen Vergnügungen wie Tanztee und Kutschfahrten im Mondschein, einem Leben also, das er nur vom Hörensagen kannte.
Aus Heinz–Dieters Erfolg erwuchs auch André ein Vorteil, denn dieser lernte Zeitungsleute und Fotografen kennen und konnte ihm eine Anstellung als Laufbursche in dem Fotoatelier eines Modefotografen vermitteln. Er musste Requisiten besorgen, die Lampen zurechtrücken, die Brötchen holen und in der Dunkelkammer helfen. Nichts Großartiges, mehr als ein paar Reichsmark brachte es nicht, aber er schöpfte daraus Hoffnung und mietete sich eine neue Kammer in den Hackeschen Höfen. Die Wirtin, eine Ostpreußin, Witwe seit zwei Jahren und immer noch recht lebenslustig, schien den jungen Mann mit dem unverschämten Lachen trotz seines abgerissenen Eindrucks zu mögen und überließ ihm die Anzüge ihres Verblichenen. Sie waren ihm zwar zu groß, aber André hatte genug in dem Schneideratelier seiner Mutter gelernt, um sie auf seine Maße abändern zu können. Nur die Schuhe passten ihm nicht. Trotzdem sah er nun leidlich respektabel aus, und dass sie ihm öfter über die Haare strich und ihn manchmal in einer plötzlichen Anwandlung an ihre noch recht gut erhaltenen Brüste drückte, war ein geringes Entgelt für die Kleidung und die Mietschulden.
Jedenfalls war er davon überzeugt, dass seine Schicksalskurve nun nach oben zeigte.