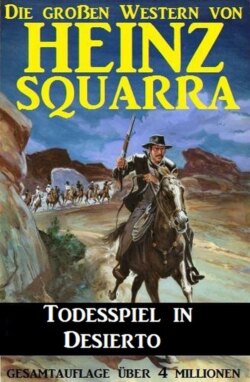Читать книгу Todesspiel in Desierto: Die großen Western von Heinz Squarra - Heinz Squarra - Страница 7
2
ОглавлениеAls Chaco den Kopf hob, traf ihn das grelle Licht der noch tief im Osten stehenden Sonne.
Feroz musste ihn aus dem Keller geschleift haben. Seine Hände waren gefesselt wie zuvor. Sein Kopf schmerzte von dem brutalen Schlag des Irren, vor seinen Augen flimmerte es, und er sah alles etwas verzerrt. Er lag auf der durchglühten Straße von Desierto, dem verlassenen, zum größten Teil bereits verfallenen Goldgräbercamp in der Wüste. Die Bretterbuden schienen ihn anzugrinsen, und in den schwarz gähnenden Höhlen der Fenster gaukelten ihm seine geschundenen Sinne hämische Fratzen vor, die es nicht gab. Feroz und er waren allein in diesem Nest, um das herum es nur Sanddünen und weiter entfernt ein paar kümmerliche Kakteenfelder und vulkanische Felsen gab.
Hinter Chaco erschallte ein lautes Kratzen im Sand der Straße. Er wälzte sich herum und sah Feroz, der mit seiner Lanze einen Strich in den Sand zog.
Der Irre grinste, zeigte auf die Furche im Boden und sagte: „Wenn der Schatten bis hierher reicht, werde ich dich verfolgen, mein Freund. Es spielte keine Rolle, wie lange du noch hier herumliegen willst.“
Chaco setzte sich. Er hatte jetzt eine Kette zwischen den Beinen. Feroz hatte ihm eine zweite Eisenmanschette um den linken Knöchel geschmiedet, wahrend er bewusstlos
gewesen war. Zwei dicke Nieten sicherten das Eisenblech, an einer dritten war die Kette befestigt. Ohne Werkzeug konnte diese Fessel nicht gesprengt werden. Die Kette war so lang, dass Chaco sie in der Hand halten konnte, wenn er aufstand, so dass es möglich wurde, zu laufen.
Er blickte auf den Schatten des verlassenen Saloons und den Strich. Es konnte noch zwei Stunden vergehen, bis Strich und Schattenriss in Deckung waren. Dann würde Feroz Chacos Pinto satteln und ihn verfolgen, so wie er es am Tag zuvor mit Jim Maldoon getan hatte, mit dessen Kopf er dann zurückgekehrt war.
„Willst du noch lange warten?“ Der Irre kicherte und hüpfte hinter der schmalen Furche hin und her.
Chaco kämpfte sich auf die Beine. Er war noch unsicher.
Feroz ging zur Veranda des Saloons, hob eine dort liegende Wasserflasche auf und warf sie Chaco zu. Ein Riemen befand sich an der mit Leder überzogenen Flasche, so dass Chaco sie sich um den Hals hängen konnte.
„Und mach es mir nicht so leicht“, sagte Feroz freundlich grinsend. „Ich will dich suchen und will Mühe haben, dich zu finden. Und dann will ich einen Kampf. Einen Kampf, hörst du?“
„Willst du mir nicht dein Messer geben?“
„Wozu?“
„Der Kampf könnte dann wenigstens ein klein wenig spannender werden“, erwiderte Chaco.
Feroz vollführte Sprünge in seiner Freude. „Mit dir wird es wirklich ein richtiger Spaß sein!“
„Was ist mit dem Messer?“
„Du hast deine Hände. Verlasse dich ganz auf sie.“
Das Halbblut blickte abermals auf den Strich auf der Straße und den Schatten des Saloons und dann die kümmerliche Häuserzeile hinunter bis zu den zusammengestürzten Buden und den verschütteten Claims. Dahinter war die Mulde zu Ende, in der Desierto lag. Eine Sandhalde stieg zu den Dünen hinauf. Kam man aus der Weite des öden Landes, dann sah man die Stadt erst, wenn man die Dünen erreichte.
„Was musst du noch überlegen?“ Chaco schaute Feroz noch einmal an. Verhandeln war sinnlos und kostete nur die Zeit, die ihm blieb zu entfliehen. Fliehen jedoch war ausgeschlossen, das wusste er so gut wie der Verrückte. Nur hinauszögern konnte er den Tod, indem er seine Spuren so gutes ging verwischte. Feroz würde dann da und dort suchen müssen und länger benötigen, um ihn zu erreichen.
Aber Chaco hatte noch einen anderen Gedanken, und er wunderte sich, dass das Jim Maldoon tags zuvor nicht eingefallen war.
Er drehte sich plötzlich um und nahm die Kette zwischen den Beinen vom Boden auf. Sie klirrte, als er sich die Straße hinunter nach Süden bewegte. Und Feroz‘ irres Gelächter folgte ihm.
Am Ende des verlassenen Nestes wechselte Chaco die Richtung, wandte sich nach Osten, hatte rasch die flache Halde erreicht, die aus dem Kessel führte. Vom Kamm aus schaute er zurück und sah Feroz, der ihm winkte.
Er wandte sich um. Vor ihm lag die Weite – trostlose, glühende Sandmaßen unter flirrender Hitze, Dunst und Staub am Himmel und das Strahlen der Sonne, die deutlich machte, wie riesig die Einsamkeit war. Chaco schleppte sich davon. Bald wurde der Boden härter. Die Spuren waren weniger gut zu sehen. Chaco schlug einen sanften Bogen nach Norden. Er musste Feroz vor allem einmal täuschen und ihn in eine andere Richtung locken als in jene, die er wirklich zu nehmen gedachte.
An seinem rechten Bein scheuerte die Manschette über rohes Fleisch, und Blut lief in seinem Stiefel. Aber am linken Bein wurde die Haut nun ebenfalls rasch von dem Eisenband abgeschabt, und das Blut begann zu laufen. Die Schmerzen steigerten sich. Chaco presste die Lippen zusammen, dass sie wie ein Strich in seinem dunkelhäutigen, von Falten durchfurchten Gesicht standen. Er wollte nicht daran denken.
Der Boden wurde wieder weicher, und seine Spuren waren wieder besser zu erkennen. Chaco lief abermals nach Osten. Nach einer Stunde hatte er ein paar Kakteen erreicht, blieb stehen und trank keuchend und schwitzend das laue Wasser aus seiner Flasche. Er wischte sich über den Mund und dürstete noch mehr als vorher. Aber es galt, das Wasser einzuteilen, damit er sich nicht um den Rest seiner Kraft brachte.
Zwischen den Kakteen fand er ein wenig Schatten und ein verschüttetes Wasserloch. Er kniete, grub ein Stück in den heißen Sand, gab es aber bald auf. Hier würde er kein Wasser finden.
Er stand auf und schleppte sich weiter. Jetzt musste er schneller gehen und den Bogen vervollständigen. Er musste dorthin gelangen, wo er wirklich eine Chance haben würde: nach Desierto.
Mehrmals schaute er zurück. Hier war der Sand zu locker, dass die Spur weit zu sehen war. Hier würde Feroz merken, was gespielt wurde und wissen, dass Chaco nach Desierto umgekehrt war. Feroz hatte ein Pferd und konnte die Zeit abkürzen.
Chaco lief schneller. Immer mehr Blut lief in seine brüchigen Stiefel und immer höllischer wurden die Schmerzen an den Beinen. Die Glieder der Kette klirrten. Chaco schwitzte so sehr, dass ihm die Kleider am Körper klebten. Endlich sah er vor sich die Dünen auftauchen, hinter denen das Nest in der unsichtbaren Senke lag. Er wusste nicht, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Aber da Feroz nicht auftauchte, konnten die zwei Stunden Galgenfrist noch nicht verstrichen sein.
Keuchend schleppte sich Chaco eine Düne hinauf, trat fehl, stürzte und rollte durch den Sand wieder hinunter. Er lag von Schmerzen und Strapazen gepeinigt auf dem Rücken und sah den leuchtenden Feuerball am Himmel. Noch liegend öffnete er die Flasche und trank den Wasserrest.
In Desierto würde er mehr und kaltes Wasser im Keller finden. Die Nähe der anstehenden Entscheidung ließ ihn die Schwäche überwinden. Chaco kroch die Sanddüne hinauf und spähte in das längliche Tal mit dem ausgetrockneten, umgewühlten Bachbett hinunter.
Feroz stand dort, wo er den Strich in den Sand gezogen hatte. Jetzt aber hatte er das Pferd Chacos bei sich. Das einzige in Desierto vorhandene Tier war bereits gesattelt. Die Spitze des selbstgebastelten Speers funkelte im Sonnenlicht. Feroz hatte das uralte, lange Gewehr in der Hand. Gerade schwang er sich in den Sattel und ritt über die Straße.
Chaco schob sich etwas zurück, um nicht gesehen zu werden. Als er wieder einen Blick in die Tiefe wagte, war der Irre vor den zusammengestürzten Buden bereits nach Osten abgeschwenkt.
Chaco fieberte den Augenblick entgegen, an dem Feroz aus dem Tai sein würde. Da hatte er die sanfte Halde erreicht und ritt sie hinauf, über die Kuppel hinweg und auf der Spur Chacos in die Einöde hinaus. Er hatte nichts bemerkt. Chaco atmete befreit auf und spürte neue Kraft in sich.
Feroz ritt weiter und weiter. Er zeigte keine übermäßige Eile. Chaco richtete sich auf und lief geduckt mit der Kette in der Hand in die Mulde hinunter. Als er wieder nach Osten blickte, konnte er Feroz nicht mehr sehen.
Er war allein in Desierto. Für eine Weile gehörte ihm das verlassene Nest.
Zunächst lief Chaco am Saloon vorbei und bog in die schmale Gasse ein, die sich zwischen dem hohen Holzgebäude und dem ehemaligen Office des Sheriffs abdeckte, stieß das Holz auseinander und tastete sich in den engen Gang hinunter.
Im fahlen Dämmerlicht sah er die alten Möbel, die Feroz herangeschleppt hatte, den Pfahl und die Wasserpumpe, zu der er lief. Er setzte den Schwengel der Pumpe in Bewegung. Der Kolben klapperte mit hohlen Geräuschen im Gehäuse, dann jedoch war ein lautes Saugen zu hören, die Pumpe ging schwerer und spie Wasser aus. Chaco wusch sich die Hände und das Gesicht und trank. Zwischendurch musste er immer wieder pumpen, um neues Wasser aus der Tiefe herauf zu befördern.
Das kühle Nass tat ihm gut, stillte seinen Durst und spülte den Sand aus dem Mund fort. Seine Gedanken überstürzten sich nicht mehr. Kalt dachte er an das Nächstliegende und begann mit der Durchsuchung des Kellers. Zunächst hoffte er, eine Waffe zu finden, möglichst einen Revolver, um kämpfen zu können, wenn Feroz schneller als erwartet auftauchen würde. Aber er fand keine Waffe. Es gab weder einen Revolver noch ein Gewehr hier unten. Noch nicht einmal ein Messer fiel ihm in die Hände.
In der Dunkelheit des kleinen Raumes, in dem Kate Harrison die Gefangene von Feroz gewesen war, ertasteten Chacos suchende Hände einen Hammer.
„Verdammt“, sagte er leise, schaute sich weiter um und fand andere Werkzeuge. Auch ein Meißel fiel ihm in die Hände. Doch auch hier gab es keine Waffe. Feroz musste sie so gut versteckt haben, dass jetzt nicht daran zu denken war, sie doch noch zu finden.
Er musste sich von der Kette befreien, um schneller und ungehindert laufen zu können. Dann würde er weitersehen. Chaco schleppte sich in den größten Kellerraum zurück und setzte sich dort auf den Boden, wo das Tageslicht den Gang erhellte. Einen Amboss hätte er noch brauchen können. Oder wenigstens eine größere Eisenplatte, damit er die Schellen auflegen und sprengen konnte. Noch einmal durchsuchte er die Kellerräume. Ihm fiel ein, dass Feroz einen großen Hammer untergelegt hatte, als er Jim Maldoons eiserne Manschette zusammennietete. Er konnte den großen Vorschlaghammer jedoch nicht im Gang finden und auch nicht in Kates verlassenem Gefängnis.
Neue Schweißbäche liefen Chaco über das Gesicht. Die Zeit rann unaufhaltsam dahin. Er überlegte, ob er den Saloon durchsuchen sollte. Aber es gab noch mehr Hütten und Trümmer sowie Hunderte von Verstecken. Irgendwie musste der Irre im Unterbewusstsein mit der Möglichkeit gerechnet haben, dass er, Chaco, sich zu irgendeiner Zeit der Fesseln zu entledigen versuchen würde.
Er lief wieder zu dem Gang, setzte sich und kratzte mit dem Meißel eine Kuhle in den Sandboden, damit er das Bein in sie legen konnte und eine Unterlage für die Nieten fand. Vielleicht konnte auch ein Brett hilfreich sein. Chaco griff zu einem Haufen Gerümpel hinüber und zog ein kurzes Brett aus dem wüsten Stoß. Es ging. Er legte es unter, setzte den Meißel an und schlug zu. Aber der Meißel rutschte ab, die Manschette verrutschte, und der Schmerz ließ Chaco wild fluchen. Neues Blut lief über sein zerschundenes Bein. Es nutzte nichts. Er musste von der Kette loskommen.
Mit zusammengepressten Lippen setzte er den Meißel erneut an und schlug mit dem Hammer zu.