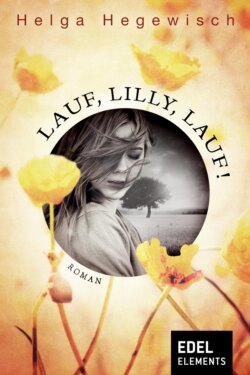Читать книгу Lauf, Lilly, lauf! - Helga Hegewisch - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wendepunkt
ОглавлениеOktober neunzehnhundertvierundvierzig. Seit ein Großteil von Lillys Heimatstadt Hamburg zerstört ist, wohnt sie mit ihrer Familie in Mecklenburg auf der Domäne Staaken außerhalb des Dorfes Galitz. Irgendwo, sehr weit weg, tobt der Krieg.
»Gar nicht mehr so weit weg«, sagt die Mutter, »und er kommt näher, jeden Tag.«
Lilly weiß, dass ihre Mutter, wenn sie so etwas sagt, Angstaugen kriegt. Angst jedoch hilft überhaupt nichts, die macht alles nur noch schlimmer. Darum versucht Lilly, nicht hinzuschauen und nicht hinzuhören und ganz schnell an etwas anderes zu denken. Lilly ist sehr gut im Wegdenken.
»Möchte nur mal wissen, wo du jetzt grad wieder bist«, sagt dann die Mutter.
Lilly zuckt die Schultern. Sie hat keine Lust zu antworten. Lilly ist fast fünfzehn Jahre alt und davon überzeugt, dass die Erwachsenen sie nicht verstehen. Zwar ist man von ihnen abhängig und man kann sie sogar gerne haben und vielleicht auch lieben und ihnen zuhören und sich von ihnen beschützen lassen, aber man sollte nie auf Verständnis hoffen. Ebenso wie die Erwachsenen nicht erwarten können, dass ihre Kinder sie verstehen. Daran scheint ihnen allerdings auch kaum gelegen zu sein, denn meistens geben sie sich nicht die geringste Mühe, ihr Verhalten zu erklären. Obgleich das, was sie tun und beschließen, oft auch ihre Kinder betrifft, erwarten sie keine Rückfragen.
Und wo ist Lilly, wenn sie weghört und wegschaut und wegdenkt? Ziemlich oft bei ihrer Freundin Isa oder auch bei dem Buch, in dem sie gerade liest (momentan »Die Barrings«, wo alles so schön vornehm und so schrecklich traurig ist), oder irgendwo in ihrer Phantasie.
»Im Krieg braucht man sehr viel Phantasie«, sagt Onkel Jupp, Vaters jüngerer Bruder, der seit seiner Verwundung meist bei ihnen ist. Man hat ihm an der Ostfront einen Fuß weggeschossen, deshalb arbeitet er jetzt in der Verwaltung, wie er das nennt, und diese »Verwaltung« befindet sich nur eine Autostunde entfernt von Galitz. Für Lilly gehört er in die Abteilung »Gern haben und sich beschützen lassen«, und er ist ihr inzwischen vertrauter als der Vater, der vor über zwei Jahren während des Afrika-Feldzugs vermisst gemeldet wurde und von dem die Familie seither nichts gehört hat. Mama und Onkel Jupp sind der Meinung, dass Lillys Vater tot ist. Lilly selbst will sich damit nicht abfinden und wartet immer noch auf eine Nachricht.
Montagmittag. Die müde träge Stunde nach Schule und Mittagessen. Im Hause ist es sehr still. Lilly liegt auf dem Bett und hat zu nichts Lust, schon gar nicht zu den Hausarbeiten. Außerdem hat sie Bauchweh, vermutlich kriegt sie ihre Tage. Eine schrecklich überflüssige Angelegenheit, findet Lilly, daran ändern auch die schlauen Erklärungen der Erwachsenen nichts. Lilly beschließt, ein Stündchen zu schlafen. Sie legt sich auf die rechte Seite und schiebt den linken Arm über ihre Augen.
Schön, das Wegrutschen in den Schlaf, die Wirklichkeit stellt keine Ansprüche mehr, alles wird möglich.
Und plötzlich bricht aus der Mittagsstille das Chaos hervor, es knallt und kracht und detoniert, die Welt ist verrückt geworden.
Lilly springt vom Bett und rennt nach unten in die Diele. Da sind auch schon die anderen. »Hinlegen, verdammt noch mal, legt euch hin«, schreit Onkel Jupp.
Im Niederwerfen schlägt Lilly sich die Stirn an der Heizung auf. Das ist der Krieg, denkt sie, nun ist der Krieg auch zu uns gekommen. Platt auf den Boden gedrückt bedeckt sie ihren Kopf mit den Händen, obgleich das kaum etwas nützen dürfte, wenn eine Bombe das Haus trifft. Wieso Bombe, wir sind hier auf dem Lande, weit und breit kein lohnendes Ziel. Krieg, Krieg, Krieg. Lilly denkt immer nur dies eine Wort, dabei erklärt es überhaupt nichts. Die Angst ist wie eine große nasse Pferdedecke, die auf Lilly heruntergefallen ist und sie zu ersticken droht.
Und ebenso plötzlich, wie es begonnen hat, ist es vorüber; ein schnell leiser werdendes Brummen, das war’s dann. Tatsächlich, war’s das?
Onkel Jupp fasst sich als Erster. »Vielleicht kommen sie wieder«, ruft er, »alle runter in den Keller.«
Auf die Idee ist Lillys Bruder Joachim auch schon gekommen, aber der Keller ist abgeschlossen. Wieso denn das? Natürlich, ja, wegen der Vorräte! Wo ist der Schlüssel? Sie drängeln sich allesamt vor der Kellertür und der Schlüssel ist nicht da.
»Irene, gib den Schlüssel her«, schreit Onkel Jupp.
Mit hastigen Bewegungen greift sich Mama in die Tasche, fährt über den Fenstersims, sucht hinter dem Blumentopf. Mama kann den Schlüssel nicht finden. Lilly starrt sie an. Angstaugen, was denn sonst, Keuchen und Schluchzen.
»Tut mir Leid, ich … ich weiß nicht … heute Morgen war der Schlüssel noch …«
»Oma Elli«, ruft Onkel Jupp, »hast du den Schlüssel gesehen?«
»Ich weiß genau, dass ich ihn Irene gegeben habe. Nimm dich zusammen, Tochter, gib jetzt sofort den Schlüssel her!«
Und da sind die Flugzeuge auch schon zurückgekommen und donnern erneut über sie hinweg. Die Familie auf dem Boden vor der Kellertür eng aneinander gedrückt. Mama schreit, die anderen sind ganz still.
»Ruhig, Irene«, sagt Onkel Jupp, »ganz ruhig, die meinen nicht uns.«
»Aber wen meinen sie denn?«
»Hör auf zu schreien, du machst die Kinder verrückt.«
»Es ist meine Schuld«, jammert Mama, »immer verlier ich die Schlüssel.«
Onkel Jupp legt seinen Arm um die Mama. »Hör doch, sie ziehen wieder ab.«
Alle lauschen. So seltsam, die plötzliche Stille, niemand rührt sich vom Fleck. Es war ja auch wieder nur eine Schleife. Diesmal schreit Mama nicht. Onkel Jupp hält sie ganz fest, kann sein, dass er ihr die Hand auf den Mund gelegt hat. Die schwere Angstdecke drückt Lilly das Herz zusammen, sie würde gern ohnmächtig werden, aber das passiert ja nur in Büchern.
Noch zweimal kommen die Flugzeuge zurück, dann endlich machen sie sich davon. Was war das nur, was haben sie hier gewollt? Das Haus jedenfalls ist nicht getroffen.
»Ich weiß«, sagt Joachim zu Onkel Jupp, »dein Lastwagen, der steht vor der Scheune. Den wollten sie treffen. Ich hab schon immer gesagt, dass das unvorsichtig ist!«
»Na klar«, reagiert Onkel Jupp ärgerlich, »unser Joachim hat es schon immer gesagt!«
Aber es war nicht der Lastwagen, der steht an seinem üblichen Platz, heil und unberührt, man kann ihn durch das Fenster sehen. Onkel Jupp reicht zuerst Oma Elli die Hand und dann Mama und zieht sie beide vom Boden hoch. Er kann schon wieder lachen. »Da sieht man mal, wohin eure Sparsamkeit führt!«, sagt er. »Eher lasst ihr uns alle zu Grunde gehen, als dass ihr uns Zugang zu euren Vorräten gestattet!«
»Ich werd den Schlüssel schon finden«, schluchzt Mama, »bestimmt finde ich ihn!«
»Aber sicher.« Er schiebt Mama ins Wohnzimmer und drückt sie in den großen Lehnsessel. »Ich geh jetzt und seh nach, was passiert ist.«
»Werden sie wiederkommen?«, fragt Mama.
»Das glaube ich nicht. Aber ich will auf keinen Fall, dass einer von euch das Haus verlässt, jedenfalls nicht, bis ich zurück bin. Das ist ein Befehl!«
Nie zuvor hat Onkel Jupp gesagt, dass irgendetwas ein Befehl ist. Lilly hätte das auch ziemlich blöd gefunden. Heute allerdings erscheint es ihr vollkommen richtig.
Kaum ist Onkel Jupp gegangen, verzieht sich Oma Elli ins Badezimmer. Das tut sie immer, wenn sie sich aufregt. Mama sitzt mit geschlossenen Augen im Sessel und atmet schwer. Der kleine Felix drückt sich an ihre Knie. Obgleich sie sich am meisten von allen aufgeregt hat, ist sie doch der Mittelpunkt der Familie, dem sie alle nahe sein wollen. So sitzen und stehen die drei Kinder und die beiden polnischen Mädchen Magda und Danuta um die Mutter herum und schauen sie an und erwarten von ihr irgendwelche Anweisungen.
Die kommen dann auch bald. Mama nimmt sich zusammen. »Ich weiß jetzt, wo der Schlüssel ist«, sagt sie zu Lilly. »Oben im Schlafzimmer, hinter Papas Foto. Geh bitte und hol ihn mir.«
Lilly läuft die Treppe hinauf, greift sich den Schlüssel und rennt, so schnell sie kann, wieder hinunter, sie will jetzt nicht allein sein. Der sechzehnjährige Joachim hat sich hinter Mamas Stuhl aufgebaut und ihr die Hände auf die Schultern gelegt. Lilly findet, dass er aussieht wie der Hitlerjunge auf diesem Reklameplakat mit der Inschrift »Die deutsche Jugend kennt ihre Verantwortung«. Eigentlich hat ihr das Plakat immer ganz gut gefallen, aber dass Joachim jetzt so tut, als wäre er ein jungdeutscher Held, der seine arme alte Mutter beschützen muss, das erscheint ihr albern und unpassend. Erstens zweifelt sie stark an der Heldenhaftigkeit ihres Bruders und zweitens hat Mama nicht die geringste Ähnlichkeit mit der Frau auf dem Plakat, an der alles grau ist, Haare, Gesicht, Kleid und Strümpfe. Lillys Mutter jedoch hat eine weiße Haut und dunkellockige Haare und ihre Lieblingsfarbe ist Rot. Schutzbedürftig ist sie allerdings sehr.
Lilly hat ihrer Freundin Isa erzählt, dass seit einiger Zeit die Angst in ihrer Mutter drinhockt wie eine Krankheit. »Manchmal sitzt sie nur so da mit einem Buch in der Hand, am Abend, wenn alles still und friedlich ist, und plötzlich kann ich es ganz deutlich spüren: Mama zittert vor Angst und ist nahe daran, laut aufzuschreien.«
»Und was dann?«, hat Isa gefragt.
»Nicht viel. Sie blättert schnell ein paar Seiten um. Oder sie sieht zu mir hin und sagt: ›Ich mag nicht, wenn du mich so anstarrst.‹ Oder sie geht in die Küche und macht sich einen Kamillentee.«
»Wovor hat sie denn Angst?«
»Ich weiß nicht. Wenn Onkel Jupp da ist, geht es ihr sofort besser. Aber kaum ist er weg, fängt es wieder an. Und dann kommt mein Bruder, dieser Blödmann, und macht hier den großen Beschützer. Totaler Käse, sag ich dir, wenn’s wirklich ernst wird, kann er nicht mal sich selbst beschützen!«
»Weißt du doch gar nicht«, hat Isa, die Joachim nicht ganz so kritisch beurteilt wie Lilly, darauf gesagt.
Lilly legt ihrer Mutter, die mit geschlossenen Augen im Sessel sitzt, den Schlüssel in den Schoß. »Ich mach ein Band dran«, sagt sie, »dann kannst du ihn dir um den Hals hängen.«
»Und wenn die nun doch wiederkommen …«, sagt die Mama.
Lilly gibt sich zuversichtlich. »Bestimmt nicht. Onkel Jupp hat gesagt, dass die nicht uns gemeint haben.«
»Wen denn sonst?«
»Irgendetwas drüben auf dem Hof. Ich hab gelesen, dass die neuerdings auch auf Pferde und Kühe schießen.«
»Warum gehen wir nicht alle in den Keller und warten dort, bis Onkel Jupp zurückkommt?«
»Ich geh nicht in den Keller«, verkündet Joachim. »Wenn das Haus getroffen wird, kriegt man da unten keine Luft mehr und muss langsam ersticken.«
»Und hier oben bist du gleich tot«, sagt Lilly, »dann kommst du schneller in den Himmel. Natürlich in einen feudalen Sonderhimmel, reserviert für die tapferen Führer der Hitlerjugend.«
»Während du direkt in die Hölle abrauschst. Dann brauchen wir uns nie mehr wieder zu sehen.«
»Immer dieses Streiten …«, flüstert die Mutter und beginnt zu weinen. Sie schluchzt nicht, verzieht nicht das Gesicht, sie lässt nur die Tränen still die Wangen hinunterlaufen. Ihre Hände im Schoß hat sie so fest zusammengepresst, dass die Knöchel ganz weiß aussehen. »Wenn Jupp nur nichts passiert!«, sagt sie.
Die beiden Polinnen tuscheln miteinander und schieben sich dann langsam in Richtung Tür. Doch bevor sie hinausgehen können, fährt Joachim sie an: »Der Major hat gesagt, wir sollen hier bleiben. Also richtet euch gefälligst danach.«
Magda und Danuta schrecken zusammen und kommen zurück. »Ist doch der kleine Mischa drüben auf dem Hof«, jammert Magda, »muss ich doch nach ihm sehen!«
»Musst du gar nicht. Du hast doch gehört, was der Major gesagt hat!«
Joachim nennt Onkel Jupp immer den Major, obgleich dieser es sich verbeten hat.
»Aber der kleine Mischa …«, murmelt Magda. »Ist doch erst vier Jahre alt, rennt draußen rum.« Ächzend hockt sie sich neben Mamas Sessel auf den Teppich.
Da nimmt die Mutter ihre verkrampften Hände auseinander, wischt sich mit der einen die Tränen weg und legt die andere auf Magdas Schulter. »Der Major gibt schon Acht«, sagt sie, »hab keine Angst.«
Merkwürdig, denkt Lilly, nun spricht die Mama auch schon vom Major.
»Vielleicht war das Ganze ja ein Irrtum und sie kommen wirklich nicht wieder«, sagt Mama mit inzwischen tränenfreier Stimme. »Joachim, schließ die Kellertür auf und lass den Schlüssel stecken. Magda und Danuta gehen in die Küche und machen für alle Tee, und Lilly kümmert sich um den Kleinen.«
»Lilly Blut am Kopf«, sagt der kleine Felix.
Mit gerunzelter Stirn betrachtet die Mutter ihre Tochter. »Was hast du denn gemacht?«
»Weiß ich nicht.«
»Tut’s dir weh?«
»Nicht sehr.«
»Also geh und hol dir ein Pflaster. Der Kasten steht im Schrank neben dem Herd.«
Als Lilly aus der Küche zurückkommt, steht die Mutter in der Diele am Fenster und starrt hinüber auf die andere Straßenseite, wo die Hofgebäude liegen und die Felder beginnen.
»Ein ziemlich langer Riss«, sagt Lilly »vielleicht muss er genäht werden.«
Die Mutter wendet sich ihr zu und sieht sie verständnislos an. »Was muss genäht werden?«
Lilly deutet mit dem Finger auf ihre verpflasterte Stirn. »Der Riss an meiner Stirn.«
»Ach Unsinn. Sieh doch mal, all die vielen Menschen auf dem Hof. Was machen die da nur?«
Lilly ist gekränkt. Seit sie die Wunde gesehen hat, tut ihr die Stirn tatsächlich sehr weh, und ihre Mutter könnte sich gern etwas interessierter zeigen.
Joachim kommt heran. »Die Menschen da drüben, die gehören zu dem Gefangenenzug. Die sind gestern Abend hier angekommen, sie sollen weiter nach Westen verlegt werden. Der Major hat den Inspektor dazu überredet, sie in der großen Feldscheune schlafen zu lassen. Ich dachte, die wären längst weg.«
»Kriegsgefangene?«, fragt die Mutter.
»Engländer«, erklärt Lilly. »Sie sind schon seit über einer Woche unterwegs.«
»Woher willst denn du das wissen?«, fragt Joachim.
»Weil ich gestern Abend drüben war. Zum Milchholen. Da hat mich einer von denen angesprochen, konnte sogar etwas Deutsch. Ich hab ihm eine Kanne Milch gegeben.«
»Du hast sie wohl nicht alle«, blafft Joachim böse. »Wie kannst du denen unsere Milch geben?«
»Und wieso nicht? Deutsche Soldaten sind ja auch irgendwo in Gefangenenlagern.«
»Was hat denn das damit zu tun?«
»Auf solche dämlichen Fragen antworte ich nicht«, sagt Lilly.
Mama seufzt. »Kinder, Kinder …! Wenn doch endlich Onkel Jupp zurückkäme!«
Der kleine Felix krabbelt auf die Fensterbank. Mama legt beide Arme um ihn und zieht ihn an sich.
Wenn ich jetzt rausdürfte, denkt Lilly, würde ich mich aufs Fahrrad setzen und zu Isa fahren.
»Ich geh mal telefonieren«, sagt Lilly.
»Kommt nicht in Frage«, sagt Joachim.
»Und wieso nicht?«
»Weil man in Kriegszeiten keine Privatgespräche führen darf. Alle Leitungen werden gebraucht.«
»Du spinnst wohl. Schließlich dauert der Krieg schon über fünf Jahre und soviel ich weiß, hast du bislang beim Telefonieren nie darauf Rücksicht genommen.«
»Bislang war der Krieg ja auch noch nicht bei uns.«
Obgleich Lilly ihrem Bruder in diesem Fall Recht geben muss, sagt sie trotzig: »Wenn ich telefonieren will, dann tu ich’s auch!«
»Versuch’s doch mal«, sagt Joachim und hält ihren Arm fest.
Mama seufzt. »Wo musst du denn so dringend anrufen, Lilly?«, fragt sie.
»Im Schloss. Isa macht sich bestimmt Sorgen.«
»Wenn sie sich so schreckliche Sorgen macht, dann könnte sie ja auch hier anrufen«, sagt Joachim.
»Könnte sie nicht. Weil sie nämlich für jedes Telefonat bezahlen muss und weil sie kein Geld hat.«
»Ach Gott, die Arme!«, feixt Joachim. »Wohnt im Schloss und hat kein Geld.«
»Halt den Mund, Joachim«, sagt Mama. Unverhofft nimmt sie Lillys Gesicht in beide Hände und küsst sie auf die Stirn, gleich neben das Pflaster. »Dann geh schnell und ruf sie an.«
Lilly begreift nicht, wieso sich ihre Mutter plötzlich so liebevoll benimmt, und es gefällt ihr sehr. »Ist ja nicht so eilig«, stottert sie, »vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich hier bleibe und mit dir warte, bis Onkel Jupp zurückkommt.«
»Ja, bleib da, das ist gut«, murmelt Mama und hält nun in dem einen Arm den kleinen Felix und in dem anderen ihre große Tochter. Hinter ihnen steht Joachim, der seine Hände wieder auf Mamas Schulter gelegt hat.
Plötzlich weiß Lilly mit absoluter Sicherheit, dass die Ereignisse des heutigen Tages ihr Leben nachhaltig beeinflussen werden. Was auch immer dort draußen passiert sein mag, was die feindlichen Flugzeuge gewollt und was sie angerichtet haben, es hat mit ihr ganz persönlich zu tun und es wird ein Vorher und ein Nachher geben. Obgleich Lilly keine Ahnung hat, woher ihr dieses plötzliche Wissen kommt, zweifelt sie jedoch keine Sekunde daran.
Das ist der Krieg, denkt sie, mein Krieg.
Während der Bombennächte in Hamburg hat sie Häuser einstürzen sehen und Menschen schreien hören, sie hat den beißenden Brandgeruch in Nase und Kehle gespürt und das zersplitterte Fensterglas von ihrem Bett geschüttelt. Sie ist halb ohnmächtig gewesen vor Angst und in sich zusammengesackt, weil ihre Knochen sie nicht mehr halten wollten. Aber sie hat das alles nie auf sich selbst bezogen. Es war der Krieg der anderen, der Erwachsenen, irgendetwas, das scheinbar mit Ruhm und Ehre zu tun hatte, mit Vaterlandsliebe und Heldentum. Etwas, das passierte, nichts, auf das sie irgendeinen Einfluss nehmen konnte.
Und jetzt, wieso soll das jetzt plötzlich anders sein? Lilly weiß es nicht. Aber sie weiß, dass sie von nun an beteiligt sein wird und selber Entscheidungen treffen muss. Und das gefällt ihr überhaupt nicht.
»Da kommt der Major«, sagt Joachim.
Onkel Jupp überquert mit schnellen Schritten die Straße und läuft auf das Haus zu. Er wirkt verschlossen, fast böse. Seine Jacke ist übersät mit großen roten Flecken. Er reißt die Haustür auf. »Unglaublich«, keucht er, »Tote, Verletzte, die meisten Engländer, aber auch Deutsche. Joachim, du bringst alle verfügbaren Decken und Kissen in den Lastwagen. Die Frauen bleiben zu Hause. Holt die Vorräte aus dem Keller und kocht eine große Suppe. Ich muss wieder raus.«
Die Tür fliegt ins Schloss.
»Wieso …«, flüstert Mama, »das ist doch nicht möglich, haben die etwa ihre eigenen Leute …?«
»Wahnsinn!«, sagt Joachim. »Absoluter Wahnsinn! Ich glaube, ich zieh doch besser meine Uniform an.«