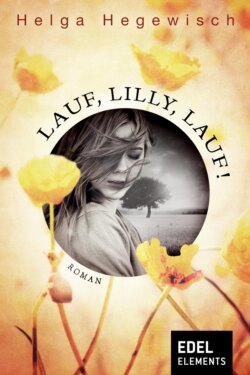Читать книгу Lauf, Lilly, lauf! - Helga Hegewisch - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеOstern 1940 wurde Lilly, seit dem Winter zehn Jahre alt, von der Volksschule am Kirchgarten umgeschult in das Immanuel-Kant-Gymnasium in der Bismarckstraße. Um dorthin zu kommen, musste sie drei Stationen mit der S-Bahn fahren.
Leider war immer noch Krieg. Lillys Papa war tatsächlich eingezogen worden, allerdings nicht als Frontsoldat. Die Heldentaten, so wie sie in Joachims Kriegerheften beschrieben wurden, überließ er Onkel Jupp, der bereits Kompanieführer war und das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen gekriegt hatte. Papa jedoch tat in Frankreich dasselbe wie vor dem Krieg in Deutschland: Er baute Straßen und Brücken.
»Zum Kämpfen ist er auch viel zu alt und zu vernünftig«, hatte Oma Elli dazu gesagt, »dem würde es doch verrückt vorkommen, auf einen anderen Menschen zu schießen.«
»Das kommt vielen Leuten verrückt vor«, hatte Mama geantwortet, »auch den jungen und unvernünftigen. Und wenn’s dann so weit ist und sie kriegen ein Gewehr in die Hand, dann schießen sie doch.«
»Aber bestimmt nur auf Feinde«, hatte Lilly sich eingemischt. »Und Feinde sind keine richtigen Menschen. So jedenfalls hat Lehrer Bender es uns erklärt. Feinde sind wie Juden.« Mama hatte Lilly einen kurzen zornigen Blick zugeworfen, so als wolle sie ihre Tochter zurechtweisen, aber dann hatte sie nur den Kopf geschüttelt, sich umgewandt und war ins andere Zimmer gegangen.
»Was ist denn los mit ihr?«, hatte Lilly Oma Elli gefragt.
»Sie ist sehr nervös und sie redet nicht gern über Politik. Außerdem ist gestern Doktor Rosenbaum abgeholt worden.«
»Doktor Rosenbaum, warum denn das?«
»Weil er Jude ist, natürlich.«
»Kann nicht sein. Der ist bestimmt kein Jude, es muss sich um einen Irrtum handeln.«
»Bei so was gibt’s keine Irrtümer«, hatte Oma Elli gesagt.
Hätte Lilly in der neuen Schule eine Freundin gefunden, dann wäre ihr wahrscheinlich sogar die Lateinstunde als heitere conditio sine qua non – das heißt »unerlässliche Bedingung« – erschienen. Aber die Mädchen, die ihr gefielen, allen voran die blonde Annelies Kretschmar, die schon Schaftführerin bei den Jungmädeln war, wollten sie nicht, und diejenigen, die sich um Lilly bemühten, fand sie blöd oder langweilig.
Einmal, ganz zu Anfang, hatte sie Annelies gefragt, ob sie nicht vielleicht gemeinsam ins Kino gehen wollten, in »Hitlerjunge Quex«.
Entschieden, wenn auch nicht unfreundlich, hatte Annelies abgelehnt.
»Und warum nicht?«
»Also, wenn du mich schon fragst und weil ich mich ja zur Wahrheit verpflichtet fühle: Ich kann nicht mit dir gehen, erstens weil du so jüdisch aussiehst und zweitens weil deine Mutter Engländerin ist.«
Lilly war der Unterkiefer heruntergefallen. »Jüdisch?«, hatte sie gestammelt. »Und wieso Engländerin?«
In allergrößter Ruhe hatte Annelies ihr erklärt: »Mit deinen dunklen Haaren und braunen Augen und schiefen Zähnen. Und dann kriegst du ja auch schon Busen. Juden sind nämlich frühreif. Deine Mutter ist ja genau der gleiche Typ, und man hat mir erzählt, dass sie nur gebrochen deutsch spricht.«
Lilly war ganz still geworden vor so viel gemeiner Verleumdung. Natürlich hätte sie sich wehren müssen, hätte ihren Onkel ins Feld führen können und ihren Vater und das Hitlerbild, das in ihrem Zimmer hing; aber sie hatte sich nur abgewandt, war davongegangen und hatte seitdem nie wieder das Wort an Annelies gerichtet.
Die ganze Angelegenheit war für Lilly besonders kränkend, weil sie nämlich den Führer Adolf Hitler sehr verehrte und sogar liebte. Das taten übrigens alle Menschen, die sie kannte, jedenfalls alle, die darüber sprachen. Vielleicht gab’s ja auch solche, die gegen ihn waren, aber die sagten es nicht.
Früher wollte Lilly immer möglichst schnell erwachsen werden – jetzt nicht mehr. Erwachsensein bedeutete momentan nichts als Mühsal und Sorgen. Sie wollte auch keine Verantwortung übernehmen müssen, sich nicht um den Luftschutz kümmern und um die Lebensmittelmarken und Bezugsscheine. Und schon gar nicht um Politik, wo man so anstrengend dafür sorgen musste, dass man selber immer Recht hatte und der andere Unrecht. Am liebsten wäre Lilly in einen Dornröschenschlaf versunken, um erst vom Friedensengel wieder wachgeküsst zu werden.
Oft hatte sie tatsächlich das Gefühl, in einer Art Schlaf zu sein. Sie mochte sich an nichts wirklich beteiligen, sie wartete. Sie wurde elf, zwölf Jahre, immer noch war Krieg, immer noch hatte sie keine Freundin. Sie fühlte sich sehr allein. Wenn sie ihren Baum nicht gehabt hätte, wäre es noch viel schlimmer gewesen.
Papa kam nur alle fünf, sechs Monate nach Hause und Onkel Jupp kämpfte inzwischen irgendwo in Russland. Mama lachte kaum noch. Sie trug keine roten Sachen mehr und war sehr schweigsam geworden.
Lilly fragte Oma Elli: »Warum redet Mama nicht mehr?«
Oma Elli zuckte die Schultern, überlegte einen Moment und antwortete dann: »Vielleicht hat sie Angst, das Falsche zu sagen.«
Während Papas letztem Urlaub vor sechs oder sieben Monaten hatte Mama so viel geweint, dass er sich schon nach einer Woche wieder davongemacht hatte, obgleich sein Urlaub eigentlich noch gar nicht abgelaufen war. »Sie hat eine Depression«, erklärte Oma Elli, »das ist eine Art Krankheit.«
Nur wenn Onkel Jupp auf Urlaub kam, war es fast wie früher. Dann lachte Mama sogar und wusch sich jeden Tag die Haare und schlug für den Nachtisch die Magermilch so lange mit dem Schneebesen, bis eine steife cremige Masse entstand, fast wie echte Schlagsahne.
Bei seinem letzten Urlaub im Februar zweiundvierzig hatte er ganze zwölf Tage bleiben dürfen, es war wunderbar gewesen. Am letzten Abend von Onkel Jupps Urlaub saßen sie alle noch lange beisammen, tranken und aßen und sprachen vom Frieden, von erleuchteten Straßen und vollen Geschäften und darf’s-ein-bisschen-mehr-sein und vom Tanzvergnügen. Kein Wort von Krieg. Sogar Joachim hielt sich zurück und spielte sich ausnahmsweise mal nicht als zukünftiger Held auf.
Spät in der Nacht, als sie alle längst zu Bett gegangen waren, wachte Lilly noch einmal auf. Unterwegs zum Klo hörte sie aus dem Wohnzimmer leise Musik. Sie schaute durch die angelehnte Tür, und das, was sie dort sah, würde für immer in ihrer Erinnerung hängen bleiben. Im Laufe der kommenden Jahre würde sie der Szene verschiedene Erklärungen zuordnen, freundlich liebevolle und auch böse, anklagende. Wirklich begreifen würde sie sie nicht:
Mama und Onkel Jupp tanzten miteinander. Mama hatte ein rotes Kleid an und ihre dunklen, lockigen Haare waren weder aufgesteckt noch zusammengebunden, sondern hingen offen herunter, fast bis zur Taille. Sie war barfuß und sah in Onkel Jupps großen Armen sehr zart und zerbrechlich aus.
Die beiden drehten sich ganz ruhig umeinander, nach einer langsamen Walzermelodie. Mamas Kopf war weit zurückgebeugt und auf ihrem Gesicht lag ein merkwürdiges Lächeln, nicht froh, aber auch nicht traurig, etwas sehr Fremdes, Fernes, etwas, das Lilly an ihrer Mutter noch nie gesehen hatte.
Onkel Jupps Gesicht dagegen war sehr streng, fast grimmig. Auf seiner Stirn standen feine Schweißperlen und seine sonst so lebhaften, fröhlichen Augen starrten blicklos über Mamas Kopf hinweg.
Sehr früh am nächsten Morgen musste der Onkel abreisen. Mama schloss sich im Schlafzimmer ein und war nicht zu bewegen, sich vom Onkel zu verabschieden. Und mit Joachim war in solchen Fällen ohnehin nicht zu rechnen. Für nichts und niemanden würde man ihn vor seiner üblichen Zeit aus dem Bett holen können. So waren es nur Oma Elli und Lilly, die Onkel Jupp das Geleit bis hinunter zur Straße gaben. Und als Oma Elli die Tränen kamen, da nahm Onkel Jupp sie in die Arme und stemmte sie hoch, als wäre sie nicht siebzig Kilo schwer, sondern leicht wie eine Feder. »Was hast du denn? Ich komme doch bald wieder. Kannst schon Gurken für mich einlegen und Plätzchen backen und Fleischmarken sammeln.«
Und zu Lilly sagte er: »Kümmere dich um deine Mutter, sie braucht dich jetzt. Auch wenn sie manchmal etwas schwierig ist, du musst ihr helfen und auf sie aufpassen.«
»Mach ich«, hatte Lilly gesagt und an den vorherigen Abend gedacht.
Seitdem waren drei Monate vergangen. Der Onkel kämpfte mit seiner Kompanie weit weg in Russland und die Nachrichten von ihm kamen spärlich. Einmal jedoch wurde sein Name sogar im Wehrmachtsbericht erwähnt, das war, als man ihm das Ritterkreuz verliehen hatte für irgendeine besonders tapfere Tat, durch die sich seine Kompanie aus einer nahezu aussichtslosen Lage ohne Verluste hatte befreien können.
Papa befand sich nach wie vor in Frankreich. Manchmal zweifelte Lilly daran, dass er überhaupt je wiederkommen würde. Lilly nahm es ihrer Mutter sehr übel, dass sie für Onkel Jupp lachte und für Papa nur Tränen übrig hatte.
Mamas Zustand hatte sich kaum gebessert, die zehn Tage mit Onkel Jupp waren nur eine kurze Unterbrechung gewesen. Sie sprach kaum, weinte oft, lag viel im Bett, und wenn sie auf war, schrieb sie Feldpostbriefe.
Eines Tages bat Mama Lilly, sie zum Arzt zu begleiten.
»Wieso?«, fragte Lilly erschrocken. »Bist du krank?«
»Nicht wirklich«, sagte Mama, »nur eine Routineuntersuchung, aber es wäre nett, wenn du mitkommst.«
Lilly war begeistert, dass ihre Mutter sie um etwas bat. »Gehst du zum Arzt wegen der Depressionen?«, fragte sie.
»Auch«, antwortete Mama.
Während ihre Mutter bei der Untersuchung war, saß Lilly allein im Vorzimmer bei der Sprechstundenhilfe. Die hatte einen großen breiten Busen und ein strenges Gesicht mit Haaren auf der Oberlippe. Direkt unterhalb des Doppelkinns prangte eine silbern gerandete Rot-Kreuz-Nadel und an der rechten Hand trug sie zwei Eheringe. »Na«, sagte sie, »was schaust du mich denn so an?«
Lilly wurde rot. »Ich hab mir bloß überlegt«, stotterte sie, »warum Sie zwei Eheringe tragen. Heißt das, dass Sie vielleicht zwei … ich meine … also zwei Männer, nicht direkt zwei Ehemänner natürlich, aber irgendwie … ach, ich weiß auch nicht.«
»Das heißt«, sagte die Schwester ohne eine Miene zu verziehen, »dass ich Witwe bin. Kriegerwitwe.«
»Oh«, sagte Lilly erschrocken, »tut mir Leid, wirklich.«
»Mir auch«, sagte die Schwester. »Sonst noch Fragen?«
Lilly nahm sich zusammen. »Ja, schon. Nämlich: Was ist eine Depression?«
»Das ist, wenn man grundlos traurig ist.«
Lilly horchte auf. »Grundlos?«
»Hm«, machte die Schwester.
»Und was ist, wenn man Grund hat?«
»Dann ist man nicht deprimiert, sondern einfach nur traurig.«
»Ja, dann …«, sagte Lilly nachdenklich, »dann kann es im Krieg eigentlich kaum Depressionen geben, weil doch fast jeder Grund hat, traurig zu sein.«
»Du bist gar nicht so dumm«, sagte die Schwester. »Bist du schon beim BDM?«
»Natürlich. Jungmädelschaft fünf Strich dreizehn.«
»Sehr gut.« Aus einer großen blauen Flasche schüttelte die Schwester ein paar Tabletten in die Hand und reichte sie Lilly: »Vitamin C zum Lutschen. Probier mal.«
»Kenn ich«, sagte Lilly, »die schmecken sehr gut.«
Es waren die gleichen Pillen, die täglich in der Schule ausgegeben wurden, eine pro Kind und Tag. Sie galten allgemein als Zahlungsmittel für kleine und große Gefälligkeiten. Natürlich nicht bei Annelies und ihrer Gruppe, aber bei den etwas weniger Verantwortungsbewussten wie Lilly. Dankbar griff sie zu.
»Die helfen gegen alles«, sagte die Schwester.
»Auch gegen Depressionen?«
Die Schwester sah Lilly ins Gesicht. »Wer ist denn deprimiert? Du?«
»Nein, ich bin nur manchmal traurig.«
»Wer denn sonst?«
»Meine Mutter. Deshalb ist sie zum Arzt gegangen.«
»Deprimiert, so so«, sagte die Schwester. Es klang nicht sehr überzeugt. »An welcher Front kämpft denn dein Vater?«
»Frankreich«, sagte Lilly. »Und er kämpft nicht, er baut Brücken und Straßen.«
»Kommt er oft auf Urlaub?«
»Nein. Er kann es nicht leiden, dass Mama so viel weint.«
Die Schwester zuckte die Schultern. »So sind sie eben, die Männer.«
»Aber Onkel Jupp kommt. Er ist Papas Bruder und kümmert sich um uns. Papa und Onkel Jupp sind sehr eng. Sie wechseln sich ab.«
»So so«, sagte die Schwester und steckte sich selbst ein Vitaminbonbon in den Mund.
Lilly überlegte, was sie anstellen könnte, um noch ein paar weitere Pillen zu ergattern. »Weinen ist irgendwie wehrzersetzend«, sagte sie, »finden Sie nicht auch?«
Mit gerunzelter Stirn sah die Schwester Lilly an. »Wann ist denn dein Vater zuletzt auf Urlaub gewesen?«
Plötzlich wurde Lilly die Unterhaltung sehr unangenehm. »Aber meine Mutter kann nichts dafür, wirklich nicht«, sagte sie hastig, »es ist nur wegen der Depression.«
»War dein Vater Ostern da? Und Weihnachten?«, beharrte die Schwester auf ihrer Fragerei.
Lilly wich aus. »Er schickt uns Pakete. Aber leider hat er wenig Zeit. Zu viele kaputte Straßen und Brücken. Und die Franzosen selbst können das wohl nicht so gut, deshalb muss mein Vater es machen, ist ja auch wichtig. Und richtig kämpfen, so wie in den Sondermeldungen, das macht dann mein Onkel Jupp.«
»Keine ernsthaften Leute, diese Franzosen«, sagte die Schwester. »Zu viel Parfüm und Schnickschnack. Nicht gut für unsere Jungs.«
Die Vorstellung, dass die Schwester mit »unsere Jungs« auch Papa gemeint haben könnte, fand Lilly ziemlich abwegig. »Aber mein Papa ist nicht so«, wehrte sie sich. »Und Onkel Jupp ist in Russland.«
»Lass mal«, sagte die Schwester, »mir brauchst du nichts zu erklären. Die Verhältnisse in deiner Familie sind kompliziert und unübersichtlich. Und ich bin allemal auf Seiten der Frauen.«
Irgendwie war das Gespräch falsch gelaufen. Lilly wusste nicht, wieso. Hatte die Schwester etwas gegen Papa? »Sie kennen meinen Vater doch gar nicht«, sagte sie.
Die Schwester zog die Augenbrauen hoch. »Dein Vater ist in Frankreich und kommt selten nach Haus. Ich hoffe, er tut da sein Bestes. So wie deine Mutter hier. Die ist zwar sehr zart und hat einen schwachen Kreislauf, aber sie ist keineswegs wehrzersetzend, sondern schwanger. Und während der Schwangerschaft verändert die Frau manchmal ihr Wesen, das liegt nicht am Charakter, sondern an der Biochemie.«
Mit offenem Mund starrte Lilly die Schwester an. »Was …?«
»Schwanger!«, donnerte die Schwester, als ob Lilly schwerhörig wäre. »Weißt du denn nicht, was das ist? Schwanger. Sie hat ein Baby im Bauch, trotz der komplizierten Verhältnisse in eurer Familie. Von jetzt ab wirst du dich intensiv um sie kümmern. Wir Frauen müssen zusammenhalten, vor allem, wenn der Feind nicht nur auf dem Feld der Ehre zu schlagen ist, sondern auch noch auf dem der Unehre.«
Lilly begriff immer weniger. »Welche Unehre und wessen Baby?«, stotterte sie.
»Das Baby deiner Mutter, verdammt noch mal!«
Lilly hatte noch nie eine Frau »verdammt noch mal« sagen hören. Die Schwester schien wirklich etwas verrückt zu sein. Und was sie jetzt hinzufügte, war noch verrückter: »Der Vater spielt dabei überhaupt keine Rolle. Jetzt, da die Männer so viel töten, müssen die Frauen umso mehr gebären. Und je weniger sie sich dabei auf ihre Männer verlassen, umso besser.«
»Aber mein Vater ist wirklich ein sehr guter und zuverlässiger Mensch«, sagte Lilly. »Das sagt auch meine Oma Elli. Und er hat noch nie jemanden getötet.«
»Genau«, sagte die Schwester, »ich hab’s kapiert. Für das Töten habt ihr Onkel Jupp, und dein Vater amüsiert sich in Frankreich. Und wenn deine Mutter auch zwei Männer hat, so muss sie ihr Baby trotzdem ganz allein austragen und zur Welt bringen. Und das wird nicht einfach sein. Hier …«, sie reichte Lilly die noch fast volle Tablettenflasche, »sorge dafür, dass sie täglich eine isst. Und dann gibt es ja auch Extralebensmittelmarken für Schwangere. Ich hoffe, ihr habt sie bereits angefordert.«
»Wann kommt denn …«, stotterte Lilly, »ich meine, wann soll es denn zur Welt kommen?«
»Soviel ich weiß, im November. Die schlechte Zeit ist vorüber, von nun an wird sie nicht mehr spucken und nicht mehr deprimiert sein. Dafür bist du mir verantwortlich!«
»Aber … weiß sie’s denn schon?«, fragte Lilly.
Die Schwester rollte die Augen gen Himmel. »Ich hab gedacht, du wärest ein kluges Mädchen.«
Auf dem Nachhauseweg jubelte Lilly. »Ich freu mich ja so! Wirklich, Mama, das ist das Beste, was mir seit Jahren passiert ist, vielleicht sogar das Allerbeste, seit ich auf der Welt bin!«
Mama warf ihrer Tochter, die ganz zapplig vor lauter Aufregung neben ihr herlief, einen erstaunten Blick zu. »Über was freust du dich denn so?«
»Über unser Baby natürlich.«
»Ach. Hat die Schwester es dir erzählt?«
Lilly nickte heftig. »Und sie hat auch gesagt, dass du dich jetzt nicht mehr übergeben musst und dass die Depression aufhört.«
»Hat sie gesagt, so so.« Mamas müde Stimme klang alles andere als begeistert. Sie sah aus, als ob sie bis oben hin angefüllt wäre mit Tränen.
O Gott, dachte Lilly, das Baby wird bei ihr ertrinken. »Hast du’s Papa schon geschrieben? Und Onkel Jupp?«, fragte sie.
Mama zuckte nur die Schultern.
So kam es, dass Lilly sich nun doch beteiligen und verantwortlich fühlen musste, allerdings nicht für Politik und die Kriegsauswirkungen und sonst welchen Erwachsenenkram, sondern für ein ungeborenes Baby und für dessen traurige Mutter, in der es heranwuchs. Deshalb tat sie, was immer sie konnte, um den gefährlichen Tränensee in ihrer Mutter auszutrocknen.