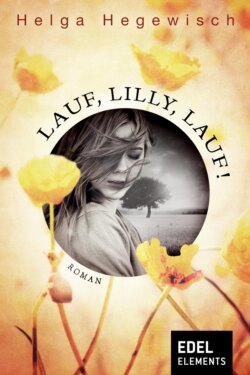Читать книгу Lauf, Lilly, lauf! - Helga Hegewisch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеDer Herbst kam spät und dauerte sehr lange in diesem Jahr. So hatten die beiden Mädchen Gelegenheit, sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten: eine weitere Pferdedecke und zwei verbeulte Stalllaternen, mehrere Kerzen, ein alter Flickenteppich aus dem Schloss und je ein geklauter dicker Pullover von Lillys und Isabellas Bruder. Dennoch machte Lilly sich Sorgen, weil es für den richtigen Winter nicht reichen würde.
»Überleg doch mal«, sagte sie zu Isa, »wohin wir umziehen könnten, wenn es hier zu kalt wird.«
»Bei mir zu Hause geht’s nicht und bei dir zu Hause will ich nicht«, sagte Isa.
»Na gut«, sagte Lilly, »und wie wär’s denn dann mit einer kleinen Geheimkammer im Schloss, nicht etwa bei euch hinten, sondern auf der Vorderseite, da sind doch mindestens fünfzig Räume?«
»Zu Zeiten meiner Urahnen hat es so etwas bestimmt gegeben«, meinte die Prinzessin, »Geheimkammern mit einem freundlichen Gespenst und unterirdische Gänge und verzauberte Prinzen und so weiter. Aber diese dämlichen Arbeitsmaiden haben alle Geheimnisse vertrieben. Übrigens sind das gar keine normalen Arbeitsmaiden, die haben irgendetwas mit dem Lebensborn zu tun.«
»Was ist der Lebensborn?«, fragte Lilly.
»Weiß ich nicht genau. Irgendetwas Unanständiges, glaube ich. Ich habe meine Mutter gefragt, die hat mir gesagt, sie hätte Wichtigeres zu tun, als über die Fortpflanzung germanischen Erbgutes nachzudenken. Und im Übrigen würde sie mir gewisse Dinge erst mitteilen, wenn ich fünfzehn Jahre alt wäre.«
»Das sagt meine auch immer. Also was ist mit dem Ausweichquartier? Soll ich mich nicht mal auf dem Gut umsehen? Vielleicht haben die noch eine alte Mägdekammer über den Stallungen, da oben ist es bestimmt schön warm.«
»Das Scheusal würde uns das nie erlauben«, sagte Isa.
»Der muss es ja nicht gleich merken.«
»Das Scheusal merkt alles. Der kann durch Wände sehen.«
»Na gut, dann frag ich ihn eben. Er ist immer sehr nett zu mir. Versuchen soll man’s doch wenigstens.«
Isa schüttelte energisch den Kopf. »Unmöglich. Er war nämlich vor ein paar Tagen bei uns. Und er hat meiner Mutter sogar Blumen gebracht!«
Lilly zog eine Grimasse. »Winterastern aus dem Inspektorsgarten? Was soll denn deine Mutter damit? Die passen doch gar nicht zu euren kostbaren Orchideen.«
»Es waren aber Rosen!«, trumpfte die Prinzessin auf. »Richtige echte Ladenrosen!«
»Teuer!«, meinte Lilly.
»Und weißt du auch, warum? Das Scheusal ist nämlich in meine Mutter verknallt. War er schon immer.«
»Was? Der ist doch ein alter Mann.«
»So alt nun auch wieder nicht. Deshalb hat er uns auch nach dem Ausbomben hierher geholt.«
Isabella sonnte sich in Lillys Verblüffung. »Und jetzt«, fuhr sie fort, »wo mein Vater schon eine Weile weg ist, da meint dieser Kerl, er könne sich alles leisten. Der Herr auf Staaken besucht die verlassene Schlossdame. Wie findest du das?«
Aber Lilly wollte plötzlich überhaupt nichts mehr finden und sie wollte auch nicht über das Scheusal reden und nicht über Isas Mutter und schon gar nicht über Isas Vater. Das alles erschien ihr schmerzhaft gefährlich. Am liebsten wäre sie wieder mal davongerannt und ins Wasser gesprungen, aber dafür war’s inzwischen wirklich zu kalt.
»Hast du eigentlich schon Mathe fertig?«, fragte sie. »Mir fehlt noch mindestens die Hälfte.«
Isa tat so, als hätte sie nicht gehört. »So richtig verwandt ist er ja auch nicht mit meiner Mutter«, sagte sie, »jedenfalls nicht blutsverwandt, bloß angeheiratet. Ungefähr so wie dein Onkel mit deiner Mutter.«
»Was hat denn meine Mutter damit zu tun?«, fuhr Lilly auf.
»Ich mein ja nur, weil dein Onkel doch auch in deine Mutter verknallt ist.«
»Ach, Blödsinn. Und Onkel Jupp gehört nun wirklich zur Familie, schon immer. Der sorgt für uns. Das ist doch etwas vollkommen anderes!«
Isa lachte. »Na klar, dass das etwas anderes ist. Weil nämlich dein Onkel euch ein Haus besorgt hat und mein Onkel uns eins weggenommen. Und weil deiner sogar bei euch wohnt, wenn er da ist, während meine Mutter das Scheusal rausgeschmissen hat, bevor er noch einen Fuß über die Schwelle setzen konnte. Und die Rosen hat sie ihm gleich hinterhergeworfen, eine nach der anderen. Die wunderbaren teuren Rosen landeten im Matsch. Hättest mal sein Gesicht sehen sollen, zu komisch!«
»Ja«, sagte Lilly und fühlte sich plötzlich traurig und unsicher, »ja, das war bestimmt sehr komisch.«
Isa begeisterte sich immer mehr an ihrer Schilderung. »Also, da stand er nun und machte ein dummes Gesicht und konnte es überhaupt nicht begreifen. ›Ach, Base Dorothee‹, hat er gejammert, ›ich wollte doch nur wieder in Kontakt mit dir kommen, wegen der unvergesslich schönen Zeiten, als wir beide jung waren!‹
›Für Kontakte hast du dich wohl in der Richtung geirrt‹, hat meine Mutter gerufen, ›Aktion Lebensborn ist auf der anderen Seite.‹ Und dann hat sie ihm unsere Tür vor der Nase zugeschlagen.«
Lilly zog den Reißverschluss ihres Anoraks hoch und machte sich energisch auf den Heimweg. »Ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Mama hatte schon wieder Migräne heute Morgen.«
Isa lief hinter ihr her. »Nun sei doch nicht beleidigt.«
»Bin ich überhaupt nicht. Wieso auch. Ich hab bloß keine Zeit mehr.«
»Es war doch nur, damit du begreifst, warum uns der Freusaal auf gar keinen Fall eine Kammer zur Verfügung stellen würde.«
»Ist schon klar, ich hab’s begriffen«, sagte Lilly. Und danach sagte sie eine ganze Weile überhaupt nichts mehr. Das Herz war ihr schwer.
Schließlich legte Isa ihr den Arm um die Schulter. »Entschuldige«, sagte sie leise, »tut mir Leid.«
»Ach, lass doch«, sagte Lilly.
»Wir müssen ganz einfach versuchen, unsere Eltern nicht mehr ernst zu nehmen«, beschloss Isabella, »wir verstehen sie ja sowieso nicht.«
»Was gibt’s denn an deiner Mutter zu verstehen?«, fragte Lilly. »Die kann den Freusaal eben nicht leiden, da hat sie ihn rausgeschmissen. Und was wäre, wenn sie ihn stattdessen sehr gut leiden könnte?«
»Kann sie aber nicht«, sagte Isa hochmütig, »meine Mutter ist eben nicht so.«
Plötzlich wurde Lilly wütend. »Ach, lass mich doch bloß mit deiner fabelhaften Mutter in Ruh und auch mit deiner übrigen Familie. Ist ja möglich, dass deine Mutter prima mit Rosen schmeißen kann, während meine immer bloß Migräne hat. Aber eins steht ja wohl fest: Mein Vater und mein Onkel kämpfen für Deutschland, während dein Onkel ein Drückeberger ist und dein Vater ein Wehrzersetzer. Ich kann das alles nicht mehr hören!«
Isa zuckte zurück und Lilly spürte nahezu körperlich, wie hart sie ihre Freundin getroffen hatte.
»Wie du willst«, sagte Isa und verfiel nun ihrerseits in Schweigen.
Ohne ein weiteres Wort gewechselt zu haben, trennten sich die beiden Mädchen an der Galitzer Landstraße und radelten in entgegengesetzten Richtungen davon.
Lilly war sehr traurig und wollte dringend eine Weile allein sein, um über den Anlass ihrer Trauer nachzudenken. So umrundete sie die Gutsgebäude, fuhr an den Polenquartieren und den Tagelöhnerwohnungen vorbei, bis sie zu dem etwas abseits liegenden kleinen Kaminskihaus kam. Dort gab es eine offene Gartenlaube mit einer Bank, auf der nie jemand saß.
Lilly hockte sich hin, zog die Knie gegen ihr Gesicht und fing sofort an zu weinen. Das fand sie selbst etwas übertrieben, aber sie konnte nichts dagegen tun. Mama, Papa, Onkel Jupp – das war ihre engste Familie, die sie als vollkommen normal ansah. Wenn andere Leute darin unbedingt etwas Merkwürdiges sehen wollten, bitte sehr, Lilly wusste es besser. Aber Isa, ihre liebste, einzige Freundin, wieso musste die nur immer wieder darauf herumhacken?
Lillys Tränen flossen und sie gab ein paar laute Schluchzer von sich. Sie war so sehr eingewickelt in ihr Selbstmitleid, dass sie das Herannahen von Jule Kaminski überhörte und heftig zusammenzuckte, als diese plötzlich vor ihr stand.
»Na, was soll denn das werden«, brummelte Jule, »sitzt hier und heult wie ’n Schlosshund. Wüsst ich ja schon mal gern, was so was wie du denn zu heulen hat. In meiner Gartenlaube.«
Lilly rutschte von der Bank und räusperte sich. »Entschuldige, ich geh ja schon.«
»Von mir aus kannste bleiben. Was rauswill, muss raus. Ich würd dir auch ’n Glas Wasser bringen, dann fließen die Tränen besser.«
»Nein, nein, nicht nötig, vielen Dank!«, sagte Lilly schnell und verließ fluchtartig die Gartenlaube.
»Kannst hier heulen, wann immer du willst«, rief Jule hinter ihr her, »ich stör dich auch nicht.«
Lilly sprang auf ihr Rad und fuhr davon, so schnell sie konnte.
Jule Kaminski wurde auf dem Gut allgemein die Trauerjule genannt. Ihre Mutter und ihre zweijährige Tochter waren kurz hintereinander an Scharlach gestorben, ein halbes Jahr später ertrank ihr sechsjähriger Sohn Manfred im Schlossteich, der zum Ertrinken eigentlich viel zu flach war, und kurz darauf fiel auch noch ihr Mann, der Melker Heinrich Kaminski, Gefreiter bei der Infanterie. Sein Grab, wenn er überhaupt eins gekriegt hatte, lag irgendwo in Frankreich. Seitdem war Jule etwas merkwürdig geworden, hieß es. Obgleich sie höchstens sechsundzwanzig oder siebenundzwanzig Jahre alt sein konnte, wirkte sie wie eine alte Frau. Sie ging mit schwerfälligen Schlürfschritten und hielt den Kopf gesenkt, als wollte sie alle Blicke auf ihr Gesicht abwehren. Im Sommer wie im Winter hüllte sie sich in dicke schwarze Tücher und redete auch kaum noch, es sei denn über Trauer und Tränen und über den Jammer der Welt.
Was war Lillys kleiner Kummer gegen die Lawine von Unglück, die über Jule hereingebrochen war? Lilly schämte sich. Die Sache mit Isabella würde schon wieder in Ordnung kommen. Am liebsten wäre sie jetzt schnurstracks zum Schloss geradelt, aber das hätte nichts genützt, weil Isa ihr nach wie vor den Zutritt zu ihrem anderen Leben verweigerte.
Als Lilly nach Hause kam, traf sie in der Küche auf Oma Elli. Die hatte hochrote Wangen und knetete einen leeren Kaffeepott mit beiden Händen, als wäre er ein Kuheuter. Sie warf Lilly einen ungewohnt bösen Blick zu. »Bist du tatsächlich auch schon da«, sagte sie.
»Wo ist Mama?«, fragte Lilly.
»Na, wo wohl?«
Lilly kriegte es mit der Angst zu tun. »Kann ich doch nicht wissen«, antwortete sie so forsch wie möglich.
»Eben, kannst du nicht wissen, bist ja auch nie zu Hause.«
Lilly bemerkte auf dem Küchentisch neben der Untertasse ein kleines Glas, in dem ein Rest bräunlicher Flüssigkeit stand. Und dann konnte sie es auch riechen, etwas streng Alkoholisches. Sie ließ sich auf den zweiten Küchenstuhl fallen. »Also was ist los?«
»Vor einer halben Stunde hat die Ambulanz deine Mutter abgeholt.«
»O Gott … etwa das Baby?«
»Was denn sonst.«
»Aber es ist doch noch viel zu früh!«
»Eben. Drei Wochen zu früh. Aber wenn Frauen sich aufregen …«
Lillys Herz begann wild zu schlagen. »Worüber hat sie sich denn aufgeregt?«
»Ein Brief. Etwas Militärisches.«
Lilly hatte Mühe, nicht laut loszuschreien. Ein militärischer Brief, das konnte nur Unglück bedeuten, Papa oder Onkel Jupp, einer von beiden war gefallen.
»Wer …?«, flüsterte Lilly.
»Dein Vater«, antwortete Oma Elli.
»O nein, o bitte, bitte nicht …«
»Ist aber doch so.«
»Aber Papa war immer so vorsichtig. Der ist … ich meine, der hat sich doch nie in Gefahr gebracht. Das hast du gesagt und Mama auch. Einer, der nur Straßen baut, nicht einer, der schießt …«
»Wenn er selbst nicht auf andere schießt, heißt das ja noch lange nicht, dass die anderen nicht auf ihn schießen.«
Lillys Kehle brannte, aber es kamen keine Tränen, die hatte sie alle zuvor auf Jule Kaminskis Laubenbank verschwendet. »Ich glaub’s nicht«, stöhnte sie, »mein Papa kann nicht tot sein.«
Oma Elli stieß ihren Stuhl zurück, ging zum Küchenschrank, in dem die Flasche mit dem braunen Schnaps stand, und goss sich ein weiteres Glas ein.
»Nun übertreib mal nicht«, sagte sie. »Tot muss er ja nicht gleich sein. Immerhin gibt’s noch Hoffnung. Also, wenn man’s positiv nehmen will, dann ist er vielleicht noch am Leben. Nicht tot, sondern in Gefangenschaft.«
»Wieso?«, flüsterte Lilly. »Wer sagt das?«
»Keiner. Oder eigentlich doch. Sie haben nämlich keine Leiche oder so etwas, dein Vater ist nur vermisst, so nennen sie das. Irgendwie verschwunden oder abhanden gekommen. In der Wüste vor El Alamein.«
»Steht das in dem Brief?«
»So ungefähr.«
Lilly seufzte. »Na dann …! Ich hab ja gleich gewusst, dass er nicht tot ist. Mein Papa bestimmt nicht.«
»Nun sei dir mal nicht so sicher.«
»Ich dachte, wir wollen es positiv sehen.«
»Wollen wir auch. Aber da war noch ein Brief, von einem Kameraden. Und der schreibt …«
»Kann ich die Briefe sehen?«, unterbrach Lilly.
»Kannst du nicht. Deine Mutter hat sie mitgenommen.«
Mama! Momentan hatte Lilly vollkommen ihre Mutter vergessen. Aber jetzt kam die Sorge mit aller Macht zurück. Lilly sprang auf und stürmte zur Tür.
»Wohin willst du denn jetzt noch, es ist Abend!«, rief Oma Elli hinter ihr her.
»Ins Krankenhaus, wohin denn sonst.«
»So schnell geht das nicht mit der Geburt. Kannst getrost bis morgen früh warten.«
»Kann ich nicht«, schrie Lilly und schlug die Haustür hinter sich zu. Sie radelte durch den Wald, als ob der Teufel hinter ihr her wäre.
Als sie im Krankenhaus ankam, hatte man Mama schon ins Gebärzimmer gebracht, Kreißsaal nannten sie das.
»Ich muss sie sehen!«, rief Lilly.
»Ausgeschlossen. Kinder dürfen nicht in den Kreißsaal.«
»Ich bin doch schon fünfzehn«, log Lilly.
»Immer noch zu jung. Setz dich hin und warte. Und mach dir keine Sorgen. Sie ist schon tüchtig bei der Arbeit.«
»Wieso Arbeit?«
»Kinderkriegen ist Schwerstarbeit, das kannst du dir merken für später.« Und damit lief die Schwester davon.
Lilly wartete.
Eine Stunde, zwei, drei Stunden.
Endlich, nach mehr als vier Stunden, öffneten sich die weiß lackierten Flügeltüren, auf die Lilly die meiste Zeit gestarrt hatte. Jetzt kommt eine Schwester und zeigt mir das Baby, dachte sie, aber so war es leider nicht. Ein Krankenbett wurde im Eiltempo herausgefahren, vorne eine Schwester, hinten auch eine, und auf dem Bett dazwischen lag Mama. Ihre Augen waren geschlossen, dicke Schweißtropfen standen ihr auf der Stirn und das Gesicht sah fleckig aus. Sie stöhnte.
Lilly versuchte, das Gerenne aufzuhalten. »Was ist denn«, schrie sie, »wohin bringen Sie meine Mutter, wo ist das Baby?«
»Geh aus dem Weg, Kleine«, rief die vordere Schwester, »du siehst doch, dass wir in Eile sind.« Und die hintere Schwester fügte hinzu: »Kaiserschnitt.«
Lilly lief neben dem Bett her und griff nach Mamas Hand. »Ich bin hier, Mama, ich warte.«
Ganz kurz öffnete Mama die Augen und sah Lilly an. »Ist gut«, sagte sie.
Als das Rollbett hinter der nächsten Tür verschwunden war und Lilly wieder auf ihrem Wartestuhl saß, brodelte die Angst hoch wie Wasser, in das man Brausepulver geschüttet hatte, doch seltsamerweise fiel sie dann schnell wieder in sich zusammen. Seufzend lehnte Lilly sich zurück und als die Schwester dann tatsächlich kam, genau wie im Kino, mit einem Bündel im Arm und einem so stolzen Gesicht, als hätte sie es selbst geboren, da musste sie Lilly kräftig am Arm rütteln, um sie aufzuwecken.
Kaum hatte Lilly ihr Baby erblickt, da kamen ihr auch schon die Tränen. Dabei hatte sie doch immer gedacht, Freudentränen gäbe es nur in Büchern. »Mein Baby«, schluchzte sie, »ganz allein meins.«
»Na na«, sagte die Schwester, »einen kleinen Anteil wirst du deiner Mutter doch auch zubilligen.«
Während der kommenden Tage blieb Lilly im Krankenhaus bei Mama und dem Baby. In der Geburtsnacht hatte man sie nicht nach Hause radeln lassen wollen und ihr ein Bett in ein Nebenzimmer geschoben. Und danach schien man ihre Anwesenheit ganz einfach zu akzeptieren. So bestand auch niemand darauf, dass sie zur Schule ging. Im Krankenhaus gab es zu wenig Schwestern, weil jede irgend verfügbare Hand in den Frontlazaretten gebraucht wurde. Deshalb wurde Lillys Hilfe gern angenommen.
Gleich am ersten Morgen nach der Geburt, noch etwas benommen von der kurzen Nacht, hatte Lilly zu Haus bei Oma Elli angerufen.
»Was ist es denn?«, hatte Oma Elli gefragt.
»Ein Mädchen natürlich, ist doch klar«, hatte Lilly geantwortet, aber dann war ihr eingefallen, dass sie es noch gar nicht wirklich wusste.
Als Lilly dann zum ersten Mal beim Windeln zuschaute, war nicht zu übersehen, dass es sich hier um ein zweifelsfrei männliches Baby handelte. Ihre anfängliche Verwirrung legte sich schnell. Also gut, ein Junge, kann man nichts machen. Hauptsache klein und mein. Da muss ich mir eben besondere Mühe bei seiner Erziehung geben, um ihn nicht werden zu lassen wie all die anderen Brüder, die man so kennt, und vor allem nicht wie Joachim.
»Wie soll er denn heißen?«, fragte Schwester Cäcilia. Bevor Mama, die noch sehr schwach und müde war, antworten konnte, sagte Lilly schnell: »Er heißt Felix. Das bedeutet der Glückliche.«
Am dritten Tag nach der Geburt bat Lilly ihre Mutter: »Darf ich jetzt bitte den militärischen Brief lesen und auch den anderen, den von Papas Freund?«
Zum ersten Mal seit Felix’ Geburt machte Mama wieder ängstliche Augen. »Ach, die Briefe, ja, natürlich, die darfst du lesen. Wo sind sie denn nur, im Krankenwagen hatte ich sie noch in der Hand, die müssen irgendwo hier sein. Frag die Schwester.«
Aber Schwester Cäcilia war nicht sehr hilfreich und auch die anderen Schwestern erinnerten sich nicht an irgendwelche Briefe. Lilly rannte im Krankenhaus umher, fragte überall nach, in der Entbindungsstation und bei den Fahrern der Krankenwagen und im Verwaltungsbüro. Die Briefe waren unauffindbar.
Am Morgen des sechsten Tages nach der Geburt wurden die Fäden aus Mamas Bauchschnitt gezogen und am Nachmittag verließ die Familie Steinhöfer trotz ärztlichen Protestes das Krankenhaus. Mama war zwar noch schwach, doch Lilly fühlte sich stark für drei. Sie trug das Baby und notfalls hätte sie auch Mama getragen, aber die konnte schon ganz gut alleine gehen.
Ach, und zu Haus war es wunderbar! Überall Blumen und der Duft nach frisch gebackenem Kuchen und Stapel von Windeln und Hemdchen und dazu zwei Dosen allerbeste Kunstmilch, von Oma Elli auf Lillys telefonische Bitte hin besorgt. Die Polinnen, Magda und Danuta, streckten beide gleichzeitig ihre sauber geschrubbten Hände nach dem Baby aus und Lilly erlaubte großzügig, dass jede es zwei Minuten lang halten durfte.
Aber das Schönste war eine kurze Mitteilung von Oma Elli, die Lilly hoffnungsfroher machte als die großartigste Sondermeldung im Wehrmachtsbericht. »Da ist schon zweimal ein Mädchen hier gewesen und hat nach dir gefragt«, sagte Oma Elli, »blonde Kringellocken und ein komisches altmodisches Kleid. Sehr nett, sehr höflich. Hat gesagt, sie kennt dich von der Schule.«
»Isabella!«, flüsterte Lilly.
»Was hat die denn hier zu suchen«, muffte Joachim.
»Kann sein, dass sie so hieß«, überlegte Oma Elli. »Isabella, der Name würde passen. Ich hab gesagt, dass ihr heute zurück seid, und sie hat gesagt, dass sie dann einen Besuch machen würde, um sich das Baby anzuschauen. Wirklich, ein sehr wohlerzogenes Mädchen und so hübsch.«
»Die hat kein Recht hier zu sein!«, schimpfte Joachim.
»Wart’s ab, junger Mann«, lachte Oma Elli, »in ein, zwei Jahren wirst du manches geben für das Recht, hinter ihr her sein zu dürfen! Ich würde dir raten, dich beizeiten vorzubereiten.«
Und tatsächlich kam Isabella. Sie hielt in der Hand eine einzelne Blumenladenrose und machte ihr allerhochmütigstes Prinzessinnengesicht. »Ich wollte nur gratulieren«, sagte sie zu Lilly, die ihr die Tür geöffnet hatte.
Lilly zog sie ins Wohnzimmer, nahm das Baby aus dem Körbchen und legte es Isa in die Arme.
»Das ist ja absolut total wunderbar«, flüsterte Isa.
»Und du wirst Patentante«, antwortete Lilly.
Von da an wurde die Freundschaft zwischen den beiden Mädchen nicht nur immer enger, sondern auch ruhiger und sicherer. Sie würden es schon schaffen, trotz aller äußeren Schwierigkeiten. Lilly rechnete es Isa hoch an, dass sie den Weg in das Haus, das zuvor das ihre gewesen war, gefunden hatte.
Auf Isas Besuch folgte Lillys Gegenbesuch in den Hinterzimmern des Schlosses. Ganz so schlimm, wie Lilly es befürchtet hatte, war es zwar nicht, aber der Mangel an seidenen Portieren und Vasen voller Orchideen war doch sehr offensichtlich. Isas Mutter sah fast genauso aus wie die Tochter, der Altersunterschied wurde einzig um die Augen herum sichtbar. Sie machte auf Lilly den Eindruck, dass die Trauer sie eingeschlossen hatte in einen festen Panzer, der ihre angeborene Fröhlichkeit streng unter Kontrolle hielt. Eine Person, die statt des Gelächters, dem sie sich so gerne hingegeben hätte, immerfort zu Tränen gezwungen wurde.
Drei Wochen nach der Geburt, es war inzwischen Mitte November, kam Onkel Jupp. Lilly erschrak bei seinem Anblick. Die Haut war grau, die Augen entzündet und er ging gebeugt, als wäre er ein alter Mann. Er lachte kaum noch. Ein paar Mal beobachtete Lilly, wie er irgendwo saß oder stand und vor sich hin starrte, als könne er sich von einem bestimmten Anblick nicht lösen. Nur wenn er den kleinen Felix im Arm hielt, ging ein Leuchten über sein Gesicht, das an den alten Onkel Jupp erinnerte. »Also geht das Leben doch weiter«, murmelte er, »verdient haben wir’s nicht.«
Bei Onkel Jupps früheren Besuchen war es immer laut und fröhlich im Haus zugegangen. Jetzt wurde es still, als ob ein Kranker gekommen wäre, den man nicht stören durfte.
Oma Elli, die den braunen Kräuterschnaps aus der Galitzer Brennerei inzwischen zu ihrem ständigen Gefährten gemacht hatte, schenkte immer wieder Onkel Jupps Glas voll, und der trank, meist ohne hinzuschauen. Wenn er genug getrunken hatte, legte er sich schlafen, oben in Lillys Zimmer, die seinetwegen umgezogen war auf die Wohnzimmercouch.
Mama tat alles, um ihn aufzuheitern. Tapfer bemühte sie sich, Frohsinn zu verbreiten, und sie weinte erst wieder, als er gegangen war. »Wir werden ihn nicht wieder sehen«, schluchzte sie.
»Sag bloß nicht solche schrecklichen Sachen, Mama«, rief Lilly verwirrt, »Onkel Jupp, der schafft es, der hat’s immer geschafft.«
Aber im Grunde glaubte sie selbst kaum noch daran.
Lilly hatte Isa nicht erzählt, dass ihr Vater in Afrika vermisst war, sondern sich auf eine kurze Bemerkung beschränkt: »Mein Vater kommt so bald nicht wieder.« Und Isa hatte nicht weiter nachgefragt. Nachdem Onkel Jupp abgefahren war, konnte Lilly jedoch nicht anders, sie musste versuchen, ihre Sorgen mit Isa zu teilen.
Diese hörte ruhig zu und sagte dann: »Zurück nach Russland, Stalingrad? Das muss entsetzlich sein, die wahre Hölle. Ich kann nicht verstehen, wieso er wieder dorthin gegangen ist.«
»Was hätte er denn sonst machen sollen?«
»Untergrund!«, sagte Isa. »So was gibt’s.«
»Das wäre ja Fahnenflucht«, sagte Lilly entsetzt. Schon das Wort allein bereitete ihr Übelkeit.
»Fahnenflucht, ja«, meinte Isa. »Wenn nämlich alle Soldaten das tun würden, dann wäre der Krieg morgen zu Ende. Aber sie tun’s ja nicht. Sie gehen stattdessen freiwillig zurück in die Hölle. Mein Vater sitzt ja auch in der Hölle. Aber bei ihm ist es alles noch viel schlimmer.«
»Wieso?«
»Weil dein Onkel es so gewollt hat, er ist selber mit schuld. Und weil mein Vater es nie so gewollt hat.«
Fast hätte Lilly geantwortet: Aber schuld an seinem Elend ist er doch, sogar noch viel mehr als Onkel Jupp, denn dein Vater hätte sich ja bloß zusammennehmen und seine verrückte Wut runterschlucken müssen, dann wäre ihm nichts geschehend Aber Lilly hielt sich zurück, sie war vorsichtig geworden, und ihr anschließendes Schweigen war kein beleidigtes, sondern ein sehr nachdenkliches. Wenn alle Soldaten Fahnenflucht begingen, überlegte sie, wäre das dann kein Verbrechen mehr?
Im Spätherbst neunzehnhundertzweiundvierzig war Lilly dreizehn Jahre alt geworden. Isa hatte für sie aus dünnem Zigarrenkistenholz ein Geschenk gebastelt, eine winzig kleine, haargenaue Nachbildung der Hütte. »Für die Zeit, wenn wir sie nicht mehr benutzen können«, sagte sie, was leider nicht über die Tatsache hinwegtäuschte, dass ihnen immer noch ein Winterraum fehlte.
»Was soll denn das sein?«, erkundigte sich Joachim.
»Ein Spartopf, was denn sonst«, antwortete Lilly schnell.
»Und auf was sparst du?«
»Mein ganz spezielles Geheimnis«, sagte Lilly, »und du bist der Letzte, dem ich’s erzählen werde.«
»Mädchen sind wirklich beknackt«, seufzte Joachim.
Im Dezember dann, gerade als die Temperatur unter den Gefrierpunkt rutschte, fand sich für das Raumproblem eine überraschende, höchst zufrieden stellende Lösung.
Wenn Lilly und Isa eine Weile ungestört sein wollten, dann gingen sie spazieren und schoben den Kinderwagen mit dem meist schlafenden Felix kreuz und quer in der Gegend herum. Bei einem dieser nicht sehr gemütlichen Spaziergänge, gerade als Felix aus unerfindlichen Gründen zu schreien begonnen hatte, begegnete ihnen die Trauerjule.
»Na, was haben wir denn da«, brummte Jule in ganz ähnlichem Tonfall wie bei der ersten Begegnung in der Laube, »fahren die zwei Mädchen das Kleine durch die Eiseskälte und lassen es einfach schreien. Wüsst ich schon mal gern, was die sich dabei denken.«
»Gar nichts«, sagte Lilly, »wahrscheinlich hat er sich bloß voll gemacht.«
»Und wenn’s was anderes wär, wenn das Kleine gar krank sein möchte?«
»Ist es aber nicht, da kann ich dich beruhigen. Unser Felix ist kerngesund.«
»Felix heißt er, so so«, sagte Jule und schlug die Hände vors Gesicht, weil ihr die Tränen kamen. »Meiner hieß ja Manfred und geheult hat er nie. Sechs Jahre lang keine Träne, und dann ist er ertrunken. Kann ich eures mal sehen?«
Sehnsüchtig beugte sie sich über den Wagen, aber Felix war so warm verpackt, dass von ihm überhaupt nichts zu sehen war. »Wüsst ich schon mal gern, ob ihr nicht mitkommen mögt«, bat Jule, »zu mir in die Stube. Ist auch schön warm da, könnt ihn auspacken und putzen.«
So landeten die Mädchen mitsamt dem schreienden Felix in Jules warmer Stube. Während Lilly das Baby von seiner Winterkleidung befreite, wickelte auch Jule sich aus ihren Tüchern und die beiden Mädchen waren erstaunt, dass darunter eine ganz normal wirkende junge Person zum Vorschein kam, gekleidet in ein dickes, handgestricktes Wollkleid, das mit einem braven weißen Krägelchen geschmückt war.
»Wüsst ich schon mal gern, warum du so guckst«, sagte Jule.
»Weil ich … also irgendwie dacht ich, du bist alt und dick«, platzte Lilly heraus.
»Kann ich doch nicht alt sein. Geheiratet hab ich mit achtzehn, Manfred mit neunzehn, Klein-Irma mit dreiundzwanzig, Witwe mit sechsundzwanzig.«
»O Gott«, seufzte Lilly.
»Sag ich auch immer. O Gott, wie hab ich das bloß verdient.« Und schon flossen wieder die Tränen.
»Halt doch mal den Felix«, sagte Lilly tröstend, »im Kinderwagen hab ich ’ne frische Windel.«
Ein Strahlen ging über Jules Gesicht, als sie Felix in Empfang nahm. »Ist seit Klein-Irma nicht mehr passiert«, flüsterte sie, »kein einziges Baby im Arm.«
Isa mischte sich ein. »Wieso denn das?«, fragte sie. »Soviel ich weiß, gibt es hier in Staaken noch drei oder vier kleine Kinder und mindestens ebenso viele im Polenquartier.«
»Lassen mich nicht ran«, sagte Jule, »weil ich doch Unglück bring.«
Lilly breitete die Babydecke über den hölzernen Esstisch und legte die Windel bereit. »Na, dann wollen wir mal«, sagte sie großzügig. Ein ganz klein wenig unsicher fühlte sie sich nun doch nach Jules Bemerkung über das Unglück. Angeblich gab’s das ja wirklich, diese Leute, die das Unglück anzogen. Ganz nahe blieb sie bei Jule stehen und beobachtete mit Argusaugen deren Handhabungen.
»Ich hol mal etwas Wasser«, sagte Isabella, »wo ist denn die Küche?«
»Gleich links. Warmwasser steht auf’m Ofen.«
Felix hatte zu schreien aufgehört und betrachtete mit seinen dunklen Augen, die noch keine richtige Farbe hatten, den Kopf der fremden Frau über sich.
»Hat sich wirklich voll gemacht«, murmelte Jule, »tut weh, macht wund.« Und dann an Lilly gerichtet, in vorwurfsvollem Ton: »Hast du aber nicht gut aufgepasst!«
»Das tut ihm wirklich nichts«, verteidigte sich Lilly, »ich hab zu Hause eine Salbe.«
»Hat aber geweint!«, beschwerte sich Jule.
»Weinen ist gut für die Lunge, hat Schwester Cäcilia gesagt.«
»Und das glaubst du?«
»Eigentlich nicht«, gab Lilly zu.
»Weinen ist für überhaupt nichts gut«, sagte Jule und ließ ihre Tränen auf Felix’ nacktes Bäuchlein tropfen.
»Dann hör doch endlich auf damit«, meinte Lilly besorgt.
»Hast du wirklich Recht!«, sagte Jule, zog ein Taschentuch aus ihrem Ärmel und wischte sich energisch die Augen. Isabella kam mit einer Schüssel voll Wasser aus der Küche. Sie zwinkerte Lilly bedeutungsvoll zu und rollte die Augen. Anscheinend hatte sie etwas entdeckt. »Wohnst du ganz alleine hier?«, fragte sie, als sie die Schüssel auf den Tisch setzte.
»Wer will schon bei mir wohnen?«, sagte Jule.
»Wir!«, sagte Isa. »Lilly und ich.«
Jule schüttelte verständnislos den Kopf. »Habt ihr doch euer eigenes.«
»Stimmt«, sagte Isa, »aber es gefällt uns hier besser, verstehst du?«
Jule zog Felix das Strampelhöschen an und knöpfte es auf der Schulter sorgsam zusammen. Dann beugte sie sich über den Kleinen und kitzelte ihn am Hals. »Die Mädchen sind nämlich verrückt«, sagte sie und kitzelte Felix wieder und brachte ihn tatsächlich zum Lachen. »Haben alles und wollen dies hier.«
»Wir zahlen dir auch Miete!«, sagte Isabella. »Fünfzehn Pfennig die Woche, das ist die Hälfte von unserem Taschengeld.«
»Nee«, sagte Jule, »so nu doch nicht.«
»Aber warum denn nicht?«, fragte Isa enttäuscht. »Wir wollen ja auch nicht nachts hier bleiben, nur ein paar Stunden am Nachmittag. Und du hast doch genügend Platz, benutzt das Hinterzimmer ja gar nicht.«
Jule warf Isa einen schrägen Blick zu. »Hast spioniert, was?«
»Brauchte ich gar nicht«, verteidigte sich Isa, »die Tür stand offen.«
Lilly wurde die Sache langsam unangenehm. Sie griff nach Felix und nahm ihn auf den Arm. »War nicht so wichtig, Jule. Vielen Dank, dass wir reinkommen durften. Jetzt müssen wir nämlich gehen.«
Hilflos ließ Jule die Arme hängen. Schon wieder liefen ihr die Tränen übers Gesicht. »Hab ich doch gar nicht so gemeint«, sagte sie, »will ich doch bloß kein Geld nicht. Nur das Baby, das sollt ihr mir manchmal bringen, könnt dann bleiben, so lange ihr wollt.«
Isa sprang herzu und ergriff Jules Hand, um sie kräftig zu schütteln. »Abgemacht, Jule, abgemacht. Wir kriegen das Zimmer und du darfst manchmal den Felix wickeln. Dann haben wir alle, was wir brauchen.«
Später, als die beiden Mädchen den Kinderwagen zurück nach Hause schoben, sagte Lilly: »Irgendwie hab ich das Gefühl, als hätte ich grad mein Baby verkauft.«
»Du bist wirklich nicht zu retten«, lachte Isa, »wir haben ihr eine Freude gemacht, das ist alles.«
»Aber ohne das Baby hätte sie uns das Zimmer nicht gegeben«, sagte Lilly.
»Na und? Ohne das Baby hätten wir ihr auch keine Freude machen können.«
»Und wenn’s nun doch ein Unglückshaus ist?«, fragte Lilly besorgt.