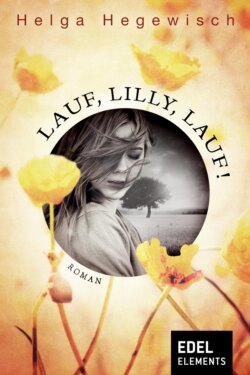Читать книгу Lauf, Lilly, lauf! - Helga Hegewisch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеVier Wochen nach dem ersten Arztbesuch kam Papa auf Besuch, ernst und streng wie immer. Und sehr traurig. Mama weinte und versteckte sich und verriegelte ihre Schlafzimmertür. Papa schlief im Gästezimmer.
Lilly hatte ihren Vater plötzlich so lieb, dass es ihr unter den Rippen brannte. »Als Onkel Jupp hier war, hat sie sich auch immer versteckt«, log Lilly. »Sie glaubt, dass ihr Männer schuld seid am Krieg. Und die Krankenschwester hat gesagt, dass Frauen sich während der Schwangerschaft oft verändern. Das liegt dann nicht am Charakter, sondern an der Biologie.«
Papa nickte. »Jaja, die Biologie.« Das klang fast so traurig, als ob Mama es gesagt hätte.
»Und ich freu mich nämlich schrecklich auf das Baby«, trumpfte Lilly auf.
Papa nahm Lillys Kopf in beide Hände und küsste sie auf die Stirn. »Zwischen Freud und Leid ist die Brücke nicht breit. Einer muss sich ja freuen. Und du bist stark, du wirst es schon schaffen.«
Beim Abschied küsste er auch Mama auf die Stirn, mit der gleichen Geste. Ganz so, als ob Mama und Lilly beide Papas Töchter wären.
Im Juli kam dann auch Onkel Jupp. Er sah sehr verändert aus, mit eingefallenen Wangen und mit einer Haut so zerfurcht, als wäre er mindestens sechzig Jahre alt. Zwar lachte er immer noch, sogar lauter als früher, aber seine Augen lachten nicht mit. Als Mama ihn begrüßte, fiel sie ihm weder um den Hals, noch strahlte sie ihn an. Sie sagte nur: »O Gott, was haben sie mit dir gemacht!«
In der darauf folgenden Nacht startete die englische Luftwaffe einen ersten Großangriff auf Lillys Heimatstadt.
Da Joachim sich mit seinem Fähnlein, dessen Führer er inzwischen war, im Ernteeinsatz befand und Oma Elli zu Frau Gössel nach Lesitz gefahren war, saßen sie nur zu dritt in der für die Familie Steinhöfer reservierten Ecke im Luftschutzkeller, als um sie herum das Chaos ausbrach. Draußen knallte und krachte und heulte es und hier drinnen schrien die Menschen vor Angst, einige stöhnten oder röhrten wie Tiere, und andere starrten in todesähnlichem Schweigen vor sich hin.
Lilly konzentrierte ihren ganzen Überlebenswillen auf das Baby, und das half ihr, einigermaßen ruhig zu bleiben und nicht ähnlich durchzudrehen wie die Frau Neuhauser aus dem zweiten Stock, die immer nur »Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben« schrie. Als die dicken Stützbalken unter der Decke zu ächzen und zu splittern begannen, warf sich Lilly quer über Mamas Schoß, um mit ihrem Körper das Baby zu schützen. Mama selbst gab keinen Ton von sich. Onkel Jupp hielt sie umfangen und hatte die freie Hand über ihre Augen gelegt.
Es dauerte nicht viel länger als eine halbe Stunde und das Haus blieb stehen. Als es still wurde und Lilly aufstehen wollte, gaben ihre Beine plötzlich unter ihr nach und sie rutschte auf den Boden.
Onkel Jupp zog sie hoch und sagte: »Was soll denn das, Blümchen, jetzt, wo’s vorbei ist.«
Sie stolperten die Kellertreppe hinauf zur Straße. Viele Häuser waren eingestürzt, andere brannten lichterloh, und der Gestank, der ihnen entgegenschlug, nahm ihnen fast den Atem. Mama, ihren Bauch weit vorgestreckt, hing wie leblos in Onkel Jupps Armen.
»Es stinkt nach verbrannten Menschen«, sagte Frau Neuhauser.
Onkel Jupp fuhr sie an: »Sie halten jetzt besser Ihren Mund, gute Frau. Es reicht schon, dass Sie uns unten im Keller mit Ihrem Geschrei auf die Nerven gegangen sind.«
»Und die da«, keifte Frau Neuhauser, die sonst doch immer vernünftig und nett war, »geht die einem etwa nicht auf die Nerven mit ihrem ewigen Ohnmachtsgetue?«
Da nahm Onkel Jupp Mama auf die Arme und trug sie nach oben in die Wohnung, wo alle Fensterscheiben zerbrochen waren und die Möbel kreuz und quer herumlagen, als hätte ein Riesenkind beim Spielen einen Wutanfall gekriegt.
Lilly hockte sich neben die umgekippte Vitrine, mitten zwischen die Scherben, und begann die wenigen heilen Kristallgläser aus den zerbrochenen herauszuklauben.
»Lass das jetzt«, sagte Onkel Jupp, »wir müssen erst einmal Mama ins Bett bringen.«
»Das kann ich allein«, sagte Mama.
»Aber ich helf dir dabei«, sagte Lilly.
Sie schüttelte die Scherben von Mamas Bett und breitete ein neues Tuch darüber.
Als Mama lag, lächelte sie sogar ein wenig. »Jetzt geht es mir besser«, sagte sie, »tut mir Leid wegen dem Ohnmachtsgetue.«
»Die Frau Neuhauser ist eine blöde Kuh«, sagte Lilly.
Onkel Jupp schien sehr nervös zu sein. Beim Aufräumen stieß er mehrmals wie in großer Wut mit dem Fuß gegen ein Möbelstück.
»Der Kleiderschrank kann doch nichts dafür«, sagte Mama leise.
»Kein fairer Kampf«, wütete Onkel Jupp. »Nicht mehr Männer gegen Männer, sondern Männer gegen Frauen und Kinder.«
»Machen unsere Leute doch auch, sogar im eigenen Land«, murmelte Mama. »Holen ganze Familien aus ihren Häusern und sperren sie ins Lager.«
Lilly kam Onkel Jupp zu Hilfe. »Das sind keine normalen Familien, Mama, das weißt du doch. Das sind Juden. Und die werden nicht eingesperrt, sondern in Schutzhaft genommen. So ist das.«
Mama seufzte. »Ja ja.«
Krachend warf Onkel Jupp eine Schaufel voller Scherben in den Abfalleimer. »Morgen früh werden wir von hier fortfahren, damit sie uns nicht doch noch erwischen.«
»Wohin?«
»Ich werde mir etwas einfallen lassen.«
Das, was Onkel Jupp sich einfallen ließ, hieß Domäne Staaken und war in Mecklenburg gelegen, am Rande des Dorfes Galitz. Es handelte sich um ein Staatsgut, sogar um einen Musterbetrieb, alles war hier sauber und ordentlich und sehr gepflegt, ganz anders, als Lilly es von Frieda Gössels Bauernhof her kannte.
Eine Woche lang wohnten sie im Dorfgasthof, dann zogen sie um in ein kleines Haus, das offenbar noch vor sehr kurzer Zeit von anderen Leuten bewohnt gewesen war. Lilly, die froh war, so schnell wieder ein eigenes Bett und sogar ein eigenes Zimmer zu haben, machte sich keine Gedanken über die Vorbewohner.
Überraschend kam Papa nach Staaken. Onkel Jupp hatte ihm eine Nachricht geschickt und Papa hatte Sonderurlaub bekommen.
Die beiden Brüder, die sich doch zuvor so gut verstanden hatten, sprachen kaum miteinander. Doch fuhren sie gemeinsam in einem großen Lastwagen, den Onkel Jupp organisiert hatte, nach Hamburg und holten aus der halb zerstörten Wohnung Möbel und Hausrat, um sie nach Staaken zu transportieren.
Kurz danach war Onkel Jupps Urlaub abgelaufen.
Als er ging, sagte Mama mit ungewohnt fester Stimme zu Papa: »Ich will, dass du dich richtig von ihm verabschiedest. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass du ihn siehst. Er ist dein Bruder!«
»Und du bist meine Frau!«
»Unsere eigenen Probleme werden wir später lösen. Jetzt ist Krieg.«
»Was haben unsere Probleme mit dem Krieg zu tun?«, sagte Papa. Aber er umarmte Onkel Jupp dennoch, so wie Mama es gewollt hatte.
Mit dem Fahrrad erkundete Lilly die Gegend. Das Dorf war klein. Den Mittelpunkt bildete eine große alte Schnapsbrennerei, deren dreistöckiger, klotziger Bau aus schwarzroten Ziegeln seltsam fremd inmitten der kleinen Häuser stand. Lilly, der man in der Schule und beim BDM eine romantische Vorstellung vom Landleben beigebracht hatte, war enttäuscht über die Armut und Hässlichkeit des Dorfes.
Ganz am Ende der Dorfstraße in Richtung Lehseburg befand sich in einem struppigen, ungepflegten Park das Schloss. Leider war es aber kein golden schimmernder, türmchenbewehrter Märchenpalast, sondern ein schmutzig grauer, riesengroßer Kasten mit fünf bröckelnden Säulen davor. Und es wohnte auch keine wunderschöne Prinzessin darin und nicht einmal eine vornehme Grafenfamilie, sondern eine Gruppe Arbeitsmaiden, die hier als Hilfskräfte bei den Bauern eingesetzt wurden.
Im Dorfladen hörte Lilly, wie eine Frau zu der anderen sagte: »Diese Stadtfräuleins sollte man lieber lassen, wo sie hingehören. Hier sind sie zu gar nichts gut. Wenn unsere Jungs auf Urlaub kommen, verdrehen die ihnen die Köpfe mit ihrem Getue. Und unsere Mädels haben das Nachsehen.«
Zwischen dem Gut und Galitz lag ein ausgedehnter Mischwald mit dichtem Unterholz. Auf der Suche nach einer neuen Baumhöhle radelte Lilly eines Tages weit in diesen Wald hinein. Als der Weg, eher ein schmaler Trampelpfad, nicht mehr befahrbar war, ließ sie ihr Rad stehen und ging zu Fuß weiter. Es war sehr heiß, das immer dichter werdende Gestrüpp zerkratzte Lillys Arme und Beine, und gerade als sie beschloss, doch besser umzukehren, stieß sie auf einen schmalen Fluss, der träge plätschernd zwischen den Bäumen dahintrödelte. Das Ufer war mit hohem Schilf bestanden und mit Mümmelchen und Wiesenschaumkraut und Pechnelken verziert. Und dort, wo das Flüsschen eine Biegung machte, reichte moosiges Gras direkt bis ans Wasser. Lilly hatte so etwas noch nie in Wirklichkeit gesehen, nur im Kino oder in Bilderbüchern. Sie zog ihre Sandalen aus, steckte den Rocksaum ins Taillenband und watete beglückt am Ufer entlang. Und dabei entdeckte sie etwas, das ihr zuerst einen großen Schreck einjagte: eine Hütte, direkt hinter der Biegung des Flüsschens gelegen und nur vom Wasser her einzusehen.
Vorsichtig stieg sie ans Ufer zurück und blieb eine Weile im Gras sitzen.
Eine Hütte, was war das schon. Vermutlich hatte jemand sie vor langer Zeit gebaut und inzwischen längst vergessen. Ein einsames Waisenkind vielleicht oder sogar die schöne blondlockige Prinzessin, die im Schloss gewohnt hatte, bevor sie vom Arbeitsdienst vertrieben worden war.
Lilly schaute sich die Sache etwas genauer an und war enttäuscht. Eine wacklige Konstruktion aus alten Brettern und ineinander geflochtenen Zweigen. Statt der Tür hing über dem niedrigen Eingang eine alte Pferdedecke, an deren oberer Ecke Lilly zu ihrer Überraschung das Zeichen der Domäne Staaken entdeckte. Lilly lüftete die Decke ein wenig, sah, dass die Hütte leer war, und schob sich hinein. Drinnen war es dämmrig und es roch nach Erde und Baumrinde und trockenem Gras, kaum anders als draußen, nur intensiver. In der hinteren Ecke befand sich ein Laubbett. Dann gab es noch eine große Kiste als Tisch und eine kleine als Stuhl. Auf der Tischkiste lag ein zerfleddertes Buch, »Heidis Lehr- und Wanderjahre«. Ein Mädchen also, dachte Lilly, denn sie wusste von Joachim, dass Jungen dieses Buch absolut weibisch und bescheuert fanden.
Lilly legte sich auf das Lager, das angenehm weich war, und dachte nach. Als sie zu Ende gedacht hatte, war sie zu dem Entschluss gekommen, dass das Mädchen, Prinzessin oder Waisenkind oder was auch immer, inzwischen erwachsen geworden war und die Hütte längst vergessen hatte. Das Heidibuch gab’s schon seit vielen Jahren und die Pferdedecke war zerschlissen und hatte alle Farbe verloren, kein Diebstahl aus jüngster Zeit. Und so stand Lillys Inbesitznahme der Hütte eigentlich nichts entgegen. Wenn der Onkel ein ganzes Haus organisieren konnte, dann war es ja wohl in Ordnung, dass Lilly eine leere Hütte übernahm.
Von nun ab verbrachte sie jede freie Stunde am Fluss. Sie war sehr vorsichtig und achtete immer darauf, dass niemand sie sah, wenn sie von der Straße in den Wald abbog. Und während Papa das Familienhaus, das zuvor anscheinend ziemlich vernachlässigt worden war, in Ordnung brachte, tat Lilly das Gleiche mit ihrer Hütte.
Niemand fragte, was sie da draußen trieb, alle waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Nur Mama schaute manchmal nachdenklich ihre Tochter an, und einmal sagte sie: »Dir geht’s hier besser als in Hamburg, oder?«
Lilly nickte.
»Keine Angst vor der neuen Schule?«
Lilly schüttelte energisch den Kopf. »Schlimmer als zu Haus kann’s nicht werden.«
»War es wirklich so schlimm?«
»Hab ich dir doch erzählt«, sagte Lilly. »Aber du hörst ja nie zu.«
»Doch, doch«, entgegnete Mama, »ich hör dir schon zu. Es ist nur, weil es doch momentan so viel Schlimmeres auf der Welt gibt als Ärger in der Schule.«
Plötzlich kriegte Lilly einen Wutanfall, ebenso unsinnig wie unkontrollierbar. »Typisch«, schrie sie, »du nimmst mich eben nicht ernst und hast mich nie ernst genommen. Immer und ewig gibt’s für dich Wichtigeres und Schlimmeres. Aber lass mal, ich komm schon allein zurecht.« Und damit rannte sie aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
Da Oma Elli den neuen Haushalt noch nicht wieder so fest unter Kontrolle hatte wie den alten in Hamburg, konnte Lilly unbemerkt ein paar Gegenstände mit zur Hütte nehmen, Teller und Becher, eine Wolldecke, Messer, Gabel, Löffel und sogar ein kleines Tischtuch für die Holzkiste. Von Tag zu Tag fühlte sie sich sicherer und sie machte bereits Pläne, wie sie im kommenden Frühjahr das Baby hierher bringen würde.
Eines Nachmittags, ungefähr acht Tage nachdem sie die Hütte in Besitz genommen hatte, fand sie dort ein großes Durcheinander vor. Nichts lag oder stand mehr an seinem alten Platz, eine Tasse war zerschlagen, das Tischtuch eingerissen und die Blumen, die sie zum Trocknen aufgehängt hatte, waren heruntergerissen und zerrauft. Neben dem Eingang klebte ein Blatt Papier, auf dem stand: »Hau bloß ab von hier, sonst wirst du was erleben!«
Das war wie ein Schlag in den Bauch. Lilly schnappte nach Luft und fiel auf das Bett. Da saß sie und starrte den Zettel an und ihr wurde ganz übel vor Schreck. Und dann sah sie noch eine zweite Nachricht, direkt neben sich, mit einer Nadel an der Wolldecke befestigt. »Ich habe drei große Brüder und eine Axt und ein Brotmesser!« stand da.
Lilly nahm die Zettel, verließ die Hütte und rannte kopflos davon. Doch schon nach wenigen Minuten kam sie zu sich. Eile mit Weile, würde Papa dazu sagen, und wie immer hatte er Recht. Sie zog die zerknitterten Zettel aus ihrer Rocktasche und strich sie glatt. Liniertes Schulheftpapier, schon mal beruhigend.
Hau bloß ab von hier? Das hatte sie dann ja auch prompt getan, ziemlich schwach, nur weil ihr da jemand schrecklich gedroht hatte.
Lilly fischte sich einen Bleistiftstummel aus den Tiefen ihrer Rocktasche und schrieb auf die Rückseite des Hau-ab-Zettels: »Hau doch selber ab. Aber wenn du einen ehrlichen Kampf willst, dann komm morgen Nachmittag um drei Uhr. Unbewaffnet!«
Sie schlich sich zurück, befestigte den Zettel gut sichtbar neben dem Eingang, trieb sich noch eine Weile in der Nähe herum und machte sich schließlich auf den Heimweg.
Es war Papas letzter Urlaubstag. Noch vor dem Abendessen sollte er abgeholt werden. Als das Wehrmachtsauto, in dem schon drei andere Offiziere saßen, vor der Tür stand, umarmte Lilly ihren Vater, klammerte sich weinend an ihn und machte ein großes Theater. Papa war das etwas peinlich und Lilly auch, zumal sie ahnte, dass es irgendwie falsch war und nicht bloß mit Papa, sondern mit lauter anderen Sachen zu tun hatte.
Tränenüberströmt winkte sie hinter Papa her. Anschließend lag sie lange in Mamas Schoß, lauschte auf die Geräusche des Babys und versuchte, sich selbst zu begreifen.
Am nächsten Nachmittag nahm Lilly nicht ihren üblichen Weg zur Hütte, sondern radelte zum Dorf, schloss ihr Rad hinter dem Wirtshaus an und näherte sich dem Flüsschen zu Fuß von der anderen Seite. Sie versteckte sich im Schilf und wartete. Der Zettel hing nicht mehr neben der Hüttentür, die Person hatte also die Nachricht erhalten und würde vermutlich bald auftauchen. Aber sie kam nicht, sie war nämlich längst da.
Die Person hockte im Gebüsch, nahe dem Durchgang, den Lilly normalerweise benutzte, und beobachtete die Hütte genauso einsatzbereit und angriffslustig wie Lilly.
Schließlich, es mochte wohl schon vier Uhr sein, wurde es den beiden langweilig. Außerdem kam ein kühler Wind auf und so beschlossen sie, unabhängig voneinander, jedoch im Gleichtakt, die Warterei drinnen fortzusetzen. Geräuschlos näherten sie sich der Hütte, Lilly von der Flussseite her, die andere aus dem Gebüsch. Vor dem Eingang prallten sie zusammen. Erschrocken machte jede einen Sprung rückwärts. Dort standen sie nun und starrten einander ins Gesicht. Keine von ihnen hatte zuvor überlegt, auf weiche Weise denn nun der ehrliche Kampf stattfinden sollte.
»Also du bist das«, sagte die andere schließlich, »hätt ich mir ja gleich denken können.«
»Wieso ich?«, fragte Lilly verdutzt.
»Wieso ich, wieso ich«, äffte die andere sie nach. »Weißt selber nicht mal, wer du bist!«
»Blöde Ziege«, sagte Lilly.
»Diebin!«, blaffte die andere.
»Dreckschleuder!«
»Küchenschabe!«
»Hexe!«
»Ratte!«
Ziemlich schnell gingen ihnen die gewöhnlichen Schimpfwörter aus. Also mussten sie sich neue einfallen lassen.
»Fauler Backenzahn«, höhnte Lilly.
»Ausgelatschter Pantoffel«, schmetterte die andere.
»Dreckige Unterhose«, fiel Lilly ein.
»Leere Schnapsflasche«, konterte die andere.
»Misthaufen!«
»Abfallgrube!«
»Klodeckel!«
»Arsch mit Fransen!«
Das war gut!, dachte Lilly und schmetterte dagegen, leider nicht ganz so gut: »Hängebusen!«
»Mundgestank!«, schrie die andere und dann ganz schnell hintereinander, so als wäre ihr Vorrat an Ekelhaftem unermesslich: »Schweinefutter! Hundescheiße! Schweißfuß! Altes Haar im Läusekamm! Schmierrand in der Badewanne …!«
Und weiter ging es ohne Unterbrechung. Lilly kam nicht wieder zu Wort. Sie hätte sowieso nichts mehr sagen können, weil sich unverhofft mitten in ihr ein Gelächter zusammengebraut hatte, das nun unaufhaltsam nach oben drängte, um den Magen herum, durch die Lunge, hinauf in die Kehle. Ein unbändiger Druck riss ihr den Mund auseinander: Lilly prustete los. Sie japste und schrie und schüttelte sich vor Lachen. So sehr überrollt wurde sie davon, dass ihr die Knie weich wurden und sie glucksend zu Boden rutschte. Erst als sie saß, bemerkte sie, dass die andere auch nicht mehr aufrecht stand, sondern neben ihr ins Gras gefallen war und ebenso hilflos wie sie selbst dieser unerwarteten Heiterkeit ausgeliefert war.
Eigentlich fand Lilly das ziemlich peinlich, so als ob sie sich in aller Öffentlichkeit schlecht benommen hätte, und als sie dann plötzlich fühlte, dass sie sich vor lauter Lachen tatsächlich nass gemacht hatte, sprang sie auf, riss sich ihr Kleid vom Körper und stürzte sich mitsamt der Unterhose ins Flüsschen. Dort kam sie langsam zu sich. Der Lachzwang verging, die Peinlichkeit blieb. Zögernd paddelte sie zum Ufer zurück, wo die andere stand und ihr aufmerksam entgegensah. Lilly stieg aus, zog sich erst das Kleid über und dann die Unterhose drunter aus, kniete sich hin, gab sich sehr geschäftig, spülte ihr Höschen mehrmals, wrang es dann sorgfältig aus und hängte es zum Trocknen über einen Busch. Als ihr nichts mehr zu tun blieb, musste sie sich wohl oder übel der anderen zuwenden.
Die nahm ihr den Anfang ab. »Du bist vielleicht komisch«, sagte sie, »ich hätte dir doch dein Kleid wegnehmen können.«
»Hast du aber nicht. Wenn man zusammen gelacht hat, dann beklaut man sich anschließend nicht.«
»Na ja«, sagte die andere. »Aber dies hier ist meine Hütte. Und mein Fluss und mein Schilf und meine Bäume und meine Blumen. Niemand anderes hat das Recht, hier zu sein. Ich bin nämlich vom Schloss und mir gehört hier alles.«
»Du spinnst«, sagte Lilly. »Im Schloss wohnt der Arbeitsdienst. Außerdem ist es das hässlichste Schloss, das ich je gesehen habe, vernachlässigt und verkommen.«
Die andere lächelte hochmütig. »Du hast nicht richtig hingesehen. Hässlich ist es nur von vorne, als Tarnung, damit man mich und meine Familie in Ruhe lässt. Wir wohnen hinten und da ist alles Gold und Silber und Juwelen und schwere seidene Vorhänge und Vasen voller Orchideen auf jedem Fensterbrett.«
»Ich hab schon bessere Lügen gehört«, brummte Lilly. Jetzt endlich betrachtete sie die andere etwas genauer und wider Willen war sie beeindruckt. Wenn das Kleid, das sie trug, nicht so dreckig und abgetragen gewesen wäre, hätte es tatsächlich so eine Art Prinzessinnenkleid sein können, sehr altmodisch, fast bodenlang, aus ehemals weißem Stickereistoff und mit einer himmelblauen Seidenschärpe um die Taille.
»Irgendwie erinnert mich dein Kleid an die Schlossfassade«, sagte Lilly bissig.
Das angebliche Schlossfräulein war nicht beleidigt. »Du guckst eben nicht richtig hin, bist genau wie die anderen Blödköpfe. Alles nur Tarnung, wie oft soll ich dir das noch erklären. Kannst du dir denn nicht vorstellen, was die Leute im Dorf zu mir sagen würden, wenn ich mit meinem richtig feinen Kleid und mit Stöckelschuhen durch den Kuhmist wanderte?«
»Nein, was denn?«, fragte Lilly neugierig.
Die Augen des Mädchens, aus denen grad noch eben Blitze geschossen waren, wurden trüb und lustlos. »Na ja«, sagte sie.
»Du sagst ziemlich oft na ja«, stellte Lilly fest.
»Zweimal bisher. Und ein weiteres Mal wirst du’s nicht hören. Weil ich nämlich jetzt gehe.« Sie wandte sich ab.
»Wieso …«, sagte Lilly, »wir haben doch noch gar nicht … ich meine die Sache mit der Hütte …«
»Hau ab, habe ich dir geschrieben, und das mein ich auch so. Daran ändert sich nichts.«
Sie entfernte sich mit energischen Schritten, wobei sie ihren Rock nach Hofdamenart raffte. Als sie damit an einem Brombeerstrauch hängen blieb, riss sie so wütend, dass ein weiteres Loch entstand.
»Aber wir könnten die Hütte doch gemeinsam bewohnen«, rief Lilly hinter ihr her, »jetzt, wo wir uns kennen.«
Das Mädchen sah sich nicht einmal um. Sie schrie nur in allerverächtlichstem Tonfall, tatsächlich einer Schlosshoheit angemessen: »Mit jemandem wie dir kann ich nicht zusammenwohnen!« Kurz darauf war sie verschwunden.
Enttäuscht sah Lilly hinter ihr her. Mit jemandem wie dir, was sollte denn das heißen? Nicht fein genug? Oder vielleicht mal wieder anders als die anderen, halb englisch oder halb jüdisch oder halb sonst was, jedenfalls nichts richtiges Ganzes? Was ist denn bloß an mir dran, fragte Lilly sich betrübt, dass die Leute mich nicht mögen.
Während der nächsten Tage musste sie fortwährend an das fremde Mädchen denken, das sie inzwischen »die Prinzessin« nannte. Jeden Nachmittag ging sie zur Hütte, aber das Mädchen tauchte nicht wieder auf. Lilly schlich sich sogar durch den verlotterten Schlosspark mit dem matschigen Teich davor, in dem gerade mal eine einzige Seerose blühte. Das Schleichen wäre nicht nötig gewesen, die Arbeitsmaiden beachteten sie nicht. Lilly fand es merkwürdig, dass einige von denen angemalte Lippen hatten und ausrasierte Augenbrauen. Die deutsche Frau schminkt sich nicht, hatte die Reichsfrauenschaftsführerin gesagt. Was waren denn das hier für deutsche Frauen?
Leider sah das Schloss von hinten genauso heruntergekommen aus wie von vorne. Keine goldenen Ornamente, sondern grauer, bröckelnder Putz, und statt der seidenen Vorhänge und Orchideen-Bukette hing in vielen Fenstern Wäsche zum Trocknen.
Der Sommer war nun fast vorüber und mit ihm die Ferien. Mama ging es nicht gut. Sie hatte so schwere Migräneanfälle, dass Lilly stundenlang neben ihr sitzen musste, um ihr die Stirn zu kühlen. Aber das Baby wuchs. Mamas Bauch war jetzt so groß, dass es oft aussah, als würde sie die Balance verlieren und nach vorne überkippen. Sie sprach fast überhaupt nicht mehr. Wenn sie Migräne hatte, ging es nicht, und danach war sie zu erschöpft.
Von Papa kam ein Päckchen mit Babykleidung und ein Brief. Er habe sich nach Afrika versetzen lassen und würde voraussichtlich so bald keinen Urlaub mehr bekommen.
Der Gutsinspektor, Herr von Freusaal, schickte ihnen zwei polnische Fremdarbeiterinnen zur Hilfe im Haushalt, Magda und Danuta; die waren Mutter und Tochter und trugen auch im Sommer Kopftücher und halbhohe Stiefel aus Filz. Anfangs war Oma Elli ganz verärgert, weil sie nicht wusste, was sie mit ihnen anfangen sollte. Aber als sie merkte, dass Magda und Danuta alles taten, was man ihnen sagte, sofern sie es verstanden, war sie dann doch ganz zufrieden. Danuta war kaum älter als Lilly, hatte lustige Augen und Grübchen in den Wangen und nannte Lilly immer sehr ehrerbietig Panienka, was Fräulein heißt. Beim ersten Mal hatte Lilly über diese Anrede verwirrt gekichert, aber sie gewöhnte sich ziemlich schnell daran, dass Danuta ihr Bett machte und das Zimmer aufräumte und ihre Wäsche wusch. Schließlich war Danuta Polin, und die Deutschen hatten Polen besiegt.
Dann kam der erste Schultag und Lilly radelte gemeinsam mit ihrem Bruder Joachim auf dem sandigen Feldweg durch den Wald bis zur Lehseburger Chaussee, wo es dann sehr viel leichter ging, abwärts bis zur Schule.
Lilly fand ihren Klassenraum und schob sich gleich in eine der vorderen Bänke. Lange genug hatte sie hinten gesessen, jetzt wollte sie es einmal anders versuchen. Niemand machte ihr den Platz streitig.
In der ersten Pause lümmelte sich Lilly betont nachlässig auf ihr Pult, setzte die Füße gegen den Stuhl und sah sich um. Eine gemischte Klasse wie zu Hause in der Volksschule, mehr Jungen als Mädchen.
Irgendwie fühlte sie sich hier sehr überlegen, sie war eine Großstädterin, konnte lateinisch konjugieren und deklinieren, sprach fließend Englisch, wohnte auf einem Mustergut und hatte sogar eine Kammerzofe, die ihr das Zimmer aufräumte.
Doch plötzlich blieb ihr Blick hängen an einem Rücken, der ihr sehr bekannt vorkam, und all ihre Überlegenheit ging zu Bruch wie ein dünnes Glas, in das jemand kochendes Wasser gießt.
Da stand sie, Lillys Prinzessin, stand in der Tür und redete mit einem älteren Jungen, der ihr ziemlich ähnlich sah, blondlockig und blauäugig wie sie.
Die Prinzessin musste Lillys bohrenden Blick gespürt haben, denn sie drehte sich zu ihr um und betrachtete sie mit hochmütig gerunzelter Stirn. Dann wandte sie sich wieder dem Jungen zu, redete schnell auf ihn ein, deutete mit dem Daumen über die Schulter nach hinten zu Lilly und verließ, gemeinsam mit dem Jungen – vermutlich einer ihrer großen Brüder –, das Klassenzimmer.
Während der folgenden Schulstunden sah Lilly sich mehrmals um. Die Prinzessin saß ganz hinten nahe der Tür, sie beteiligte sich kaum am Unterricht und wurde nur ein einziges Mal drangenommen, und zwar bei einer Frage, die sowieso niemand beantworten konnte. Als die Prinzessin, die der Lehrer Lauterbach mit Isabella angeredet hatte, daraufhin sagte: »Keine Ahnung«, ertönten ein paar höhnische Lacher in der Klasse. Lilly begriff nicht, was an der Antwort so komisch gewesen sein sollte.
Als es zur nächsten Pause klingelte, war die Prinzessin als Erste draußen. Auf dem Schulhof jedoch konnte Lilly sie nicht finden. Prinzessinnen haben wahrscheinlich einen Privatschulhof, phantasierte Lilly, einen blühenden Garten, wo sie mit Eiscreme und Kirschsaft gefüttert werden. Und nachher rauschen sie in einer sechsspännigen Kutsche davon oder vielleicht gar auf einem fliegenden Teppich.
Dann war der Unterricht zu Ende und Lilly ging zum Fahrradkeller. Dort nun, im Halbdunkel, wo es nach altem Gummi und nassen Kleidern roch, traf sie wieder auf die Prinzessin. Kurz entschlossen versperrte sie ihr den Weg. »Du kannst deine Hütte wiederkriegen«, sagte sie, »aber ich will wissen, was du gegen mich hast.«
»Hau ab, sag ich dir, sonst kriegst du’s mit meinem Bruder zu tun. Der prügelt besser als jeder andere.«
»Ich hab auch so einen«, sagte Lilly, »und der prügelt ebenfalls sehr gut.
Allerdings würde er nie ein Mädchen verprügeln, weil er nämlich kein Feigling ist.«
»Red bloß nicht schlecht von meinem Bruder!«, sagte die Prinzessin.
»Tu ich ja gar nicht. Ich sag nur, dass meiner kein Feigling ist. Und wenn es hier was zum Prügeln gibt, dann können es die beiden doch untereinander ausmachen.«
Momentan schien die Prinzessin beeindruckt zu sein. »Gar nicht so dumm«, sagte sie, »ich werd’s Markus ausrichten.«
»Meiner heißt Joachim«, sagte Lilly. »Und wie heißen die beiden anderen?«
»Welche anderen?«
»Ich dachte, du hättest drei.«
Die Prinzessin lachte. »Um Gottes willen, nein. Ein Bruder reicht mir gerade.«
Lilly verkniff es sich, die Prinzessin daran zu erinnern, dass auf ihrem Drohzettel von drei großen Brüdern die Rede gewesen war. Stattdessen sagte sie: »Sind sie nicht absolut grässlich, diese großen Brüder?«
»Unausstehlich!«, bestätigte die Prinzessin.
»Lästig und blöd«, sagte Lilly.
»Und dazu noch so verfressen«, stöhnte die Prinzessin.
»Und sie riechen so schlecht«, sagte Lilly.
»Und sie machen nie ihr Bett«, klagte die Prinzessin.
Anhand ihrer Erfahrung mit der Schimpfkanonade konnte Lilly sich gut vorstellen, dass die Prinzessin noch ein paar mehr Beschwerden zum Thema grässlicher großer Bruder auf Lager hatte, doch sie wollte die gelockerte Stimmung möglichst schnell nutzen und sagte: »Meiner hat eine Stunde länger heute.«
»Meiner auch«, sagte die Prinzessin.
»Dann sind wir also unter uns«, stellte Lilly fest. »Und da wir uns nicht mehr prügeln müssen, können wir doch gemeinsam nach Hause radeln.«
»Na ja«, sagte die Prinzessin.
So fuhren sie hintereinander her, zuerst auf der Lehseburger Chaussee, dann den Waldweg entlang. Sie schwiegen beide. Kurz vor Staaken sagte die Prinzessin: »Ich muss jetzt rechts abbiegen, Richtung Dorf.«
»Ich weiß«, sagte Lilly, »weil du ja im Schloss wohnst.«
»Tu ich wirklich«, sagte die Prinzessin und fuhr davon.
Lilly rief hinter ihr her: »Also bis morgen!«
Ziemlich vergnügt radelte sie nach Hause. Der Anfang war gemacht.
Mama hatte Migräne, und Lilly legte ihr kalte Tücher auf die Stirn. »Vielleicht hab ich eine neue Freundin«, sagte Lilly.
Trotz ihrer Schmerzen brachte Mama ein kleines Lächeln zustande. »Wie schön für dich.«
Joachim kam erst lange nach dem Mittagessen. Lilly traf ihn vor dem Haus. Er sah fürchterlich aus, ein Auge fast zugeschwollen, Blut im Mundwinkel, das Hemd zerrissen und das Fahrrad zerbeult.
Lilly grinste. »Da war einer stärker als du, was?«
Am nächsten Morgen blieb Joachim im Bett, also machte Lilly sich ohne ihn auf den Schulweg. An der Abzweigung wartete sie auf die Prinzessin, die auch ziemlich bald auftauchte.
»Denen war’s aber eilig mit der Prügelei«, sagte Lilly. »Dabei hab ich überhaupt nichts gesagt. Du etwa?«
»Na ja«, sagte die Prinzessin.
»Wie sieht denn deiner aus?«, erkundigte sich Lilly.
»Fürchterlich, er ist heut im Bett geblieben.«
»Meiner auch.«
Sie radelten nebeneinanderher.
»War das tatsächlich wegen uns?«, fragte Lilly.
»Jungs prügeln sowieso gerne«, antwortete die Prinzessin ausweichend.
»Aber es wäre doch schön, wenn’s unsretwegen gewesen wäre«, meinte Lilly, »dann könnten wir uns nämlich jetzt vertragen.«
»Wenn’s nicht sowieso unmöglich wäre«, sagte die Prinzessin.
»Versteh ich nicht. Warum?«
»Na ja. Weil … also weil sich die Jungs morgen wieder prügeln werden.«
»Lass sie doch, dann haben wir unsere Ruhe.«
»Du und ich werden niemals unsere Ruhe miteinander haben«, sagte die Prinzessin in einem derart dumpf-tragischen Tonfall, dass Lilly lachen musste. »So ein Quatsch«, sagte sie. »Wir haben den gleichen Schulweg und sind in der gleichen Klasse. Wir könnten sogar nebeneinander sitzen, der Platz neben mir ist frei. Außerdem sind wir zufällig beide etwas anders als die anderen, darum gehören wir irgendwie zusammen.«
»Unmöglich«, antwortete die Prinzessin. »Der Lauterbach würde mich nie da vorne sitzen lassen.«
»Warum denn bloß nicht?«
Die Prinzessin seufzte. »Du kannst einem wirklich auf die Nerven gehen«, sagte sie. Dann reckte sie sich aus dem Sattel hoch, stemmte sich in die Pedale und fuhr Lilly davon.
»Warte doch, warte …«, schrie Lilly, die im Radfahren noch nicht sehr geübt war. Aber die Prinzessin drehte sich nicht einmal um.
Während der Schulzeit redeten sie nicht miteinander, aber nach der letzten Stunde machten sie sich wieder gemeinsam auf den Heimweg. Lilly war sehr vorsichtig und sprach nur über unverfängliche Dinge, vom Wetter, der Schule, von der Schwierigkeit, einen sandigen Feldweg zu befahren.
Am nächsten Morgen stand sie früh auf, machte einen Umweg über das Dorf und wartete vorm Schloss. Zwar glaubte sie inzwischen nicht mehr, dass die Prinzessin tatsächlich dort wohnte, aber sie wollte es doch ganz genau wissen. Als Isabella dann im Park auftauchte, wurde Lilly sehr aufgeregt und winkte ihr freudig zu.
Leider kriegte die Prinzessin einen Wutanfall. »Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand hinter mir herspioniert«, schrie sie, »mach bloß, dass du wegkommst, hier hast du nichts zu suchen!« Und sprang aufs Rad und war nach kurzer Zeit außer Sicht.
Lilly übte sich in ungewohnter Geduld. Sie näherte sich nie mehr dem Schloss, stellte keine persönlichen Fragen und beklagte sich auch nicht, wenn die Prinzessin ihr wieder und wieder erklärte, dass sie »mit jemandem wie dir« nicht befreundet sein könnte. Denn Isabellas sonstiges Verhalten strafte ihre Reden Lügen. Sie strahlte, wenn sie Lilly sah, wartete sogar an der Abzweigung, als Lilly sich einmal verspätet hatte, und fuhr ihr auch nicht mehr davon.
»Eigentlich schade um die Hütte«, sagte Lilly eines Tages, »jetzt hab ich sie so schön zurechtgebaut, und niemand geht mehr hin.«
»Wieso, du auch nicht?«
»Kann ich doch nicht. Sie gehört dir und ich hab dir keine Miete gezahlt.«
»Würdest du das tun?«
»Na klar.«
»Wie viel?«
»Sagen wir mal … die Hälfte von meinem Taschengeld wär’s mir schon wert. Ich krieg jetzt dreißig Pfennig die Woche. Also dann: fünfzehn Pfennig für die Hütte.«
Isabella staunte. »Seid ihr so reich?«
»Bestimmt nicht so reich wie jemand, der im Schloss wohnt.«
O verflixt, da hatte sie versehentlich das Schloss erwähnt, wenn das nur nicht schief ging!
Tat es aber nicht, Gott sei Dank. Zwar zögerte Isabella einen Moment, doch dann sagte sie seufzend: »Na ja.«
»Ist das dann also abgemacht mit der Miete?«
»Abgemacht«, sagte die Prinzessin. »Und weil du so viel daran gearbeitet hast, erlaube ich dir, trotz der Miete mit mir zusammen die Hütte zu benutzen. Allerdings muss ich dich zu strengstem Stillschweigen verpflichten.«
Lilly war zu begeistert, um sich an der Unlogik dieses Mietgeschäftes zu stoßen. »Na klar«, sagte sie, »kein Wort zu irgendwem.«
Und so begann für Lilly eine wunderbare Zeit. Jeden Tag nach dem Mittagessen packte sie erneut ihre Schulmappe und fuhr davon. »Da wohnt eine aus meiner Klasse hier im Dorf«, erklärte sie Oma Elli, »die hilft mir bei den Schularbeiten. Ich hab nämlich fürchterlich viel nachzuholen.«
»Soll das etwa heißen, dass diese Kleinstadtschule weiter voran ist als dein Hamburger Gymnasium?«
»Na ja«, sagte Lilly. Isa hatte Recht, na ja war eine sehr praktische Antwort.
Pünktlich jeden Sonnabend nach der letzten Schulstunde zahlte Lilly ihre Miete. Isa nahm das Geld kommentarlos entgegen und ließ es in ihrer Rocktasche verschwinden.
Der Beitrag, den Isabella zu dem neuen Haushalt leistete, hatte zwar kaum praktischen Wert, war dafür aber sehr eindrucksvoll und diente der Dekoration. Es handelte sich meist um aus Büchern herausgerissene farbige Abbildungen von Gemälden italienischer Maler, deren Namen Isa mit rollendem R und klingenden Vokalen so lässig hersagte, als lauteten sie Franz Schulz oder Fritz Müller. Botticelli, Mantegna, Leonardo da Vinci, Filippo Lippi, Raffael, Giorgione …
Isa war ganz vernarrt in ein Jünglingsporträt von Filippo Lippi.
»Würdest du ihn heiraten?«, fragte Lilly.
»Na ja«, sagte Isa, »vermutlich nicht gleich heiraten, aber probeweise zusammenziehen, das würde ich tun.«
Lilly machte große Augen. »Du meinst …«
»Was denn sonst«, sagte Isa.
»Und ich dachte immer, bloß die Juden wären frühreif und so etwas.«
»Was ist denn das für ein Blödsinn?«
»Genau«, sagte Lilly zufrieden, »das ist wirklich Blödsinn. Vor allem, weil du überhaupt nicht jüdisch aussiehst.«
»Findest du? Dabei habe ich eine jüdische Urgroßmutter.«
Lilly zuckte zusammen. »Um Gottes willen, erzähl das bloß niemandem.«
»Jüdin«, fuhr Isabella trotzig fort, »und sie war wunderschön und ist von drei oder vier Malern porträtiert worden. Sie hieß ebenfalls Isabella und sie hat mir ihre Haarbürste geschenkt, echtes Silber!«
»Lebt sie etwa noch?«
»Sie ist vor acht Jahren gestorben. Und das war gut so. Sonst hätten die Schweine sie ins Lager gesperrt und umgebracht.«
»Welche Schweine?«, fragte Lilly verwirrt. »Und die Juden, die werden doch nicht umgebracht, die werden nur in Schutzhaft …«
»Ach, hör schon auf«, sagte Isa.
Ein paar Tage lang überlegte Lilly sich, ob sie die Beziehung zu Isa nicht doch besser abbrechen sollte. Aber es war zu spät, Lilly hatte sich in Isa verliebt.
Natürlich hätte sie es selbst nie Verliebtheit genannt. In ein anderes Mädchen verliebt man sich doch nicht?
Manchmal, wenn Lilly zu Hause allein in ihrem Zimmer saß, dann sagte sie leise vor sich hin: »Ich habe eine Freundin, ich habe eine Freundin!«, und konnte ihren eigenen Worten noch nicht recht trauen. Wegen der jubelnden Freude empfand sie dann auch oft eine unbestimmte Angst.
Als Lilly Isa eines Tages nach langem Überlegen und mit Zittern und Zagen fragte: »Bist du denn jetzt meine Freundin?«, antwortete sie fröhlich: »Na klar.«
»Und hast du vor mir schon mal eine Freundin gehabt?«
»Na klar«, sagte Isa wieder, »was denkst denn du?«
Lilly hielt sich mit ihrer Neugier sehr zurück, doch erfuhr sie nach und nach auch ohne zu fragen einiges über Isas Familie. Der Vater war Maler und hatte bis zum Krieg in Berlin an einer Kunstschule unterrichtet. Die Mutter war Goldschmiedin – »aber sie kann auch ganz wunderbar nähen! Alle meine Kleider sind selbstgemacht.«
»Ach deshalb …«, sagte Lilly.
»Genau, deshalb sehen sie anders aus als andere Kleider. Alles Einzelstücke, verstehst du, so was kannst du nirgends kaufen.«
»Bestimmt nicht.«
Isabella guckte misstrauisch. »Findest du sie etwa nicht schön?«
»O doch, doch, bestimmt!«
Isabella kicherte vergnügt. »Im Lügen bist du nicht sehr gut, das kann ich viel besser.«
»Könnte ich deine Mutter nicht mal kennen lernen?«, fragte Lilly.
»Weiß nicht.«
»Wie ist sie denn so?«
»Groß, dünn, blond, traurig.«
»Meine ist klein, dunkel und auch meistens traurig.«
»Deine? Wieso denn das?«
»Weil Krieg ist, glaube ich. Und deine?«
»Weil mein Vater weg ist. Und weil sie das Landleben hasst und die Leute hier und alles. Dabei stammt doch ihre Familie von hier, aber die kann sie nicht besonders gut leiden, sie findet sie alle langweilig und altmodisch.«
»Wo ist denn dein Vater momentan?«
»Blöde Frage«, sagte Isabella. »Die Männer sind doch alle weg.«
»Ich wollte ja nur wissen, an welcher Front er ist. In meiner Familie ist der eine in Afrika und der andere in Russland.«
Isabella machte ihr Prinzessinnengesicht. »Ach natürlich, hatte ich ja fast vergessen. Ihr habt sogar zwei von der Sorte, sehr günstig! Freusaal-Scheusal war schrecklich beeindruckt.«
»Wieso das? Versteh ich nicht.«
»Vor allem von dem Jüngeren mit all seinen Rang- und Ehrenzeichen. Major oder General oder so etwas. Selbstverständlich auch ein Schwein!«
»Bist du verrückt geworden?«, ereiferte sich Lilly. »Du kannst doch meinen Onkel nicht als Schwein bezeichnen.«
»Und ob ich das kann. Mein Onkel ist ja auch ein Schwein.«
»Dein Onkel? Welcher Onkel?«
»Der Freusaal natürlich, wer denn sonst.«
Lilly war so verblüfft, dass sie sogar vergaß, wütend zu sein und ihren Onkel Jupp weiterhin gegen den Schweinevorwurf zu verteidigen. »Das kann doch nicht wahr sein«, sagte sie.
»Wieso nicht? Irgendein Schwager oder Vetter meiner Mutter, rein arisch, versteht sich.«
»Also das … also ich weiß wirklich nicht, wie ich das finden soll.«
»Aber ich. Es ist schlecht für mich, weil er uns aus dem Haus geschmissen hat, und gut für dich, weil du jetzt drin wohnen kannst.«
»Was für ein Haus? Ich denke, du wohnst im Schloss?«
Die Prinzessin seufzte. »Selbstverständlich wohnen wir im Schloss. Und davor haben wir auf dem Hof gewohnt.«
»Nein, nein, nein«, rief Lilly erschrocken, »das hab ich wirklich nicht gewusst.«
»Dann weißt du’s eben jetzt.«
»Er hat euch tatsächlich unsretwegen rausgeschmissen? Wie konnte er denn das?«
»Wenn zwei Schweine sich miteinander verbinden, dann machen sie, was sie wollen.«
»Du meinst, der Freusaal und mein Onkel haben …«
»Genau. Sie haben uns gemeinsam umgesiedelt. Wir raus, ihr rein.«
»Und deine Mutter hat sich nicht gewehrt?«
»Versuch mal, dich zu wehren, wenn da zwei Männer in Uniform stehen und dir erklären, dass du bekanntlich eine falsche Großmutter hast und dazu noch einen Mann, der … ach verdammt, lass uns von was anderem reden.«
Diesmal gab Lilly nicht nach. »Du bist meine Freundin, hast du doch selbst gesagt, oder? Deshalb musst du mir jetzt endlich die Wahrheit sagen.«
»Ich muss überhaupt nichts«, schnauzte die Prinzessin. »Und wenn du mich zu sehr löcherst, dann bin ich eben nicht mehr deine Freundin, fertig, aus. War von Anfang an keine gute Idee. Wir sind zu verschieden.«
»Stimmt ja gar nicht. Sieh dir doch die Mädchen in unserer Klasse an, wie verschieden die von uns sind. Die lachen sogar über andere Witze als wir. Daran kannst du merken, dass du und ich zusammengehören.«
»Wegen der Witze …?«
»Tu nicht so blöd. Du weißt genau, was ich meine.«
»Aber du gehörst zur anderen Seite.«
»Welche Seite ist das?«
»Die Seite der Schweine.«
Während dieser Unterhaltung saßen die beiden Mädchen nebeneinander am Rand des Flüsschens und ließen ihre Beine ins Wasser hängen. Es war ein warmer Tag, vielleicht der letzte, bevor es endlich Herbst werden würde. Lilly hatte sich wunderbar gefühlt, glücklich und selbstbewusst und wohl aufgehoben in Isabellas Freundschaft. Und jetzt plötzlich sah sie sich zurückgewiesen, verbannt aus Wärme und Licht, ab mit ihr ins Dunkel, in den Schweinetrog.
»Ich schwimm jetzt mal ein Stück«, sagte Lilly.
Isabella reagierte mit einem besorgten: »Ist eigentlich nicht mehr warm genug, du wirst dich erkälten.«
Wie konnte sie jetzt nur so etwas Normales sagen? Merkte sie denn nicht, wie weh sie Lilly gerade getan hatte?
Lilly sprang hoch, strampelte sich aus ihren Kleidern und rannte ins Wasser, wobei sie die Prinzessin versehentlich nass spritzte. Diese, anstatt sich zu beschweren, zog sich ihrerseits das Kleid über den Kopf und lief jubelnd und wild um sich spritzend hinter Lilly her. »Dann kriegen wir eben alle beide eine Erkältung«, schrie sie, »wennschon, dennschon.«
Danach rubbelten sie sich gegenseitig mit Oma Ellis blauweiß kariertem Tischtuch ab, und als sie wieder angezogen waren, sagte Isa: »Natürlich bleibst du meine Freundin, ist doch klar!«
»Aber erst mal muss ich wissen, wieso ich ein Schwein bin.«
»Bist du doch gar nicht.«
»Hast du aber gesagt.«
»Das war bloß wegen deinem Onkel. Und für den kannst du ja nichts.«
»Er ist aber mein Lieblingsonkel. Und sowieso ist er der einzige Onkel, den ich hab.«
»Tut mir Leid für dich. Weil du irgendwann selbst merken wirst, dass er ein Schwein ist. Früher mochte ich nämlich das Scheusal auch ganz gern und als die Sache mit meinem Vater passierte und dazu noch unsere Wohnung in Berlin ausgebombt wurde, da hat er uns in Staaken aufgenommen und uns das kleine Haus gegeben.«
»Welche Sache mit deinem Vater?«
»Hast du denn immer noch nicht gemerkt, dass ich nicht drüber reden will?«, sagte Isa unwillig.
»Doch, hab ich gemerkt. Aber es nützt nichts. Ein paar Sachen muss ich ganz einfach wissen.«
»Auch, wenn du dann nicht mehr mit mir befreundet sein kannst?«
»Hör endlich auf mit dem Quatsch. Sag, was los ist, und dann wirst du schon begreifen, dass für mich nichts wichtiger ist als unsere Freundschaft.«
Die Prinzessin warf Lilly einen nachdenklichen Blick zu und begann zu reden. Und was Lilly da zu hören kriegte, verstörte sie zutiefst.
Isas Vater war nicht etwa bei der Truppe in Frankreich oder Russland oder Afrika, sondern in einem Lager für Juden und Zigeuner und andere Volksschädlinge. Obgleich selber rein arisch und dazu noch Sohn einer alten Offiziersfamilie, hatte er sich lauthals gegen die Behandlung der Juden durch die Nationalsozialisten empört. Und nicht nur das. Er hatte trotz striktem Arbeitsverbot nicht aufgehört, seine entarteten Bilder zu malen. Er hatte einen Ausländer ohne Papiere bei sich wohnen lassen und schließlich war er auch noch von Nachbarn angezeigt worden, weil er laufend den britischen Feindsender abhörte. Vor vierzehn Monaten war er dann von der Gestapo abgeholt worden. Zuerst hatte man ihn ins Gefängnis gebracht, inzwischen war er im Lager Sachsenhausen.
»Aber was hat er denn bloß gegen Hitler?«, fragte Lilly entsetzt. »Schließlich ist er doch ein Deutscher!«
»Und ob er ein Deutscher ist!«, antwortete Isabella. »Meine Mutter hat ihm sogar vorgeworfen, dass er Deutschland mehr liebt als seine Familie, und sie hat ihn angefleht, sich unsretwegen zurückzuhalten. Aber er wollte bloß immer Deutschland retten vor diesem größenwahnsinnigen Monstrum Hitler, das uns alle ins Unglück stürzen würde.«
Isabella war jetzt sehr aufgeregt. Sie hatte hochrote Wangen, ihre Stimme klang schrill und aus ihren Augen schössen Blitze.
Lilly war nur froh, dass hier niemand zuhören konnte. In dem Bemühen, die Freundin zu beruhigen, sagte sie: »Vermutlich ist dein Vater irgendwie krank, ich meine geistesgestört. So was gibt’s doch.«
»Der und verrückt?«, ereiferte sich Isabella. »Ganz im Gegenteil, der ist normaler als alle anderen. Oder findest du es etwa nicht verrückt, wenn Menschen aufeinander schießen und sich gegenseitig die Häuser zerstören und wenn sie entweder in der Wüste verdursten oder im Schnee erfrieren müssen, bloß weil dieser Herr Hitler einen Krieg machen wollte? Und wie normal findest du es denn, dass jüdische Männer und Frauen und Kinder aus ihren Wohnungen gejagt und ins Lager eingesperrt werden?«
»Auf irgendeine Weise muss man sie doch vor dem Volkszorn beschützen«, sagte Lilly. »Ich weiß das von meinem Onkel, der hat mir gesagt, dass Juden und Kommunisten und so was und auch Leute wie dein Vater in Schutzhaft genommen werden, damit sich die wütenden Volksgenossen nicht an ihnen vergreifen.«
»Schutzhaft, von wegen! Die werden eingesperrt, damit man sie heimlich umbringen kann, irgendwo hinter dicken Mauern, wo es keiner merkt.«
»Was für eine gemeine Verleumdung!«, erregte sich Lilly. »Das ist doch nichts weiter als feindliche Hetzpropaganda, wie kannst du nur so etwas glauben!«
»Glauben! Was meinst denn du, wie gern ich das alles nicht glauben würde. Aber wir haben Beweise. Neulich hat jemand einen Brief von Vater rausgeschmuggelt und was darin steht, das ist so … so entsetzlich und widerlich und gemein … so …«Isabella, die hochmütige, tränenlose, überlegene Prinzessin, konnte nicht mehr weiterreden.
Lilly zögerte nur kurz, dann hockte sie sich entschlossen neben Isabella und nahm sie in die Arme. »Aber jetzt wohnst du doch wenigstens im Schloss!«, sagte sie.
Die Erwähnung des Schlosses hatte auf die Prinzessin eine erstaunliche Wirkung. Sie reckte ihren Rücken, zückte ein Taschentuch und schnauzte sich kräftig. »Genau«, sagte sie dann, »ich wohne im Schloss. Irgendein Urururgroßvater meiner Mutter hat es gebaut. Damals war’s bestimmt auch von vorne schön!«
»Aber hinten ist es doch immer noch prächtig!«, flüsterte Lilly, obgleich sie sich inzwischen längst vom Gegenteil überzeugt hatte. Sie schämte sich sehr, dass sie in ihrer besitzergreifenden Neugier die Freundin dazu gebracht hatte, den Vorhang, hinter dem sie ihr anderes Leben verbarg, für eine tränenreiche Stunde zu öffnen. Und sie nahm sich vor, dass dies, soweit es in ihrer Macht lag, nicht wieder geschehen sollte.