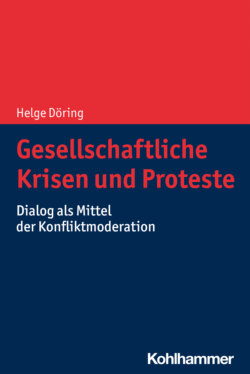Читать книгу Gesellschaftliche Krisen und Proteste - Helge Döring - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.3 Empirische Grundlagen zur Untersuchung von Krisenintervention durch Dialog und deren Ergebnisse
ОглавлениеBevor es in den Kapiteln 5 bis 8 zur Untersuchung von Krisenverläufen kommt, braucht es eine grundsätzliche Überlegung, inwiefern Dialogformate überhaupt in der Lage sind, Einfluss auf Krisenverläufe zu nehmen. Dass sie dies bewirken können, ist eine der Grundannahmen der Krisenverlaufstypologie, wobei ihre Reichweite theoretisch nicht abschließend bemessen werden kann. Dafür werden im Folgenden empirische Ergebnisse aus Expert*innenbefragung vorgestellt – mit dem Ziel, explorativ neue Erkenntnisse bezüglich des Einsatzes von Dialogformaten in Krisen zu gewinnen ( Kap. 9). Dazu wurden Expert*innen befragt, die in ihrer Arbeit regelmäßig Dialogveranstaltungen organisieren und/oder moderieren.
Anhand der später aufgeführten Fallstudien wird herausgearbeitet, welche Dialogformate in welcher Phase und in Kombination mit welcher Akteur*innenkonstellation sinnvoll erscheinen und wie diese auf die Teilnehmenden wirken. Darüber hinaus sollen Hinweise dafür gesammelt werden, warum Konflikte überhaupt vorliegen und mit welchen Maßnahmen sie beseitigt oder im Vorfeld unterbunden werden können. Realistisch betrachtet können sie zumindest abgeschwächt werden.
Die verwendeten semi-strukturierten Leitfadeninterviews bieten den Vorteil, dass die Befragten mit eigenen Worten, nach eigenem Ermessen und gemäß der individuellen Bedeutung von Themen relevante Informationen liefern können (Reinders 2016: 80–85). Um das Gesagte in ein Kategoriensystem einzubetten, wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016; 2018) verwendet, wobei die größte Herausforderung darin bestand, entlang der intersubjektiven Übereinstimmung möglichst eine hohe Reliabilität zu erzeugen. Es wurden zunächst Hauptkategorien in direkter Verbindung zu den zentralen Themen des Interviewleitfadens abgeleitet ( Anhang Interviewleitfaden). Die standardisierten Ergebnisse der Expert*inneninterviews stellen eine möglichst hohe externe Validität der Untersuchungsergebnisse sicher (Yin 2003: 133).
Die Interviews wurden als qualitative, mündliche und persönliche Einzelbefragungen durchgeführt (Lamnek 2010: 316). Zudem bietet das nicht-standardisierte Vorgehen die Möglichkeit, sowohl die Fragen als auch deren Reihenfolge situativ anzupassen. Es wurden nach Möglichkeit nur offene Fragen mit ermittelnder Intention gestellt und die Interviews wurden mit einer neutralen Einstellung durchgeführt. Die Kontaktaufnahme geschah zunächst via E-Mail, postalisch oder im späteren Verlauf telefonisch. Das Telefongespräch diente der Vereinbarung eines persönlichen Termins am Wunschort der Interviewpartner*innen.
In Vorbereitung auf die Interviews wurde ein themenspezifischer Gesprächsleitfaden entwickelt. Im jeweiligen Interview wurden entlang des Leitfadens offene Fragen gestellt, die der interviewten Person die Möglichkeit geben sollten, frei zu antworten und die eigene Perspektive in Form von selbstkonstruierten, subjektiven Sinnzusammenhängen wiederzugeben. Lediglich in dem Fall, dass die Interviewpartner*innen nicht sofort die Intention der Frage erkennen konnten, wurde konkreter nachgefragt oder Antwortbeispiele wurden vorgegeben (Gläser/Laudel 2010: 117 f.). So sollte den Gesprächspartner*innen die Möglichkeit gegeben werden, distanzierter, objektiver und damit offener über Herausforderungen und Probleme zu sprechen. Allen Ansprechpartner*innen wurde vorab nur das zentrale Leitthema des Interviews mitgeteilt, wobei die konkrete Fragestellung nicht erwähnt wurde, um die Interviewergebnisse nicht zu verzerren. Die Teilnehmenden wurden darüber informiert, dass eine Aufzeichnung des Gespräches notwendig sei. Die Interviews wurden per Audiorecorder aufgezeichnet und anschließend transkribiert (ebd. 2010: 193 f.).
Die Transkripte wurden in der Folge strukturiert und hinsichtlich der Forschungsfragen analysiert. In einigen Fällen kam es bei der Bearbeitung der Transkripte zu Nachfragen, die später per E-Mail oder Telefon geklärt wurden, so konnten einige der dargestellten Informationen noch einmal aktualisiert werden. Meist folgten die Interviews dabei folgendem Ablauf: Nach einer kurzen Darlegung der thematischen Einordnung und der Definition zentraler Begriffe wurden die Gesprächspartner*innen gebeten, sich vorzustellen und ihre Rolle zu umreißen. Danach wurden dem Leitfaden entsprechend die Fragen abgearbeitet, wobei nicht immer die Reihenfolge des Leitfadens eingehalten wurde und es häufig themenbezogene Anschlussfragen gab. Die Interviewten wurden dabei möglichst nicht unterbrochen und Nachfragen erst im Anschluss gestellt (Küsters 2009: 44 ff.).