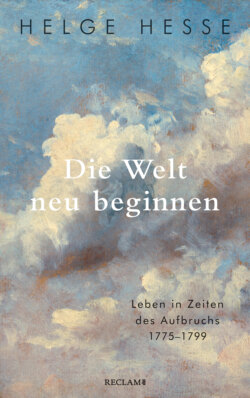Читать книгу Die Welt neu beginnen - Helge Hesse - Страница 11
Anstrengungen
ОглавлениеIn Gräben geduckt und hinter Böschungen verborgen warteten George Washington und seine Männer um den Jahreswechsel vor Trenton auf den Feind. Die Kälte krallte sich in ihnen fest und betäubte fast ihre Angst. Dank Spionen und Boten wusste Washington von drei Regimentern, die das Hauptquartier der Briten im 11 Meilen nordöstlich gelegenen Princeton im Morgengrauen des 2. Januar verlassen hatten. Weitere Truppen stießen hinzu. Schließlich griffen etwa 6000 Briten und Hessen die etwa 5000 verschanzten Amerikaner an.
Der Ausgang dieser zweiten Schlacht von Trenton stand lange auf Messers Schneide. Als die Reihen seiner Männer schwankten, preschte Washington auf seinem Schimmel in die vorderste Linie und begann, sie lautstark zu ordnen. Der Feind nahm ihn unter Beschuss. Zahlreiche Männer um ihn herum fielen, doch er blieb wie durch ein Wunder verschont. »Der Tag ist der unsere!«, rief er. Die Briten zogen sich zurück. Washington konnte einen strategischen Sieg verbuchen.
In der Nacht entschied er, mit seiner Armee nach Princeton weiterzuziehen. Schon am Morgen des 3. Januar erreichte er die Stadt. Nach kurzem Gefecht konnte er die britische Garnison einnehmen und die meisten britischen Soldaten gefangen nehmen.
Die britische Armee zog sich nach dieser dritten Niederlage binnen 10 Tagen aus New Jersey nach New York zurück. In der Kontinentalarmee hingegen stieg die Zuversicht. 8000 neue Freiwillige meldeten sich. Sie wollten für die Freiheit kämpfen.
Was die Deutschen für die Freiheit zu tun bereit seien, darüber machte sich der junge Goethe derweil in einem Theaterstück lustig: »beim Glase Wein« sprächen sie mutig für die Freiheit, doch »wenn der Morgen kam, ging eben keiner hin«. So heißt es im Lustspiel Die Mitschuldigen, das in Weimar am 9. Januar erstmals auf die Bühne kam. Goethe hatte es bereits 1768 im Alter von 19 Jahren geschrieben.
Nun in Weimar hatte er das Angebot der Herzogin Anna Amalia, in ihrem Liebhabertheater mitzuwirken, nicht abschlagen können. Zuerst spielte er nur mit, bald aber schon leitete er die höfische Laienspielgruppe, in der neben den Hofbeamten und Hofdamen sogar der Herzog und sein Bruder auftraten.
Liebhabertheater waren zwar en vogue, aber üblicherweise eben nur eine Tätigkeit zur Unterhaltung und Zerstreuung nebenbei. In Weimar allerdings gestaltete sich die Situation speziell. Dort hatte der Brand des Schlosses zwei Jahre zuvor das Hoftheater zerstört, und so bestand das Programm seitdem im Wesentlichen nur aus eigenen Auftritten des Hofes, also aus jenem Liebhabertheater. Das war doppelt bitter, da es im Trend der Zeit lag, mit Theaterbauten und mit professionellen Ensembles zu protzen.
Um das Niveau zu heben, kam also Goethe gerade recht. Der wählte leicht einzuübende Stücke aus eigener Feder. Neben bereits vorhandenen wie Die Mitschuldigen verfasste er bald weitere heitere Einakter. Oft übernahm er selbst eine Rolle. An diesem Abend notierte er in sein Tagebuch: »Die Mitschuldigen, schlecht gespielt« – er selbst hatte die Hauptrolle übernommen.
In Thomas Paines Mitte Januar erschienenem zweiten Crisis-Pamphlet hatte der junge Staat einen Namen: Vereinigte Staaten von Amerika. Das ließ später viele vermuten, Paine habe den Begriff erfunden. Zweifellos hat er zu dessen Popularisierung beigetragen.
Das früheste bekannte Dokument, in dem der Begriff »Vereinigte Staaten von Amerika« erscheint, ist ein Brief vom 2. Januar des Vorjahres, von einem Angehörigen des Stabes von George Washington. Ein gewisser Stephen Moylan teilte seinem Stabskameraden Joseph Reed mit, er wolle »mit umfassenden Vollmachten von den Vereinigten Staaten nach Spanien gehen, um fremde Hilfe für die Sache zu suchen.«
Womöglich war der Begriff lange zuvor in irgendeiner Gesprächsrunde geboren worden, vielleicht sogar als Idee George Washingtons, wie es manche gerne glauben.
Nach der Fahrt durch einen schweren Sturm, bei der ein Mast gebrochen war, traf James Cook am 24. Januar weit im Süden des Erdballs in Tasmanien ein. Zahlreiche Reparaturen standen an. Cook blieb zwei Wochen. Längst hatte er dem jungen William Bligh die Vermessung zahlreicher Küsten anvertraut. Angetan von dessen kartographischen und navigatorischen Fähigkeiten, erwähnte ihn Cook, der wie Bligh Autodidakt im Kartenzeichnen war, oft im Logbuch. Nach Instandsetzung der Schiffe nahm Cook Kurs auf Neuseeland.
Ende Januar berief George Washington den jungen Alexander Hamilton in seinen Stab, so teilte es der Pennsylvania Evening Post vom 25. Januar der Leserschaft mit. Washington weilte mit seinen Truppen in New Jersey in dem strategisch günstig gelegenen Örtchen Morristown im ersten Winterlager des Krieges.
Brillant, jung, ehrgeizig – Hamilton erfüllte genau die Anforderungen, die Washington an seine jungen Stabsoffiziere stellte. Ob Hamilton in jenen Tagen 20 oder 22 Jahre alt war, wusste man nicht so recht. Geboren als unehelicher Sohn eines verarmten Adeligen aus Schottland und einer verheirateten Frau auf der karibischen Insel Nevis, hatte er, als Kind allein nach New York gekommen, schon als etwa 12-Jähriger im Büro eines Reeders gearbeitet und dort bereits drei Jahre später die Frachtrouten geplant. Gleich nach den Gefechten von Lexington und Concord war er einer Artillerieeinheit der Milizen beigetreten und rasch durch seine Tatkraft aufgefallen. Nahezu alle Porträts aus seinen verschiedenen Lebensaltern zeigen einen Mann mit festem selbstbewusstem Blick, schmalen Gesicht, energischem Mund, ausgeprägtem Kinn und einer hohen Stirn, Letztere vermutlich, im Wissen um die eigenen Talente, voll hochmütiger Gedanken.
Cook traf am 12. Februar in Neuseeland ein und war überrascht, wie sehr die Maori erschraken. Sie vermuteten, er komme, um Rache zu nehmen, denn während Cooks zweiter Reise hatten zehn Männer des Begleitschiffs Adventure, das damals zwischenzeitlich von der Resolution getrennt segelte, bei Kämpfen ihr Leben verloren. Ein Matrose der Adventure hatte damals wohl eine Regel der Kultur gebrochen. »Tabu«, das polynesische Wort für derlei Verbote, gelangte durch die Reisen Cooks nach Europa. Nun versuchten die Maori, Cook dazu zu bewegen, andere Dörfer anzugreifen und zu vernichten. Der zeigte sich befremdet und wunderte sich über diese Abgründe des Menschseins der vermeintlich »edlen Wilden«.
Als Cook Ende Februar wieder aufbrach, blieb die Reise beschwerlich. Es herrschte Flaute, Cook kam nur langsam voran. Er musste die Rationen kürzen. Die Mannschaft murrte. Zudem zog die Resolution bedenklich Wasser. Schon kurz nach der Abreise aus England hatte sich herausgestellt, dass man vor allem beim Kalfatern, dem Abdichten der Fugen zwischen den Schiffsplanken, geschlampt hatte.
Cook beschloss, das heutige Tonga anzulaufen, das er auf der zweiten Reise »Friendly Islands« genannt hatte. Anfang Mai erreichte er Nomuka. Auf Tongatapu blieb er dann einen Monat. Man gab ihm Hinweise auf weitere größere Inseln, auf Samoa und die Fidschi-Inseln. Doch anders als zuvor ging er ihnen nicht nach. Cook war erschöpft und unter Zeitdruck. Auf Diebereien der Einwohner antwortete er mit teils überzogener Grausamkeit, und so steckte hinter dem, was Cook selbst im Logbuch »einige nebensächliche Differenzen« nannte, manch grauenvolle von ihm angeordnete Bestrafung – wie das Abschneiden von Ohren oder das Einstechen auf davonschwimmende Diebe. Gerne nahm er Häuptlinge als Geiseln, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Mitte Juli setzte er Segel. Das Ziel war Tahiti.
In Morristown ordnete Washington im März an, alle seine Soldaten gegen die Pocken impfen zu lassen. Die Krankheit dezimierte seine Armee unablässig. In diesen Tagen führte man die Impfung noch über die Methode der Variolation durch. Man ritzte abgeschwächte Erreger aus den Pusteln Infizierter, um damit eine Immunität zu erzeugen. Dies konnte zwar erhebliche Nebenwirkungen haben, doch schien das besser zu sein, als nichts zu unternehmen. In der Tat hatte Washington Erfolg mit der Maßnahme, obwohl einige Soldaten an den Nebenwirkungen verstarben. Manche Stimmen meinen bis heute, mit seiner Impfmaßnahme habe Washington mehr bewirkt als mit seinen militärischen Leistungen.
Da Georg Forster mit seinem Buch über Cooks vorherige Reise der Erste sein wollte und musste, war neben Sorgfalt auch Eile geboten. Nach acht Monaten des Raubbaus an allen seinen Kräften erschien am 17. März die englischsprachige Ausgabe von Eine Reise um die Welt; ein Monument von über 1000 eng bedruckten Seiten.
Parallel hatte Forster schon mit der deutschen Übersetzung begonnen. Da seine Deutschkenntnisse nach Jahren der Abwesenheit ein wenig eingerostet waren, kam ihm die Hilfe des nach England geflohenen Bibliothekars Rudolf Erich Raspe gerade recht. Raspe kam später als Bearbeiter der Münchhausen-Abenteuer zu einem gewissen Ruhm. Derweil aber suchte man ihn in Deutschland steckbrieflich wegen Unterschlagung.
Der deutschen Ausgabe stellte Forster eine Widmung an Friedrich II. von Preußen voran, die zu einer Huldigung des Aufklärers auf dem Thron geriet; vermutlich auch mit der Absicht, so einen Weg für eine künftige Anstellung in Preußen zu ebnen. Nach Abschluss der Arbeit an der deutschen Ausgabe fiel Forster in ein Loch. Er las den Werther erneut; gleich zwei, drei Mal hintereinander.
Wenn Louis seine Frau im Petit Trianon besuchen wollte, musste er sich zuvor anmelden. Im Versailler Schloss schliefen er und Marie Antoinette in getrennten Gemächern. Wollte er sie besuchen, was ihm selten einfiel, setzte er sich auf dem Weg durch lange Gänge den Blicken der Hofschranzen aus. Die sahen dann meist, wie er rasch unverrichteter Dinge zurückkehrte, da die Gattin ihren Vergnügungen außer Haus nachging; bei einem Ball, in der Oper oder beim Kartenspiel.
In Wien verfolgte man schon zu lange aus der Ferne die eheliche Unbedarftheit des Königspaars. Bislang hatte es Maria Theresia trotz der Besorgnis erregenden Berichte ihres »Spions«, des Grafen von Mercy-Argenteau, der in Versailles für Österreich Augen und Ohren offenhielt, bei brieflichen Ermahnungen an die Tochter belassen, zumal sie nicht wusste, ob Mercy übertrieb, um seine eigene Bedeutung zu betonen. Nun aber schien konkrete Gefahr in Verzug: Die junge, hübsche Herrscherin umgab sich zunehmend mit leichtsinnigen Jünglingen. Die Neckereien, wie man berichtete, nahmen zu. Sie errötete, erbleichte und lachte nun auffällig oft. Und die Briefe der Tochter nach Wien und ihre Taubheit für alle Mahnungen der Mutter dämpften die Sorgen keinen Deut.
Es schien also ratsam, dass Marie Antoinettes großer Bruder, als Joseph II. seit Jahren Mitregent Maria Theresias, nach seiner Schwester sah. Der hielt sie für ein liebenswertes Spatzenhirn und hatte sie bereits dafür gerüffelt, sich in die französischen Regierungsangelegenheiten eingemischt zu haben. Joseph brach auf. Im besten Falle könnte er seinem Schwager einige Ratschläge bezüglich seiner ehelichen Pflichten geben. Denn noch immer war die Ehe nicht vollzogen.
Am 19. April traf Joseph in Versailles ein, 14 Jahre älter als seine Schwester. Energisch seiner selbst gewiss, doch permanent darunter leidend, im Schatten seiner übergroßen Mutter zu stehen, kam ihm die Reise gerade recht, um sich selbst mal wieder ins beste Licht zu stellen. Er hatte seit langem das Inkognito als Propagandawaffe entdeckt und feilte damit an seinem Ruf als bescheidener und sich kümmernder Herrscher. Gerne mischte er sich unerkannt unter das Volk, erschien plötzlich in Armenküchen oder auf dem Feld bei einem Bauern. Auch jetzt, für seine Reise nach Frankreich, hatte er sich einen falschen Namen zugelegt. Doch Schillers Landesvater Carl Eugen bekam davon Wind und spielte ihm einen Streich. Er ließ alle Schilder der Gasthäuser abhängen, so dass Joseph schließlich doch bei ihm im Schloss Logis nehmen musste.
In Frankreich blieb Joseph etwa fünf Wochen und beeindruckte am Hofe, anders als seine Schwester, durch seine weltläufige und leutselige Art. Joseph tat sich um, beobachtete und besichtigte und sah so in seiner kurzen Zeit in Frankreich vielleicht mehr von Land und Leuten als seine Schwester und sein Schwager, die an ihrer Spitze standen.
Viel Zeit widmete Joseph jener Aufklärung, die seine Schwester und sein Schwager bislang in zu geringem Maße genossen hatten. Was den Akt der Liebe betraf, hörte er zu, gab Ratschläge; und er drängte. An seinen Bruder Leopold berichtete er am 9. Juni freimütig die intimsten Details, wie sich Louis, der sich ihm anvertraut hatte, im Bett mit seiner Frau verhielt: »Was meine Schwester betrifft, ist sie auch nicht gerade sinnlich veranlagt, und beide zusammen sind ein Paar von ausgemachten Stümpern.«
In Versailles selbst wusste man wenig, aber tratschte viel. Manche meinten, es liege an Louis, er habe ein körperliches Problem, andere glaubten, er sei zu schüchtern. Viele meinten, es liege an der lieblosen Marie Antoinette, die ihm gar nicht erst die Gelegenheit zur Intimität gebe. Ihre zahlreichen nächtlichen Vergnügungen, so tuschelten einige, beschränkten sich bestimmt nicht nur auf Kartenspiel und Bälle. Sie entziehe sich.
Louis und Marie Antoinette waren über die konkreten Schwierigkeiten beim Ehevollzug hinaus im wahrsten Sinne des Wortes so verschieden wie Tag und Nacht. Louis liebte den Tag, vor allem die Jagd, die oft am frühen Morgen begann. Marie Antoinette die Nacht. Zudem ließen sie jene Dinge kalt, die ihren oft so behäbig erscheinenden Gatten mit Leidenschaft und Energie erfassten. In der Tat widmete sich Louis mit großer Freude vor allem der Jagd und allerlei handwerklichen Arbeiten. Seine Gattin kommentierte nur, sie werde wohl kaum eine gute Figur in seiner Schmiede, in der er sich in Versailles oft aufhielt, abgeben.
Louis’ Schwager Joseph, der gerne jeden um sich herum herabsetzte, kam nach den gemeinsamen Gesprächen immerhin zu dem Urteil, Louis sei träge und schwach, aber nicht dumm. Josephs eheliche Ratschläge schienen schon bald zum Erfolg zu führen. Mitte August berichtete Marie Antoinette ihrer Mutter, ihr Gatte werde zärtlicher, was für ihn viel heiße. Dann am 30. August in einem weiteren Brief an die Mutter: »Ich bin im größten Glück meines Lebens. Es ist schon mehr als acht Tage her, dass meine Ehe perfekt vollzogen wurde; das Ereignis ist wiederholt worden, gestern vollständiger als das erste Mal.«
Während Louis und Marie Antoinette in Versailles immer entschlossener versuchten, eine Schwangerschaft herbeizuführen, ließ Louis’ Landsmann, der 19-jährige Kavallerieoffizier Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, seine schwangere Frau Adrienne zurück und machte sich auf den Weg nach Amerika. Mit einer selbst zusammengestellten kleinen Freiwilligentruppe bestieg er ein auf eigene Kosten ausgerüstetes Schiff. Das ausdrückliche Verbot Louis’ XVI., der Verwicklungen mit Großbritannien fürchtete, schlug er in den Wind.
Obwohl er noch nicht die geringste Gefechtserfahrung hatte, wollte Lafayette mit George Washington für die Freiheit kämpfen. Es war, als würde Washington, der nie selbst Vater wurde, nach und nach Ersatzsöhne um sich scharen. Hamilton hatte im Februar den Anfang gemacht. Mit Lafayette trat ein zweiter auf die Bühne; nicht minder schillernd.
Hätten Schiller oder Goethe in der Politik ihrer Zeit einen Helden für ein Bühnenstück des Sturm und Drang gesucht, sie wären in Lafayette fündig geworden. Der aus altem französischem Adel stammende hochgewachsene Rotschopf mit durchdringenden Augen erwies sich, obwohl belesen und redegewandt, schon früh weit weniger als ein Mann der Worte und Bücher als einer der Gesten und Taten. Er übertrug seine Leidenschaften in die Politik und gab ihr etwas Schwärmerisches.
Früh Vollwaise geworden, hatte Lafayette ein solch großes Vermögen geerbt, dass er nun als einer der reichsten Männer Frankreichs galt. Schon mit 14 Jahren wurde er der zwei Jahre jüngeren Bankierstochter Adrienne de Noailles durch Arrangement der Familien für die Ehe versprochen. Daraufhin hatte er zwei Jahre im Stadtpalais der Noailles gewohnt, wo der Bräutigam in spe schicklich weit entfernt von der künftigen Braut untergebracht wurde und Mutter Noailles auch ansonsten auf den gebotenen Anstand achtete. Mit 16 Jahren nahm er schließlich die 14-jährige Adrienne zur Frau.
Die Familien führten die Kinder in Versailles ein. Dort tummelte sich Lafayette bald in einer Kartenspielgemeinschaft, der auch die junge Königin angehörte. Während sich Adrienne mit Marie Antoinette anfreundete, gab Lafayette den Versuch, bei Hof zu reüssieren, rasch auf. Seine Freiheit bedeutete ihm weit mehr.
Lafayette wollte in den Kampf gegen England ziehen. Sein Vater hatte einst in der Schlacht von Minden gegen die Engländer sein Leben gelassen; wie zuvor auch andere Familienangehörige in der Generationen überdauernden Fehde der beiden Nationen. Lafayette hoffte zudem, wie viele junge französische Adelige, den Aufbruch in eine neue Gesellschaft zu erkämpfen – und dies am besten in Amerika, wo es zugleich gegen den Erzfeind England ging. Seiner Frau Adrienne hatte er zum Abschied geschrieben, das Wohl Amerikas sei verbunden mit dem Wohl der Menschheit. »Adieu!«.
Nicht nur Washington schaute skeptisch auf die eintreffenden jungen französischen Adeligen, die oft glaubten, die vermeintlichen amerikanischen Bauern in allem belehren und sofort General werden zu können. Viele der Amerikaner nannten sie Söldner oder Friseure. Mit Lafayette aber kam ein anderer. Ihm ging es um den Kampf. Der Rang bedeutete ihm wenig.
Zum ersten Mal begegneten sich George Washington und Lafayette, der seine Reise über den Atlantik mit schwerer Seekrankheit hatte bezahlen müssen, am 31. Juli. Sie wurden sich bei einem Dinner in der City Tavern in Philadelphia vorgestellt, einem zweistöckigen Gasthaus aus rotem Backstein, in dem Thomas Jefferson oft speiste und das John Adams »das vornehmste in Amerika« nannte.
Der in der Runde etwas verloren herumstehende junge Mann war tief beeindruckt, als er Washington zum ersten Mal sah. Noch höher gewachsen als er selbst, überragte der die Uniformierten, die ihn umgaben. Aber nicht nur durch Körpergröße, sondern auch durch seine majestätische Ausstrahlung stach er heraus. Washington lud Lafayette ein, gleich am nächsten Tag sein Hauptquartier zu besuchen und mit ihm die Stellungen am Delaware zu inspizieren. Als der am nächsten Morgen den zerlumpten Haufen zu Gesicht bekam, machte Washington die Bemerkung, sich im Grunde schämen zu müssen, diese Truppe einem Mann zu präsentieren, der aus der französischen Armee komme. Lafayette entgegnete: »Ich bin nicht hier, um zu belehren, sondern um zu lernen.«
Das war ein anderer Tonfall als der, den Washington und seine Männer von Außenstehenden aus Europa kannten. Schon bald machte das Wort von Lafayettes Bescheidenheit in der Truppe die Runde.
Am 12. August erreichte James Cooks Expedition Tahiti. Wenige Tage zuvor hatten er und seine Männer als erste Europäer das Atoll Tubuai entdeckt, waren aber nicht an Land gegangen. Zwölf Jahre später sollte dieses Fleckchen Land für die Meuterer der Bounty eine wichtige Rolle spielen. Dies auch und gerade, weil William Bligh in diesen Tagen mit Cook dessen Lage notierte. Bligh zeigte sich mittlerweile so oft an der Seite seines Kapitäns, dass die Einwohner die beiden für Vater und Sohn hielten.
Auf Tahiti setzte Cook einen jungen Tahitianer ab, der in England die Reise mit angetreten hatte. Omai, Sohn eines Landbesitzers auf einer Nachbarinsel, war nach dem Tod seines Vaters nach Tahiti geflohen. Im September 1773 hatte ihn Cook auf seiner zweiten Reise an Bord der Adventure genommen, wo er die Bekanntschaft der beiden Forsters machte, bald ein vollwertiges Besatzungsmitglied wurde und mit nach England reiste. Dort nahm sich Joseph Banks seiner an und reichte ihn in höchsten Kreisen als »Prinz« herum. Mit seiner guten Erscheinung, seinem freundlichen, aufgeschlossenen Wesen und seiner schnellen Auffassungsgabe galt Omai als Sinnbild des zugleich unschuldigen und vornehmen »edlen Wilden«, wie ihn Joshua Reynolds, der neben Thomas Gainsborough große Porträtmaler im England dieser Zeit, auch in Öl festhielt. Omai dinierte in der Royal Society, bei Lord Sandwich und wurde sogar von König George empfangen. Nun zurück in seiner Heimat, ließ er sich auf Huahine nieder, wo ihm die Engländer ein Haus bauten.
Im Sommer reiste James Watt zu der Chacewater Mine in Cornwall. Was er sah, entsetzte ihn. Er blickte über eine trostlose Wüste aus Abraumhalden. Kaum ein Baum stand noch. Hier und da standen Schuppen und Verschläge verloren herum, oder es ragten schwarze Maschinenhäuser in den grauen Himmel. Immer tiefer trieb man die Schächte in die Erde, warf allen Unrat und Abraum in die Landschaft. Die Arbeiter schufteten unter grausamen Bedingungen und lebten in erbärmlichen Verhältnissen. Die einen gruben in die Tiefe und erhielten ihren kargen Lohn nach den erreichten Längen. Die anderen holten Zinn und das noch tiefer zu findende Kupfer aus der Erde. Auch sie erhielten ihr Geld von den Grubenbetreibern nur nach ihrer Ausbeute. Ihre Ausrüstungen mussten die Arbeiter zudem selbst bezahlen.
Hier in dieser frühen Hölle der Industrialisierung, in der schon seit den 1720er Jahren Newcomen-Maschinen arbeiteten, stellten Boulton und Watt nun ihre neuen Maschinen auf. Watt hoffte, dies könne auch zu besseren Bedingungen beitragen.
Bei der Einrichtung der Maschinen in Cornwall erwies sich der neue Mitarbeiter William Murdoch als Glücksgriff. Watt und Boulton hatten nach einem Mann gesucht, der Watt entlasten und im besten Falle auch neue Ideen beitragen konnte. Nachdem viele Bewerber Watts strengen Anforderungen nicht standgehalten hatten, fand man schließlich in Watts schottischem Landsmann Murdoch einen kongenialen Helfer, der Boulton bei der ersten Begegnung auch durch den selbst angefertigten Hut aus Holz beeindruckte, den er beständig in den Händen drehte. Murdoch entwickelte sich rasch zu der dritten treibenden Kraft des gesamten Unternehmens und bereicherte es mit zahlreichen Verbesserungen, aber auch mit völlig neuen Erfindungen.
In Versailles zeigte sich die Welt im satten Grün weiter Parks. Unter weißen Schirmen glitten Marie Antoinette und ihre Hofdamen über die Wege und ließen Licht und Schatten auf ihren Kleidern spielen. Doch hinter jedem Lächeln, in jedem wie beiläufig gesetzten Satz focht jede Seele einen höfischen Existenzkampf, der jedem anderen meist verborgen blieb. Kein Wunder, dass es oft an Kraft fehlte, den Blick noch auf die Welt dort draußen zu heften.
Joseph aber sah Gefahren. Er hatte seiner Schwester zum Abschied seitenlange Ratschläge übergeben, sie gedrängt, auf die Wirkung ihres Tuns zu achten, und gemahnt, sie werde älter und habe nicht mehr die Entschuldigung, ein Kind zu sein.
Ein Kind zu sein und sich zugleich behaupten zu müssen ist schwer. In Salzburg lebte derweil, wenn er nicht gerade reiste, ein junges Genie, das auch kein Kind mehr war, sich aber meist so gebärdete. Das sollte während seines kurzen Lebens auch nie aufhören. Wolfgang Amadeus Mozart, von dem die Rede ist, war 21 Jahre alt. Getauft als Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, hatte er den Theophilus als 14-Jähriger während eines Aufenthalts in Italien in das italienische Amadeo übersetzt. Nun nannte er sich bevorzugt Amadé oder Wolfgang Amadé. In der Musik gelang ihm nahezu alles, im Leben aber blieb er weit mehr in der Rolle eines unbedarften Schülers stecken als andere Menschen.
Seine fünf Jahre ältere Schwester Maria Anna, das »Nannerl«, und er überlebten als einzige von sieben Kindern des Violinisten Leopold Mozart und seiner Frau Anna Maria die Kindheit. Früh beobachteten die Eltern, wie sehr es »das Wolferl« zur Musik zog und welch geradezu unheimliche Begabung das Kind dafür besaß. Das Klavier musste man ihm eher vorenthalten als ihn zum Üben zwingen. Als Sechsjähriger schuf er bereits Kompositionen. Unter der Obhut des Vaters sorgte er mit Nannerl, auch sie eine hochbegabte Pianistin, auf Konzertreisen im deutschsprachigen Raum und bald auch in Westeuropa für Aufsehen an den Höfen und in den Konzertsälen.
Der 14-jährige Goethe hatte dem siebenjährigen Mozart einst in Frankfurt am Main gelauscht und erinnerte sich später noch »des kleinen Mannes in seiner Frisur und Degen«. Der hatte mit 13 Jahren eine erste besoldete Stelle in der Hofkapelle des Fürsterzbischofs von Salzburg Hieronymus von Colloredo angetreten, in der Vater Leopold zum Vizehofkapellmeister befördert wurde. Salzburg aber erwies sich für die weiteren Ambitionen und das Auskommen der Familie bald als zu eng und zu klein.
Die zur Aufbesserung der Familienkasse ständig unternommenen Konzertreisen führten zu Konflikten mit dem Fürsterzbischof. Der sah weniger das Genie als den von sich selbst eingenommenen und immer überheblicheren jungen Mann und dessen Launen. Als Vater Leopold im März um mehr Gehalt bat, kam keine Antwort. Ein Gesuch, erneut reisen zu dürfen, wurde abgelehnt. Der Sohn aber dürfe sich gerne auf den Weg machen. Im August wandte sich dann Wolfgang selbst in einem Brief an den Dienstherrn und bat selbstbewusst um seine Entlassung. Er werde sein Glück in der Ferne suchen. Der Fürsterzbischof gewährte sie, entließ aber den Vater gleich mit. Die Mozarts standen unter Schock. Der Vater bat um Entschuldigung und Wiedereinstellung und wurde schließlich erhört. Doch Leopold wusste, er musste nun am Ort bleiben. Der unreife Sohn aber musste sein Glück in der Ferne suchen.
Während Marie Antoinette und Mozart, die einst im Schloss Schönbrunn als Kinder gemeinsam Klavier gespielt haben sollen, noch etwas kindlich Ungestümes auslebten, hatte in Württemberg ein 18-Jähriger nahezu alles abgestreift, was je in ihm Kind gewesen war. Vielleicht würde er auch deshalb später über den Zauber des Spielens nachdenken. Aber das lag noch in weiter Zukunft.
In Friedrich Schiller tobte das Sendungsbewusstsein eines Jugendlichen, der den Ernst des Erwachsenenlebens ahnte, aber vieles anders machen wollte als vorangegangene Generationen. Die Welt musste eine bessere werden. Mit diesem vielleicht ihm selbst noch nicht im ganzen Ausmaß bewussten Willen arbeitete der Medizinstudent insgeheim an den ersten Szenen eines Dramas. Umgeben von medizinischen Büchern, die er schnell greifen konnte, um die Blätter des Manuskripts zu verdecken, schuftete er die Nächte durch. Manchmal stellte er sich krank, um seine Zeit jener Arbeit widmen zu können, die ihm nun das Wichtigste schien.
Im September beendete Georg Forster die Arbeit an der deutschen Ausgabe seines Reiseberichts. Am 2. Oktober brach er nach Dieppe auf. Erstmals reiste er ohne den Vater. Zuerst nahm er die Postkutsche nach Brighthelmstone und durchlitt bei der Überfahrt nach Frankreich schreckliche Seekrankheit. Vier Tage später traf er in Paris ein, wo man ihn mit offenen Armen und großem Interesse empfing. Er lernte den ersten französischen Weltumsegler Louis Antoine de Bougainville kennen, dessen Reisebericht er, damals gerade 17-jährig, kurz vor der Abreise mit Cook übersetzt hatte. Er traf den Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon. Vor allem aber machte er Bekanntschaft mit dem von ihm tief verehrten, nun 70-jährigen Benjamin Franklin, der ihn nach Passy einlud, wo Georg mit ihm tafelte, Franklins umfangreiche Bibliothek durchstöberte und wohl mehrfach längere Zeit mit ihm plauschte.
In Franklins Heimat ein Wendepunkt! Und das nach einer Kette weiterer schwerer Rückschläge für Washington und seine Männer. Dazu gehörte auch die am 11. September verlorene Schlacht am Brandywine. Lafayette wurde von einer Kugel ins Bein getroffen. Doch bevor er seine Wunde versorgen ließ, hatte er noch die Truppen gesammelt und den geordneten Rückzug mitgeleitet, woraufhin der beeindruckte Washington Lafayette für das Kommando über eine Division vorsah.
Washingtons Gegner am Brandywine, General Howe, behauptete nach der Schlacht, nur die einbrechende Nacht habe seinen Gegner vor der vollkommenen Vernichtung bewahrt. Allerdings gehörten schnelle geordnete Rückzüge längst zu Washingtons Taktik, so auch diesmal. Davon abgesehen hatte sich aber wieder gezeigt, dass die britische Armee weit effektiver manövrierte und es Washington schwerfiel, eine Truppe in einer großen, fast unübersichtlichen Feldschlacht zu führen.
Den Wendepunkt dieser Tage, vielleicht des ganzen Krieges, führte nicht Washington selbst herbei, sondern sein General Horatio Gates. Der hatte es mit dem britischen General John Burgoyne zu tun bekommen, was in den zwei Schlachten von Saratoga etwa 200 Meilen nördlich von New York gipfelte, dem Höhepunkt des später so genannten Saratoga-Feldzugs der Briten. Burgoyne wollte mit einer Armee aus dem gerade gesicherten Kanada die amerikanische Streitmacht teilen und Neuengland vom Rest der Staaten abtrennen. Zunächst siegte er in der Schlacht von Ticonderoga am 5. und 6. Juli. Doch dann musste er nach zwei Schlachten am 19. September und am 17. Oktober vor Gates kapitulieren. Alle Waffen der Briten gerieten in die Hände des Feindes, fast 6000 Soldaten gingen in Gefangenschaft.
Washington gab indessen am 4. Oktober in der Schlacht von Germantown einen möglichen Sieg aus der Hand. Im aufkommenden Nebel schossen seine Männer aufeinander und ermöglichten damit den Briten, sich neu zu sammeln. Washington wollte danach die Schlappe überspielen, schönte in Berichten Gefallenenzahlen und schickte den Hund von Howe, einen Terrier, der kurz nach der Schlacht zu den Amerikanern gestromert war, gefüttert, gewaschen und gestriegelt mit großer Geste zurück zum Feind.
An dem Sieg von Saratoga störte Washington, ihn nicht selbst errungen zu haben und ausgerechnet Gates als Held der Stunde ertragen zu müssen. Der gehörte wie Washington und Charles Lee zu den Überlebenden der verheerenden Schlacht am Monongahela im Siebenjährigen Krieg. Gates, mit seinen 50 Jahren fünf Jahre älter als Washington, bemängelte wie Lee zunehmend Washingtons Taktik in diesem Krieg. Nach Washingtons Misserfolg von Germantown und Gates’ Sieg von Saratoga stand erneut die Frage im Raum, ob tatsächlich der beste Mann den Oberbefehl führte.
Washington wusste um das Gerede im Kongress und unter einigen Offizieren. Zudem darüber verstimmt, dass Gates ihn nicht in einem persönlichen Bericht informiert hatte, handelte er nun machtsichernd. Er schickte Alexander Hamilton zu Gates nach Albany. Der holte einen großen Teil von dessen Truppe wieder zurück zu Washingtons Armee. Es gab keine Zweifel, wer der Oberbefehlshaber war.
In Salzburg hatte sich Mozart am 23. September in Begleitung seiner Mutter auf die Reise gemacht. Seine Eltern hätten ihn ungern allein losziehen lassen. Schweren Herzens blieb der gesundheitlich angeschlagene Vater, zudem in der Pflicht beim Erzbischof, mit Tochter Nannerl zurück. Die litt wie er. Für die Reise von Frau und Sohn hatte Vater Mozart Schulden bei einem Freund aufgenommen. Begleitet von mit Ratschlägen und Nachfragen vollgestopften Briefen des Vaters, reisten Mozart und Mutter zunächst nach München, danach nach Stuttgart. Doch ohne Erfolg. Am 30. Oktober trafen sie im 25 000 Einwohner zählenden Mannheim ein.
Mozart war kein Wunderkind mehr, aber auch noch kein Mann. Der Bartwuchs ließ zu wünschen übrig, besonders ansehnlich konnte man ihn auch nicht nennen. Aus dem einst hübschen Kind war ein klein gewachsener bleicher Jüngling geworden, mit großem Kopf, einem von Pockennarben übersäten Gesicht, einem fliehenden Kinn und einer breiten Nase, weshalb er sich lieber in Profil oder Halbprofil porträtieren ließ.
In Mannheim spielte, gefördert und finanziert von Kurfürst Carl Theodor, eines der besten Orchester der Zeit. Mozart würde im Jahr darauf als einer der Ersten von einer »Mannheimer Schule« sprechen. Er besuchte Proben und Konzerte des Hoforchesters und spielte am 6. November selbst bei der »Gala-Academie« vor Kurfürst Carl Theodor, vor dem er schon einst als siebenjähriges Wunderkind gespielt hatte. Der Kurfürst empfing Mozart tags darauf, vermittelt durch den Geiger Johann Christian Cannabich, den Kapellmeister des Mannheimer Hoforchesters.
Mozart durfte öfter für den Kurfürst spielen. Der setzte sich gerne neben ihn an das Klavier und bestaunte den Tastenzauber. Zu einer Anstellung des Musikus rang er sich aber nicht durch. Mozart spielte vor den unehelichen Kindern Carl Theodors, fertigte Klaviervariationen für ihren Unterricht an, doch auch die Stelle des Klavierlehrers bot ihm Carl Theodor nicht an. Der Kurfürst liebte das Flötenspiel. Mozart widmete ihm das später berühmte Flötenkonzert. Selbst das half nicht.
Dafür aber schloss Mozart in Mannheim Freundschaften, vor allem mit dem Flötisten Johann Baptist Wendling und mit dem schon erwähnten Cannabich, der ihn unablässig unterstützte und in dessen Töchter Rose (Rosine) und Liesl sich Mozart prompt verliebte. Rose, die sich schließlich zu einer anerkannten Pianistin entwickeln sollte, gab er Unterricht und widmete ihr eine Klaviersonate.
Am 17. Dezember erging Washingtons Befehl an seine Männer, an einem kleinen Ort in Pennsylvania namens Valley Forge Winterquartier zu beziehen. Er hatte alle wissen lassen, er selbst werde »alle Unannehmlichkeiten mit durchstehen«. Am 19. Dezember führte er seine Armee auf das vorgesehene Gelände, und man begann mit dem Aufbau des Lagers.
Einen Monat zuvor, am 15. November, hatte in Philadelphia der Zweite Kontinentalkongress die sogenannten Konföderationsartikel verabschiedet und damit den Bund der 13 Kolonien als für alle Zeiten geschlossen erklärt. Der Kontinentalkongress sei nun zuständig für Handelsverträge mit anderen Staaten, für Maße, Gewichte, das Postwesen, das Geld und die Fragen von Krieg und Frieden. Doch die Verhältnisse der Staaten untereinander blieben ungeregelt. Auch wie dieser Kontinentalkongress und seine Exekutive beschaffen sein sollten und welche Befugnisse ihnen in ihrem Verhältnis zu den Einzelstaaten des Bundes zu gewähren seien, blieb offen. Die nun beginnende Ratifizierung durch die 13 einzelnen Staaten sollte erst nach drei Jahren abgeschlossen werden, die Konföderationsartikel erst am 1. März 1781 in Kraft treten.
In Valley Forge baute man kleine Blockhütten. In jeder von ihnen drängten sich auf engstem Raum ein Dutzend Soldaten, vor allem junge Männer der ärmsten Teile der Bevölkerung: Landarbeiter, ehemalige Sklaven, Tagelöhner, junge, soeben eingetroffene Einwanderer. Die Söhne von Kaufleuten, Farmern und Handwerkern, kurzum die Männer der unteren bis mittleren Mittelschicht, waren hingegen nach Hause zurückgekehrt.
Es fehlten Schuhwerk und Kleidung. Im Schnee der Umgebung leuchteten bald die roten Spuren des Blutes barfüßiger Soldaten, die nach Essbarem suchten. Pferde starben an Hunger und Frost. Der Gestank der Kadaver hing in der Luft. Nicht nur Washington vergaß diese Eindrücke sein Leben lang nicht. Besucher berichteten entsetzt, Soldaten sängen unablässig das eintönige Lied »War and Washington« und böten ein Bild geistiger Zerrüttung.
In diesem Grauen aber entwickelte sich Washington endgültig zu der großen, alle zusammenführenden Vaterfigur. Unablässig schlichtete er zwischen Offizieren und Mannschaften, denn anders als in Europa mussten die Offiziere in dieser Armee ihren Rang und Respekt bei den Soldaten erkämpfen. Und so bildeten sich trotz – oder vielleicht gerade wegen – allen Streits und allen Leids in Valley Forge allmählich Korpsgeist und ein einheitliches Selbstverständnis, dies vor allem unter den Offizieren. Sie schmiedeten Freundschaften, Kameradschaften und gewannen Vertrauen zueinander. Denn sie wussten und betonten es: Sie stritten für das Ideal der amerikanischen Revolution an vorderster Front. Auch das Verhältnis Washingtons zu dem nun 20-jährigen Lafayette, der noch immer seine Schusswunde von der Schlacht am Brandywine auskurieren musste, vertiefte sich.
In Valley Forge begründete ein neben Lafayette weiterer illustrer Helfer aus dem alten Europa seinen Ruhm. Der in jenen Tagen 47-jährige Baron Friedrich Wilhelm von Steuben hatte im Heer Friedrichs des Großen in verschiedenen Funktionen gedient und kannte sich vor allem aus in Fragen der Organisation und Führung leichter Infanterie sowie in der Taktik überraschender Angriffe. In Paris hatte er in diesem Jahr auf einer Dienstreise die Bekanntschaft Benjamin Franklins gemacht. Der großzügige alte Mann stellte geschwind ein Empfehlungsschreiben aus, und Steuben brach damit im Gepäck nach Amerika auf, um der Kontinentalarmee zu helfen. Es wird vermutet, er wollte einer Anklage wegen Homosexualität entfliehen.
Auf jeden Fall hinterließ abermals eine Empfehlung Franklins – wie schon bei Small und bei Paine – Spuren in der Geschichte. Steuben schulte die Truppe, in radebrechendem Englisch und mit deutschen Flüchen, entscheidend in Disziplin und Bewegung im Feld – was in der Kriegsführung dieser Tage von wesentlicher Bedeutung für den Erfolg war, da sich Feuerkraft in einer Schlacht nur in akkurat durchgehaltener Linienformation entfalten konnte. Das von Steuben verfasste Regelbuch, das sogenannte Blue Book, wurde zum Standardwerk in der Armee.
In Königsberg zog Immanuel Kant gegen Ende des Jahres um und nahm eine Wohnung am Ochsenmarkt. Aus der alten Bleibe hatte ihn das laute Krähen eines Hahns in der Nachbarschaft vertrieben, das sein Nachdenken – oder wie er es ausdrückte – sein Meditieren störte. Kants Angebot, das Tier zu kaufen, lehnte der Nachbar wohlweislich ab.
Kant arbeitete weiter an seinem großen Ideengebäude und tat in immer neuen Briefen seine Ansicht kund, er sei mit der Arbeit so gut wie fertig.
Anschauung und Verstandeswelt. Auf Tahiti blieb Cook seiner strengen Linie beim Vorgehen gegen Diebereien treu. Teilweise geriet sie ihm aber nun zu blinder Prinzipienreiterei. Der Mann, der zuvor nicht müde wurde, fasziniert die Eigenarten fremder Völker zu beobachten, saß zunehmend Missverständnissen auf, die unter Fremden schnell entstehen können. Statt sie, wie einst, friedlich auflösen zu wollen, wählte er jetzt immer öfter die Gewalt. Eine gestohlene Ziege etwa nahm er zum Anlass, auf einer Nachbarinsel Tahitis Häuser und Boote in Brand zu setzen.
Die Zeit ging dahin. Für die geplante Erkundung der nordamerikanischen Küste war es in diesem Jahr zu spät. Daher beschloss Cook, eine ausgedehnte Entdeckungsreise durch den Pazifik anzutreten. Am 7. Dezember ließ er die Segel setzen. Am 24. Dezember entdeckte er im Zentralpazifik ein unbewohntes Atoll. Er gab ihm den Namen Christmas Island, Weihnachtsinsel, und verbrachte dort mit seinen Männern die Festtage. Dessen Bewohner übertrugen den Namen später in ihre Sprache, wo er zu Kiritimati wurde.
Goethe hatte Anfang Dezember den Harz bereist, in seiner amtlichen Verantwortung für den Bergbau Gruben besichtigt, und als Privatmann – doch was war bei ihm schon nur privat? – den Brocken bestiegen. Die Schatten in der Abendsonne ließen ihn über das Wesen und die Ursachen von Farben nachdenken. Und es ließ ihn nicht los. Es ging zurück nach Weimar. Dort riefen andere Aufgaben. Am 30. Dezember notierte er dort in seinem Tagebuch: »Die Mitschuldigen glücklich gespielt.«