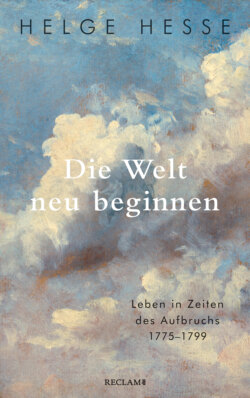Читать книгу Die Welt neu beginnen - Helge Hesse - Страница 9
Mit neuem Blick auf neue Wege
ОглавлениеGleich nach der Rückkehr im Vorjahr war das Schiff außer Dienst gestellt worden: So dümpelte James Cooks Resolution auch am Neujahrstag in der Themsemündung im Hafen von Deptford. Vom Schiffsrumpf fehlte seit einigen Tagen ein Stück Holz. Das hatte sich Georg Christoph Lichtenberg vor seiner Heimreise nach Deutschland als Souvenir herausschneiden lassen. Wie das Holzstück der Resolution war bereits im Oktober in Stratford-upon-Avon ein Span von Shakespeares Stuhl in Lichtenbergs Besitz gelangt. Für einen Schilling hatte er diesen im ehemaligen Wohnhaus des großen Dichters mitnehmen dürfen.
Silvester wieder in Göttingen eingetroffen, betrachtete der Heimkehrer womöglich versonnen das Stück Schiffsholz, das mit seinem Freund Forster und dessen Sohn einst die Meere befahren hatte.
Derweil warteten in Soho jene neuen Kräfte und Mächte darauf, entfesselt zu werden, von denen Matthew Boulton vor James Boswell behauptet hatte, sie seien von aller Welt gewünscht. Trotz seiner großen Reden ahnten wohl weder Boulton noch sein Konstrukteur James Watt, wie entscheidend diese Kräfte Eisen und Dampf bald zur raschen Veränderung der Welt beitragen sollten.
Unter wochenlanger akribischer Aufsicht Watts stellte man nun jene Atmosphärendruck-Dampfmaschine auf, deren Herstellung Lichtenberg noch recht ratlos gemacht hatte. Der Januar war noch nicht sehr alt, da stand sie bereit für den Einsatz.
In Amerika hatte Thomas Paine die Schrift als Waffe entdeckt. Aus seiner Feder erschien um den 10. Januar in Philadelphia, zunächst anonym, das dünne Büchlein Common Sense. Schon bald war es im ganzen Land eine halbe Million Mal verkauft, und die zweite Auflage verriet immerhin, der Autor sei »An Englishman«. Dann sickerte Paines Name durch, auch weil Benjamin Franklin dessen Urheberschaft einigen Weggefährten mitgeteilt hatte. Ende Januar las George Washington das Buch. Sein General Charles Lee hatte ihm in einem Brief seine Begeisterung geschildert.
In Common Sense führte Paine eine vehemente Attacke gegen das britische Mutterland, das unter der Führung König Georges III. die Freiheit der Amerikaner unterdrücken wolle.
Paine argumentierte: »Mehr als einfache Fakten, klare Gründe und gesunder Menschenverstand« sprächen für eine Unabhängigkeit. Die oft vorgetragene Ansicht, wonach alles, was aus der »alten« Welt in die »neue« komme, schlechter werde, kehrte er um. Das Gegenteil sei der Fall: Alles werde in der neuen Welt besser. Denn hier herrsche ein Aufbruch, in dem die Laster der alten Welt verschwänden. Paine rief dazu auf, eine Gesellschaft zu schaffen, in der jeder, egal welcher Herkunft, sich als Gleicher unter Gleichen sehe und in der das Individuum wichtiger sei als der Staat. Der Staat sei, das unterstrich Paine ausdrücklich, nur ein unvermeidliches Übel, das möglichst selten in das Leben des Einzelnen eingreifen dürfe. Paines Ausführungen gipfelten in dem Ausruf: »Es steht in unserer Macht, die Welt aufs Neue zu beginnen.«
Diesen Neubeginn sah Paine in der Errichtung einer Republik, denn eine Monarchie hemme den Fortschritt und schere sich nicht um die Menschheit. Eine amerikanische Republik, aufgebaut auf Common Sense, werde schließlich die Freiheit in alle Welt tragen. Allein schon deshalb müsse man die Freiheit in Amerika erkämpfen. Was für eine Vision!
Watts Maschine sollte in Bersham aufgestellt werden, wo sie beim Eisenhüttenbetreiber John Wilkinson für den Antrieb der Gebläse vorgesehen war.
In einer Art früher Arbeitsteilung hatte Wilkinson die Zylinder der Maschine selbst gefertigt und dafür ein spezielles Verfahren benutzt. Es beruhte auf einem Patent zum Gießen und Bohren von eisernen Kanonenrohren, das er selbst zwei Jahre zuvor angemeldet hatte.
Alle diese Arbeiten überwachte James Watt akribisch, dabei permanent gequält von Kopfschmerzen. Die befielen ihn immer, wenn er unter Druck stand; und das stand er meist. Watt stammte aus der westschottischen Hafenstadt Greenock. Er war der Sohn eines zwar armen, aber äußerst gebildeten Schiffsausrüsters und Tüftlers. Als Kind oft krank gewesen, war ihm ein Studium verwehrt geblieben. Doch die Universität von Glasgow war auf seine Talente aufmerksam geworden und hatte ihn auch ohne akademische Bildung als Mechaniker und Instrumentenbauer angestellt. Watt ging alles mit unerbittlicher Systematik an und erwies sich rasch als geborener Wissenschaftler. Zugleich zeigte er großes Talent für das Praktische. Er konstruierte Brillen und sogar eine Orgel.
Watts Geschäftspartner Boulton bildete in vielem dessen Gegenpart: ein lebenslustiger, von unverwüstlicher Zuversicht durchdrungener und gewinnender Menschenfreund, der, als Sohn eines Unternehmers aus Birmingham ohnehin schon wohlhabend von Geburt, auch durch Mitgift und Erbe aus zwei Heiraten – wovon zumindest die erste Ehe als eine eher strategische gesehen wird – sehr reich geworden war.
Geschäfte mussten für Boulton auf langfristigen vertrauensvollen Beziehungen aufbauen. Anders als Watt, der in Fragen des Geldes das Klischee des sparsamen Schotten erfüllte, schaute Boulton nicht immer auf den Penny, weshalb Watt einmal spottete, seinem Geschäftspartner sei der Ruhm wichtiger als der unternehmerische Gewinn.
Wie Watt hatte Boulton nicht studiert, sich aber mit unersättlicher Neugier durch die Bibliothek seines Vaters gelesen und in unzählige wissenschaftliche Experimente gestürzt. Er war vernarrt in die Verheißungen des technischen Fortschritts und angetrieben von der Idee, die Welt zu einer besseren zu machen.
Zwischen 1762 und 1765 hatte Boulton auf den Wiesen am Rande Birminghams, das schon seit Generationen als Zentrum britischer Eisenproduktion galt, mit seinem damaligen Partner John Fothergill im Örtchen Soho die Soho Manufactory errichten lassen. Das dreistöckige, von dem Klassizismus des italienischen Renaissance-Baumeisters Andrea Palladio beeinflusste Hauptgebäude mit Uhrenturm wurde zum Symbol der Manufaktur. Es beherbergte Werkstätten, Ateliers und Maschinenhallen. In der obersten Etage wohnten leitende Angestellte mit ihren Familien. Ein Industrieviertel wuchs heran, eines der ersten der Welt.
Während Boulton eine Fabrik aufbaute, in der Arbeiter in festgelegten Schichten arbeiteten, erhielt Watt 1764 in Glasgow die Aufgabe, eine der Universität gehörende defekte Atmosphärendruckmaschine zu reparieren, eine des Typs, den Thomas Newcomen schon 1711 entwickelt hatte. Diese ersten kommerziell genutzten Dampfmaschinen setzte man vor allem für das Auspumpen von Steinkohlegruben ein, die man immer tiefer in die Erde trieb, was dazu führte, dass weitere dieser Maschinen gebraucht wurden, um das in der zunehmenden Tiefe immer stärker eindringende Wasser herauszupumpen. Zum Antrieb der Maschinen benötigte man viel Holz, und so verfeuerte man für den Abbau der in immer größeren Mengen nachgefragten und immer kostengünstiger abzubauenden Steinkohle nach und nach Englands Wälder. Ein Teufelskreis der Naturzerstörung war im Gang.
Watt wollte die Effizienz der Maschinen steigern. Er tüftelte Tag und Nacht und kam schließlich auf die Idee eines Kondensators. Dieser machte seine Version einer Dampfmaschine um 75 Prozent leistungsfähiger. 1769 erhielt er dafür ein Patent.
Doch Watt brauchte Finanziers. Er fand den Grubenbesitzer John Roebuck. Der zahlte Watts Schulden und bekam dafür einen Großteil der Rechte. Doch dann ging Roebuck pleite. Etwa zur gleichen Zeit starb Watts Frau nach der vierten Schwangerschaft. Watt war am Boden zerstört. Da bewog ihn Boulton, nach Birmingham zu ziehen, wo er die konzentrierte Arbeit an seiner Erfindung 1775 wieder aufnahm. Boulton übernahm als Schuldenausgleich Roebucks Zweidrittel-Anteil an Watts Patent, und es gelang ihm dank seiner Verbindungen zum britischen Parlament, die Patentrechte bis 1800 zu verlängern. Zugleich rührte er in seiner überschwänglichen Art die Werbetrommel und lobte überall Watts Fähigkeiten über den grünen Klee, was dazu führte, dass der Botschafter von Zarin Katharina der Großen Watt nach Russland locken wollte. Boulton war alarmiert und machte Watt auf die Beschwernisse einer Reise nach Russland, auf die dortige Kälte und dessen schwache Gesundheit aufmerksam. Watt blieb.
Als Watt dann erneut heiraten wollte, sprang Boulton ihm bei. Watt hatte für sich eine neue Gefährtin und für seine Kinder eine neue Mutter gesucht, und in Glasgow hatte er tatsächlich eine Braut gefunden. Auf die Frage des argwöhnischen Brautvaters, ob denn ein Vertrag der Partnerschaft mit Boulton bestehe, antwortete Watt auf eine Weise, die dem Vater »erlaubte, zu glauben, ein solcher Vertrag existiere«, wie er Boulton gestand. Das aber war nicht der Fall. Boulton half Watt aus der Patsche, indem er dem Vater der Braut vorlog, der Gesellschaftervertrag sei sehr vorteilhaft für den Schwiegersohn in spe, nur leider gerade nicht zu finden.
So heiratete Watt am 29. Juli die Witwe Anne McGregor. Wie Watts erste Frau erwies sie sich als wundervolle Unterstützung. Anne war liebevoll, sprang ihm in geschäftlichen Dingen bei, die ihm allzu oft schwerfielen, vor allem half sie ihm immer wieder aus tiefen Gemütsverdunkelungen.
Watt und Boulton fanden bald einen Weg, wie sie Kunden von der Anschaffung der teuren Maschinen überzeugen konnten. Sie ließen sich als Preis ein Drittel der Ersparnis gegenüber der Newcomen-Maschine zahlen. Diese Summe konnten die Kunden in Anteilen und in Raten begleichen. Für alle Kunden, die keine Newcomen-Maschine benutzt hatten und meist nach wie vor Pferde einsetzten, nahm Watt eine verständliche Rechengröße zur Hilfe, das bereits länger bekannte Modell der Pferdestärke. Diese berechnete er großzügig zugunsten der Abnehmer und machte sie so populär.
Wenn ich jemand lieber haben kann, will ich Dir’s sagen.« Diese Zuneigung mit Hintertürchen vertraute Goethe am 28. Januar einem Billett an. Aber er sandte es nicht an Lili. Sein Herz, das sich jeden neuen Eindruck der Welt griff und damit voller Vergnügen, Leidenschaft und Leidenslust spielte, strebte zu einem neuen Ziel: Charlotte von Stein. Fast sieben Jahre älter als er.
Geboren als Charlotte von Schardt, blickte sie auf die übliche Lebenslinie adeliger Frauen dieser Zeit. Mit 16 Jahren schon Hofdame von Fürstin Anna Amalia, hatte sie mit 22 Jahren eine Vernunftehe mit dem Hofmeister Josias von Stein geschlossen und in anstrengenden Schwangerschaften sieben Kinder zur Welt gebracht, von denen die vier Mädchen schon als Kinder starben.
Charlotte war eine kluge, angenehme Frau mit einem selbstbeherrschten freundlichen Wesen. Die Lektüre des Werther hatte sie tief berührt. Danach hatte sie ihren Freund, den mit Goethe bekannten Schweizer Arzt Johann Georg Zimmermann, um eine Beschreibung des jungen Autors gebeten. Der fragte: »Sie möchten ihn sehen?«, und schickte ihr eine Silhouette des jungen Dichters.
Das Anfertigen von Porträts erfreute sich dieser Tage großer Beliebtheit. Nicht nur Adelige, sondern auch die Bürger wollten ihr Konterfei zeigen und sehen. Vor allem Schattenrisse waren schnell anzufertigen und hatten eine gewisse Genauigkeit. Man skizzierte einfach die an die Wand geworfene Silhouette. Zuweilen nutzte man bestimmte Stühle mit Rahmen, auf die sich die zu Porträtierenden setzten. Sie wurden fixiert und ihr Umriss nachgezeichnet.
Zu der großen Popularität der Schattenrisse – meist tuschte man sie sorgfältig und fertigte sie nicht als Scherenschnitte an – trug in jenen Tagen Goethes Schweizer Freund Johann Caspar Lavater durch seine Theorie der Physiognomie bei. Laut Lavater konnte man aus der Form des Gesichts und aus seiner Statur auf den Charakter eines Menschen schließen. Im ersten Band seiner seit dem Vorjahr erscheinenden vierbändigen, bald auch in Frankreich und England einflussreichen Physiognomischen Fragmente hatte Lavater Goethes Silhouette abdrucken lassen und sie kommentiert: »Die nachstehende Silhouette ist nicht vollkommen, aber dennoch bis auf den etwas verschnittenen Mund, der getreue Umriss von einem der größten und reichsten Genies, die ich in meinem Leben gesehen.« Im Jahr darauf porträtierte der Maler Georg Melchior Kraus Goethe im Profil – wie er einen Scherenschnitt betrachtet.
Zimmermann fügte zu Goethes Schattenriss an Charlotte an: »Sie wissen nicht, bis zu welchem Punkte dieser liebenswürdige und bezaubernde Mann Ihnen gefährlich werden könnte!« Umgekehrt zeigte Zimmermann Goethe einen Schattenriss von Charlotte von Stein, und der war beeindruckt. Drei Nächte habe das Bild Goethe den Schlaf geraubt, berichtete Zimmermann.
So waren wohl Goethe wie auch Charlotte aufeinander äußerst gespannt, als Goethe nach Weimar kam. Als sie sich zum ersten Mal, am 11. November des Vorjahres im Stadthaus der Steins in der Weimarer Scherfgasse, begegneten, war vermutlich auch Carl August dabei. Schon einen Monat später besuchte Goethe erstmals Schloss Kochberg, den Wohnsitz der Steins. In die Platte des Pults der Hausherrin ritzte er ein Goethe d. 6. Dez. 75. Man könnte es wie das Zeichen eines Werbenden lesen. Eindruck hatte sie längst bei ihm hinterlassen, die reifere Frau mit den dunklen Augen, der sanften Art, den guten Manieren, die sich das zutrauliche »Du«, das er gleich bei ihr anzuwenden versuchte, prompt verbat. Er wagte es wieder in den Billetts und Briefen an sie, ging dann aber wieder zum »Sie« über, um doch immer wieder ins »Du« zu wechseln. Während er also noch an Lili gedacht und im Wald von ihr gesungen hatte, dachte er auch schon an Charlotte – als würde sich Lavaters Urteil bestätigen: »der Mensch [hat] nur eine Seele, Goethe aber hat hundert.«
Bereits kurz nach seiner Ankunft in Weimar hatte Goethe aus dem Fragment des Faust vorgelesen. Alle waren begeistert. Luise von Göchhausen, die freundliche, kleinwüchsige und bucklige Erste Hofdame von Herzogin Anna Amalia, erwarb sich bald Verdienste als Goethes »mobile Feder«. Sie schrieb eine erste Version des Faust ab. Seine eigenen Aufzeichnungen sollte Goethe irgendwann in einem Moment der Krise vernichten, Göchhausens Niederschrift aber im späten 19. Jahrhundert wiederentdeckt und als Urfaust ediert werden.
In Weimar wurde Goethe bald Zeremonienmeister und Stadtgespräch. Er hatte sich Schlittschuhe aus Frankfurt am Main senden lassen. Auf einem zugefrorenen See brachte sein Diener Seidel den Damen und Herren der Gesellschaft das Schlittschuhlaufen bei. Und bald, später im Jahr, Seiltanz.
Am 14. Februar bekannte Goethe in einem Brief an Johanna Fahlmer, eine Frankfurter Freundin: »Hier hab ich doch ein paar Herzogtümer vor mir. Jetzt bin ich dran, das Land nur kennenzulernen, das macht mir schon viel Spaß. Und der Herzog kriegt auch dadurch Liebe zur Arbeit, und weil ich ihn ganz kenne, bin ich über viel Sachen ganz und gar ruhig.«
Zwei Tage im März. Am 8. März nahm in der Bloomfield Colliery in Tipton in der Grafschaft Staffordshire, Mittelengland, eine der ersten von Watts Maschinen den Betrieb auf und sparte tatsächlich drei Viertel der bisher benötigten Energie ein. Tags darauf, am 9. März, veröffentlichte Watts alter Freund Adam Smith das zweibändige Werk An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations und erhob damit das Nachdenken über die Vorgänge des wirtschaftlichen Handelns zur Wissenschaft.
Adam Smith, nun 53 Jahre alt, hatte sich einst in Glasgow, wo er damals mit nur 27 Jahren Professor für Logik und danach für Moralphilosophie geworden war, mit dem Universitätstüftler Watt angefreundet. Der bescheidene und freundliche Smith war mit seinem 1759 erschienenen moralphilosophischen Buch The Theory of Moral Sentiments bekannt geworden, in dem er das Mitgefühl als wichtigste Triebfeder des moralischen Handelns des Menschen herausstellte. Später hatte er seine Professorenstelle aufgegeben und als gut bezahlter Tutor einen jungen schottischen Adeligen auf dessen Grand Tour durch Frankreich und die Schweiz begleitet und in Paris Bekanntschaft mit D’Alembert, Denis Diderot, Voltaire, François Quesnay und Jacques Turgot gemacht, wovon die beiden Letzteren zu den bedeutendsten Köpfen einer ersten ökonomischen Schule, der Physiokraten, gehörten. François Quesnay, Leibarzt von Louis XV. und seiner Mätresse, Madame Pompadour, Begründer besagter Schule der Physiokratie (altgriechisch für ›Herrschaft der Natur‹), schuf die frühe Darstellung eines Wirtschaftskreislaufs und meinte, allein die Natur, also die Landwirtschaft, mache den produktiven Teil einer Wirtschaft aus. Turgot wurde sein wirkmächtigster Anhänger. Doch dazu später.
Smith hatte in Frankreich zahlreiche Manufakturen besucht. Zurück in Schottland, ermöglichte ihm die vom Herzog gewährte lebenslange Rente das Leben eines Privatgelehrten, und so war in etwa 17 Jahren Arbeit und 10 Jahren des Schreibens sein monumentales Werk entstanden. Darin fasste er Teile der beiden widerstreitenden Wirtschaftsdenkweisen des althergebrachten absolutistischen Merkantilismus und der neueren Physiokratie zusammen. Er verknüpfte sie mit dem bisherigen Wissen und Denken über die Mechanismen des Wirtschaftens und gab alldem eine Systematik. Vom Merkantilismus übernahm er den Blick für die Bedeutung des Außenhandels, verwarf aber den merkantilistischen Gedanken von Lenkung und Beschränkung. Von den Physiokraten übernahm er die Idee des Laissez-faire und die Forderung nach möglichst freiem Spiel der Marktkräfte einschließlich des Freihandels. Zudem setzte er sich mit dem weiten Feld der Produktion auseinander und überwand den bislang engen Blick auf die Landwirtschaft.
Indem er die drei Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital und die wesentlichen ökonomischen Kategorien Handel und Produktion in ein theoretisch geschlossenes System setzte, schuf Smith ein Gedankengebäude, mit dem er auch die zunehmende Veränderung der Arbeitsorganisation abbildete. Die Arbeitsteilung, wie sie Lichtenberg ähnlich im Jahr zuvor bei Boulton gesehen hatte, beschrieb Smith anhand seines berühmt gewordenen Beispiels einer Stecknadelmanufaktur, die er besucht hatte: Ein einzelner Arbeiter sei nicht in der Lage, mehr als vielleicht 20 Nadeln am Tag herzustellen. Dagegen könnten zehn Arbeiter, von denen jeder nur wenige Handgriffe des Gesamtherstellungsprozesses ausführe, an einem Tag 48 000 Nadeln produzieren.
Smith war überzeugt, freies Handeln und Wirtschaften führe über Angebot und Nachfrage zu einem sich selbst regelnden Markt. Der Eigennutz der Marktteilnehmer sei dabei nicht hinderlich, sondern sogar oft von Vorteil, denn »von einer unsichtbaren Hand geleitet« mehre dieser auch den Gemeinnutz. Smith begründete mit seinem Buch die moderne Wirtschaftswissenschaft.
Thomas Jefferson und später auch George Washington lasen Smiths Werk. Mutmaßlich wird ihnen auch die Stelle ins Auge gesprungen sein, an der Smith für eine friedliche Trennung der amerikanischen Kolonien vom Mutterland eintrat: »Indem beide so als gute Freunde schieden, würde die natürliche Liebe der Kolonien zu dem Mutterlande, die durch unsere neulichen Zwistigkeiten beinahe erloschen ist, schnell wieder aufleben«.
Im März 1776 besuchte eine junge Frau George Washington in seinem Hauptquartier. Sie hieß Phillis Wheatley, war schwarz und eine ehemalige Sklavin. Sie hatte Washington im Jahr zuvor ein selbst verfasstes Gedicht zugeschickt. »Dein seien Krone, Schloss und Thron / Von lautrem Golde Washington!« Beeindruckt hatte Washington ihr einen Dankesbrief zugesandt, und eine Einladung. Nun nahm sie diese wahr.
In Phillis Wheatley vereinte sich viel von dem, was an Freiheit und Gleichheit noch zu erkämpfen war. Nicht nur die Freiheit der Schwarzen, auch die der Frauen. Vielleicht war sie jetzt in diesen Tagen 23 Jahre alt. Sie wusste es nicht genau. Als Kind hatte man sie mit etwa sieben Jahren in ihrer Heimat, irgendwo am Gambia-Fluss in Westafrika, in die Sklaverei verschleppt. In Boston kaufte der Schneider John Wheatley das Kind 1761 als Dienerin für seine Frau. Sie nannten sie nach dem Schiff, auf dem sie nach Amerika gekommen war, Phillis; und wie weithin üblich, erhielt sie den Nachnamen ihres Besitzers. Als die Wheatleys die vielen Talente des Mädchens erkannten, ließen sie ihr eine umfassende Ausbildung angedeihen. Mit 12 Jahren las Phillis griechische und lateinische Klassiker, mit 13 Jahren veröffentlichte sie ihr erstes Gedicht.
Mit dem Sohn der Wheatleys war sie im Sommer 1773 nach London gereist, hatte Benjamin Franklin kennengelernt und war im November von den Wheatleys in die Freiheit entlassen worden. In London erschien im September ihr erstes Buch: Poems on Various Subjects, Religious and Moral by Phillis Wheatley, Negro Servant to Mr. John Wheatley, of Boston, in New England. Es enthielt eine Sammlung von 39 Gedichten und gilt als die erste Veröffentlichung einer Afroamerikanerin überhaupt. Das Werk zog Kreise und erfuhr allgemeine Beachtung. Thomas Jefferson mochte den Stil nicht und meinte, Religiosität mache noch lange keine Poeten. Benjamin Franklin hingegen gefiel Phillis Wheatleys Lyrik, auch Voltaire war angetan. Der führte sie im Jahr nach der Veröffentlichung in einem Brief an den Baron Constant de Rebecque als Gegenbeweis für dessen rassistische Behauptung an, es gebe keine schwarzen Dichter.
Als 1775 die Kämpfe mit Großbritannien begannen, trat Phillis für die amerikanische Sache ein. Ihr Gedicht »To His Excellency, George Washington« sandte sie ihm zu, und im April erschien es in Aitkens Pennsylvania Magazine. Washington schickte einen Dankesbrief. Was sollte aus Phillis werden? Noch ein Mal werden wir ihr hier begegnen. Ein Mal.
Charlotte von Stein verfasste am 24. März einen aufgewühlten Brief an ihren Arzt und Freund Zimmermann. Sie beschwerte sich über Goethe, sprach von seinem »wilden Wesen«, klagte, wie er mit ihrem Geschlecht umgehe, sei nicht angemessen, nannte ihn »coquet«. Alle in Weimar seien von ihm aufgewühlt. Aber auch längst selbst von ihm eingenommen, setzte sie hinzu, er sei ein Mensch, »der von tausend Kopf und Herz hat«, ein Mensch, »der über alles kann Herr werden, was er will«. Doch »Goethe und ich werden niemals Freunde«, schrieb sie, um aber gleich zu beschwichtigen: »aber eine Weile muss er’s so treiben, um den Herzog zu gewinnen und dann Gutes zu stiften«.
Tatsächlich ließen Goethe und der Herzog ihren Jugendlaunen freien Lauf. Sie ritten halsbrecherisch über Gräben, Felder und Flüsse, kampierten im Freien, stellten sich nachts auf den Marktplatz, ließen angetrunken die Peitsche knallen, schossen mit Pistolen in den Gängen des Schlosses, täuschten am Tage Überfälle vor oder zwangen junge Frauen, den Rock zu heben, um dann die Peitsche darunter sausen zu lassen. Es blieb nicht nur bei Streichen, sondern viele böse Drangsalierungen gehörten dazu.
Doch der fast zehn Jahre ältere Dichter und Carl August redeten auch stundenlang über das Leben, über die Kunst und die Welt überhaupt. Oft schliefen sie auf dem Sofa nebeneinander ein. Goethe und das Spielfeld, auf dem ihm der junge Herzog eine Hauptrolle gewährte, lockten einige junge Männer an, die sich, da so viel Grandioses in der Luft lag, ebenfalls zu Großem berufen fühlten. Der Schriftsteller Jakob Michael Reinhold Lenz kam, hoffte auf Aufnahme, wurde von Carl August freigehalten, zerstritt sich mit Goethe. Friedrich Maximilian Klinger, seines Zeichens junger Dramenautor, traf aus Gießen ein und stürzte sich wie Lenz in die gemeinsamen Ausschweifungen, die bald zum Stadtgespräch wurden. Aber auch Klinger reiste nach einem Zerwürfnis mit Goethe ab. Im Gepäck das Drama, das dem genialischen Tumult dieser jungen Kerle den Namen geben sollte: Sturm und Drang.
In Amerika begab sich Benjamin Franklin auf eine neue Mission. Ende März brach er mit zwei Mitstreitern gen Norden auf. Er sollte die Kanadier dazu bewegen, sich der amerikanischen Sache anzuschließen und mit ihnen den Kampf gegen die Briten aufzunehmen. Doch in Kanada hatten sich die amerikanischen Soldaten durch Plünderungen unbeliebt gemacht.
Wenige Tage vor Franklins Reiseantritt hatte am 17. März die seit den Gefechten von Lexington und Concord andauernde Belagerung von Boston ihr Ende gefunden. Der junge Artillerieoberst Henry Knox war mit Kanonen eingetroffen. Er hatte sie über den Landweg aus dem von den Briten übergebenen Fort Ticonderoga durch die Green Mountains über den zugefrorenen Connecticut River schleppen lassen. Als diese Waffen nun Boston bedrohten, gaben die Briten die Stadt auf und zogen sich auf ihren Schiffen nach Halifax zurück.
George Washington hatte in der Nähe des Nachbarorts Cambridge im Juli des Vorjahres eine Villa als Hauptquartier bezogen. Dort blieb er bis April. Das Haus, wie Boultons Soho Manufactury im Stile des nach dem Renaissance-Architekten Andrea Palladio benannten Palladianismus erbaut, wurde zu einem der meistkopierten Häuser des Landes.
Während der Belagerung von Boston bildete sich jene Gruppe junger Offiziere um Washington, die im Laufe seines weiteren Lebens mit ihm durch dick und dünn gehen sollte. Im Wissen um die Lücken seiner Bildung scharte Washington ganz bewusst breit gebildete Männer um sich. Er liebte und förderte das offene Gespräch nach dem gemeinsamen Essen in größerer Runde, knabberte dann Nüsse, trank Madeira, lauschte und lernte. Doch diese beschaulichen Momente blieben rar. Der Reverend Thomas Davis fragte Washington in dessen Tagen in Cambridge einmal, ob er tatsächlich gesagt habe, es gebe keine schönere Musik als das Pfeifen von Kugeln. »Sollte ich das gesagt haben«, antwortete Washington, »dann war das, als ich jung war.«
Anfang April übernahm der erst 24-jährige Jakob Friedrich Abel den Philosophieunterricht der Mediziner in der Hohen Carlsschule und begeisterte den 15-jährigen Friedrich Schiller. Abel war klein von Wuchs und daher bei der Besetzung der Professuren zunächst übergangen worden. Er schwärmte für die englischen Denker Locke und Hume und machte nun seinen Schüler Schiller mit der Philosophie, dem Geniebegriff und vor allem mit Shakespeare vertraut. Der beeindruckte Schiller so tief, dass er überzeugt war, solcher Kunst noch nicht nacheifern zu können.
In London schloss man am 13. April einen Vertrag über zwei zur Südseereise zu verfassende Bücher. In einem Buch sollte Cook aus Sicht des Kapitäns berichten, Reinhold Forster in einem anderen aus wissenschaftlicher Perspektive. Doch der von Forster daraufhin gelieferte Probetext wurde abgelehnt. Als Sandwich darauf bestand, ein Engländer habe bei künftigen Texten Korrektur zu lesen, vermuteten Reinhold und Georg Forster Zensur. Der Streit eskalierte. Der König sprach ein Machtwort. Vater Forster habe die an ihn gestellten Forderungen zu akzeptieren. Wenn nicht, sei er aus dem Vertrag entlassen. Der lehnte ab. Daraufhin meinte Sandwich, ein Buch nur von Cook reiche ihm. Eine mögliche lukrative Einnahmequelle für die Forsters war damit schlagartig versiegt und die finanzielle Lage der Familie prekärer denn je.
Goethe erwarb am 22. April ein Gartenhaus an einem Hang an der Ilm. Das Gartenhaus! Im Kaufvertrag hieß es: »Garten auf dem Horne samt dem darinnen befindlichen Garten-Hause, nebst allen, was darinnen Erd-, Wand-, Band-, Nied- und Nagelfest ist.« Der leicht abschüssige Garten wies zu einer weiten Wiesenfläche der Auenlandschaft und war in verwahrlostem Zustand.
Goethe hatte 600 Gulden zu zahlen. Die beglich Carl August über einen Strohmann. Am 19. Mai schlief Goethe zum ersten Mal in seinem neuen Refugium. Renovierungen und Einrichtung hatten noch mal so viel gekostet. Auch das bezahlte Carl August.
Bislang hatten der junge Herzog und Goethe vor allem durch Jungmänner-Eskapaden von sich Reden gemacht. Nun aber schien sich Carl August doch dem Regieren zuwenden zu wollen. Helfen sollte ihm dabei sein Dichterfreund. Der übernahm auch sofort erste Aufgaben. Am 3. Mai war Goethe zum ersten Mal im Bergbaustädtchen Ilmenau im Thüringer Wald eingetroffen. Auf Geheiß von Carl August sollte er ein Brandunglück klären, des Unwesens von Räubern in den Wäldern der Umgebung Herr werden und sich der verfallenen Kupfer- und Silberbergwerksanlagen annehmen.
Dann, am 25. Juni, trat der 26-jährige Goethe als Geheimer Legationsrat in den Staatsdienst des erst 18-jährigen Herzogs ein. Goethe erhielt 1200 Gulden Gehalt, das seinerzeit zweithöchste im Herzogtum, sowie Sitz und Stimme in der Landesregierung, dem »Geheimen Concil«. Es gab Widerstand, etwa von des Herzogs bislang engstem Ratgeber Friedrich von Fritsch. Alle Kritik aber bügelte Carl August ab mit den Worten: »Einen Mann von Genie nicht an dem Ort gebrauchen, wo er seine außerordentlichen Talente nicht gebrauchen kann, heißt, denselben missbrauchen […].«
Charlotte von Stein reiste am gleichen Tag zu ihrer jährlichen Kur in Bad Pyrmont. Der nunmehr in Verwaltungspflichten eingespannte Goethe vermisste sie und kümmerte sich zuweilen um ihre drei Söhne, die »Grasaffen«, wie er sie gerne nannte. Während Charlottes Rückreise hielt Goethe sich in Ilmenau auf. Sie besuchte ihn dort am 5. August. Gemeinsam erwanderten sie am nächsten Tag den Hermannstein. Er hielt ihre Hand. Tage später meißelte er ein S in die Höhlenwand.
In Nordamerika nahmen die Dinge ihren Lauf. Am 12. Juni verabschiedete der Konvent von Virginia einstimmig die Virginia Declaration of Rights. Die darin festgelegten Bürgerrechte stellten einen entscheidenden Schritt zu einer künftig anderen Gesellschaft dar. Aber noch ging es in der Praxis bei den dort beschriebenen Menschenrechten um die Rechte von Bürgern im Verhältnis zum Adel, nicht aber um gleiche Rechte für die indigenen Völker, Frauen oder um die Abschaffung der Sklaverei.
Etwa zur gleichen Zeit nahm man nun, trotz eines noch weit verbreiteten Zögerns, im Kontinentalkongress die Abfassung einer Unabhängigkeitserklärung in Angriff. Am 11. Juni hatte der Kongress in Philadelphia dazu ein »Komitee der Fünf« einberufen. Neben John Adams und Benjamin Franklin gehörte auch der erst 33-jährige Thomas Jefferson dazu, einer der jüngsten Delegierten des gesamten Kongresses. Er wurde zum Vorsitzenden gewählt. Als es darum ging, wer einen ersten Entwurf verfassen sollte, schied der 70-jährige Franklin aus. Er war gerade von seiner Reise nach Kanada zurückgekehrt, auf der er in der Furcht, sie nicht zu überleben, bereits Abschiedsbriefe an seine Familie geschickt hatte. Er hatte sich noch nicht erholt und litt an Gicht.
Als Verfasser kam auch John Adams in Frage. Er gehörte zu den wichtigsten Taktgebern der Unabhängigkeitsbewegung, war vom Kongress gerade mit der Führung des »Board of War« betraut worden und damit eine Art Kriegsminister. Der Sohn eines Farmers und späteren Armeeoffiziers hatte selbst Farmer werden wollen, aber von den Eltern gedrängt dann in Harvard studiert, wo er schließlich doch Interesse an Wissenschaft und Literatur gefunden, zum Broterwerb aber den Anwaltsberuf ergriffen hatte. Seine Frau Abigail, eine Frauenrechtlerin, begleitete ihn bei seinen politischen Aktivitäten, beriet und unterstützte ihn. Adams forderte häufige Wahlen, die Begrenzung von Amtszeiten und eine starke unabhängige Gerichtsbarkeit, kurzum eine Balance starker und unabhängiger Gewalten. Dies aber tat er immer mit Strenge, einer gewissen Prinzipienreiterei und meist einem verdrießlichen Gesicht. Auch verwies Adams gerne auf die Schwächen jener, die ihm an Beliebtheit voraus waren; und das waren ihm aufgrund seines launischen Wesens einige.
Trotz all dieser Nachteile half Adams seine gute Selbsteinschätzung. Er war sich seiner wenig gewinnenden Art bewusst, auch als Jefferson ihm die Aufgabe der Formulierung einer Unabhängigkeitserklärung antrug. Adams lehnte ab. Statt seiner schlug er Jefferson selbst vor. Dies aus klugem Kalkül. Ein Mann wie Jefferson, aus der wichtigsten Kolonie Virginia stammend, müsse federführend an der Spitze dieses Unternehmens stehen, argumentierte Adams. Zudem sei Jefferson, anders als Adams, beliebt und könne, ebenfalls anders als Adams, gut formulieren. Kurzum, er sei die erste Wahl.
Jefferson, ein Anwalt und wohlhabender Pflanzer wie sein Vater und wie Washington Großgrundbesitzer und Sklavenhalter, gehörte als Abgeordneter seiner Heimat Virginia dem Kontinentalkongress seit dem ersten Tag an. Von seinem Wesen ruhig und von aristokratischer Ausstrahlung, drängelte sich der hochgewachsene junge Mann als Redner nicht vor, hatte aber bald in verschiedenen Ausschüssen durch seine vermittelnde, zugleich aber zielstrebige Art tiefen Eindruck hinterlassen. Jefferson setzte sich in seiner Unterkunft, einem Backsteinhaus, in dem er im zweiten Stock mit seinen Bediensteten zur Miete wohnte, an das von ihm selbst erfundene portable Pult. Nach einigen Tagen gab er den ersten Entwurf an Adams und Franklin zur Durchsicht. Am 28. Juni überreichten sie das Papier dem Kongress.
Am 3. Juli teilte John Adams seiner Frau Abigail in Massachusetts mit: »Gestern ist die wichtigste Frage entschieden worden, die je in Amerika verhandelt wurde, und eine größere ist vielleicht nie oder wird nie wieder unter Menschen entschieden werden.« Der Kontinentalkongress hatte auf der Basis des vor allem von Jefferson erarbeiteten Papiers die Unabhängigkeit der 13 britischen Kolonien Nordamerikas erklärt. Sie bildeten nun einen eigenen Staatenbund: die Vereinigten Staaten von Amerika. Am 4. Juli folgte nach einigen kleinen Änderungen die endgültige Annahme der Erklärung.
Als erste Zeitung überhaupt berichtete am 5. Juli in Philadelphia der deutschsprachige Pennsylvanische Staatsbote. In dessen deutscher Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung standen die berühmten Worte: »Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.«
In Frankreich stieß die Unabhängigkeitserklärung auf großes Interesse. Dort hatte der bereits erwähnte Jacques Turgot, gelehriger Schüler des Physiokraten Quesnay, kurz nach Regierungsantritt Louis’ XVI. auf Betreiben von dessen Minister und Mentor Malesherbes das Amt des Generalkontrolleurs der Finanzen übernommen. Sowohl Malesherbes als auch Turgot erkannten die Verkrustungen des französischen Absolutismus und versuchten Reformen in Gang zu bringen. Welche Aufgabe Turgot bewältigen musste, ahnte bereits Friedrich der Große im fernen Potsdam. Der schrieb am 20. April an Voltaire: »In Frankreich sieht man, wie wenig diese Gesellschaft an das Wohl des Staates denkt. Herr Türgot hat in den Papieren seiner Vorgänger sogar die Summen gefunden, die es Ludwig XV. gekostet hat, seine Parlamentsräte zu bestechen, damit er, ich weiß nicht welche Edicte, registriert bekäme.«
Der 49-jährige Turgot, aufrichtig, geradlinig, aber mit einem Hang zur Schulmeisterei, ahnte, mit Blick auf die Vorgänge jenseits des Atlantiks, den bevorstehenden Wandel. Er hatte prophezeit, solch reiche Kolonien wie Amerika würden den Europäern einst abhandenkommen. Sie seien »wie Früchte, die nur so lange am Baum hängen bleiben, bis sie ihre Reife erreicht haben.«
Zu Turgots Freundeskreis gehörte seit Jahren ein Mann, der die Vorgänge in Amerika mit Sympathie verfolgte, aber auch die Schwächen einer Republik sah und diese verringern wollte. Der 16 Jahre jüngere Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, trat ein für die gleichen Rechte der Frauen und für die Abschaffung der Sklaverei. Er war eine der herausragenden und – was die Gedanken über die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft angeht – eine der visionärsten Persönlichkeiten dieser an Persönlichkeiten nicht gerade armen Zeit. Von der großartigen Salonnière Julie de Lespinasse stammt eine geradezu hymnische Beschreibung seiner Person. Condorcets Gesichtsausdruck sei sanft und zeige seine Güte, was Porträts von ihm in der Tat nahelegen. Sein Auftreten sei schlicht, aber auch nachlässig, sein Geist, wie der Gottes, unendlich, aufgeschlossen, scharf und fein. Wer ihm begegne, müsse »hundertmal am Tage« sagen, es sei der erstaunlichste Mensch, den er je traf.
Zwar waren Condorcet und Julie de Lespinasse wohl nie ein Liebespaar, doch ihre Briefe an ihn verraten ihre Nähe zueinander. Sie mahnte ihn, nicht auf den Lippen oder an den Fingernägeln zu kauen, und nicht allzu linkisch herumzustehen.
Im Jesuitenkolleg in Reims, in dem Condorcet ausgebildet worden war, hatte man einst sein herausragendes mathematisches Talent entdeckt. Der Enzyklopädist Jean-Baptiste le Rond d’Alembert, selbst Mathematiker, nahm den 16-Jährigen unter seine Fittiche. Rasch lieferte Condorcet mehrere mathematische Aufsätze ab und wurde bekannt. Mit 26 Jahren nahm ihn die Académie royale des sciences auf. Condorcet korrespondierte mit Voltaire, lernte Turgot kennen, und als dieser 1774 Generalkontrolleur der Finanzen wurde, ernannte er Condorcet zum Generalinspekteur der staatlichen Münze. Condorcet beschäftigte sich zunehmend mit aufklärerischen Fragen. Vor allem das Bildungswesen lag ihm am Herzen. Bildung würde die Menschen besser und gerechter machen.
Condorcets Hoffnung, unter der Leitung des reformeifrigen Turgot Frankreich in eine neue Zeit zu führen, erlitt kurz bevor die verheißungsvollen Nachrichten aus Amerika eintrafen, einen schweren Rückschlag. Turgot hatte im Januar mit den Six Édits seine Reformvorhaben vorgelegt. Von diesen Edikten stießen die beiden zentralen – das zur Beseitigung der Frondienste und das zur Aufhebung des Zunftzwangs – auf großen Widerstand des Adels, worauf man am 12. Mai Turgot aufforderte, seinen Rücktritt einzureichen.
Während Amerika also aufbrach, schob Frankreich die dringend benötigten Reformen wieder einmal auf. Auch Condorcet bot seinen Rücktritt an, der aber abgelehnt wurde. Widerwillig blieb er im Amt, mit der leisen Hoffnung, die Dinge würden sich vielleicht doch zum Besseren wenden.
Es kursierten Gerüchte, gerade Marie Antoinette habe Turgots Entlassung betrieben. Die junge Königin, erst 20 Jahre alt, gab zunehmend der Unart nach, sich, wie es eine Laune oder Einflüsterung gebot, in Regierungsgeschäfte einzumischen. Tatsächliches Einlesen, längeres Zuhören oder Nachdenken aber wollte ihr dabei nicht gelingen.
Ansonsten ergab sie sich die meiste Zeit einer dubios tändelnden Freiheit, die ihr teils zugefallen, teils von ihr erkämpft worden war. Sie schlief am Tag und genoss die Nächte, trieb durch eine bunte Welt des Vergnügens mit Kartenspiel, Bällen und Schauspielen. In ihrem Schlepptau: junge Prinzen und Grafen, darunter der jüngste Bruder des Königs, Charles Philippe, Graf von Artois, berüchtigt und in Paris verhasst für seine Ausschweifungen. Sie alle betrachteten ihren Platz in der Welt und ihren Reichtum als selbstverständlich und von Gott gegeben. Keiner von ihnen empfand eine andere Pflicht, außer der, sich nicht zu langweilen.
Zu diesen Selbstbezogenen von Geburt gesellten sich in Marie Antoinettes Umfeld die Gierigen. In ihrem Zentrum stand die Gräfin und spätere Herzogin Gabrielle de Polignac. Jung, schön, von reizvoller, lieblicher Ausstrahlung, hatte sie im Vorjahr rasch Marie Antoinettes Herz gewonnen. Bald verdrängte sie Marie-Louise, Fürstin von Lamballe, aus der Position der Ersten Kammerdame der Königin. Marie Antoinette ließ ihrer neuen Favoritin und deren großer Familie, ohne Zögern ihres ebenfalls von der Polignac eingenommenen Gatten, riesige Summen und Pfründe angedeihen. Die Familie Polignac legte sich wie eine abschottende Blase um Marie Antoinette. Im derart ausgeschlossenen Rest des Hofes keimte neuer Klatsch aus Neid und Missgunst; mit dem Verrat als Waffe und dem gewollt geistreichen Wort als Klinge.
Am 12. Juli brach James Cook zu seiner nunmehr dritten großen Reise auf. Die Resolution war im Februar wieder in Dienst gestellt worden. Die neue Expedition sollte die Nordwestpassage finden, also eine Route vom Pazifik in den Atlantik entlang des äußersten Nordens von Amerika. Cook war mit seiner zweiten Reise endgültig berühmt geworden und hatte lange gezögert, das Kommando zu übernehmen. Zunächst überwachte er nur die Vorbereitungen, ließ aber nicht die Akkuratesse von einst walten. Noch immer litt er unter den gesundheitlichen Problemen der letzten Reise, vor allem unter Koliken. Er spürte das nahende Alter. Seine Frau war schwanger. Doch die Admiralität wollte niemand anderen als ihn für das Kommando. Während eines Abendessens bei seinem Förderer, dem Earl of Sandwich, sagte er schließlich zu.
Cooks Karriere stand beispielhaft für den zaghaften Beginn einer Entwicklung, wonach große Führungsgestalten nicht mehr nur den oberen Gesellschaftsschichten entstammten. In einer Hütte als Sohn eines Tagelöhners in Yorkshire geboren, hatte er zuerst in einem Laden gearbeitet, um sich als junger Mann auf Kohletransportschiffen als Matrose zu verdingen. Seine Härte, sein Pflichtbewusstsein und seine Disziplin brachten ihn voran. Cook galt als streng, aber gerecht. Aus seinem zerklüfteten Gesicht mit schmalem Mund funkelte ein stechender Blick. Gefühlen ließ er kaum einen Raum, nur seine Wutausbrüche waren berüchtigt. Bei allem Erfolg vergaß er nie seine Herkunft, weshalb er das von ihm Erreichte auch immer ein wenig bedroht sah. Von Statur schlank, breitschultrig und mit etwa 1,83 Meter für seine Zeit überdurchschnittlich groß, fiel er durch seinen gebeugten Gang auf, den er in all den Jahren auf Schiffen angenommen hatte, um nicht ständig mit seinem Kopf an Balken zu stoßen.
Cooks pflichtgeneigtem Wesen kam ein junger Unteroffizier entgegen, der für die Reise neu auf die Resolution berufen worden war. Zart, mittelgroß, vielleicht sogar etwas kleiner als der Durchschnitt, mit schwarzen Haaren und heller glatter Haut. Ein in jenen Tagen, vielleicht kurz vor der Abreise angefertigtes Porträt zeigt einen jungen Mann in der Uniform eines Masters – mit weichen Zügen, einem runden Gesicht und einem melancholischen Blick, der offen lässt, ob er sich nach innen oder in die Ferne richtet. Eine Hand ruht, einen Zirkel haltend, auf einer Karte. Im Hintergrund nimmt ein Schiff unter Segeln Kurs auf den Horizont.
Dieser junge Mann hieß William Bligh. Er stammte aus einer Seefahrerfamilie. Nicht ungewöhnlich für die Zeit, fuhr der nun 22-Jährige schon seit seinem 8. Lebensjahr zur See. Längst zeigte er großes Talent als Navigator und Kartograph. Wie Cook war er diszipliniert und unerbittlich genau, doch Untergebene lobte er noch seltener, neigte zu Wutausbrüchen und erteilte rasch Verweise. Das bekam auch bald ein weiteres junges Mannschaftsmitglied zu spüren: der spätere Entdecker George Vancouver. Auf der zweiten Reise Cooks noch der Jüngste der Mannschaft, war er diesmal als Fähnrich zur See dabei.
Cook wählte die Südroute um Südafrika herum, um sich dann über den Pazifik der erhofften Passage zu nähern und sie von West nach Ost zu erforschen. Zunächst segelte die Resolution allein bis Kapstadt. Am 10. November stieß das Begleitschiff Discovery zu ihr. Dann nahm man Kurs in den südlichen Indischen Ozean, in Richtung eines Archipels, der noch immer keinen festgeschriebenen Namen trug. Von dort wollte Cook nach Tasmanien segeln.
An der Küste der Ostsee lebte derweil ein Mann von ähnlicher Statur wie Lichtenberg: zart gegliedert und etwas zerbrechlich. Mit ungefähr 1,57 Meter war er dennoch mit etwas mehr Körpergröße beschenkt als sein noch nicht einmal 1,50 Meter kleiner Professorenkollege in Göttingen.
Immanuel Kant, von dem hier die Rede ist, wusste schon immer um seine fragile Gesundheit und lebte danach. Er ahnte, anstrengende Reisen sollte er besser meiden. Zudem fühlte er sich im ostpreußischen Königsberg pudelwohl. Die Stadt war nicht mehr politische Hauptstadt Preußens, verstand sich aber noch immer als geistiges Zentrum. Die Krönungsfeierlichkeiten fanden nach wie vor hier statt.
Am 22. April war Kant 52 Jahre alt geworden. Er stammte aus der pietistischen und in bescheidenen Verhältnissen lebenden Familie eines Sattlers. Kants fromme Eltern schätzten eine gute Geistes- und Herzensbildung und förderten diese bei ihren Kindern. Vier ihrer acht Kinder erreichten das Erwachsenenalter, unter ihnen der begabte, auf den Namen Emanuel getaufte Sohn, der sich später Immanuel nennen sollte. Er finanzierte sein Studium neben Privatstunden auch mit Kartenspiel und Billard, das er brillant beherrschte. Im Vorwort seiner ersten, in seiner Studienzeit entstandenen Schrift hatte der damals 22-Jährige selbstbewusst erklärt: »Ich habe mir die Bahn schon vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werde meinen Lauf antreten, und nichts soll mich hindern, ihn fortzusetzen.«
Nach dem frühen Tod des Vaters musste Kant sehen, wie er Mutter und Geschwister unterstützen konnte. Er verdingte sich als Hauslehrer, bemühte sich aber weiter um eine Professur und erhielt diese 1770 mit 46 Jahren. Seitdem lehrte er Logik und Metaphysik. Seine Vorlesungen waren geistreich, lebendig, und die Studenten, deren Beiträge sein Einkommen ausmachten, strömten in Scharen zu ihm.
Als Kant die für die Professur vorzulegende Dissertation überarbeiten wollte, hatte er in seinem Kopf eine Reise angetreten, die er auf Papiere zu bannen versuchte und die andere Grenzen überschritt als Reisen in der tatsächlichen Welt. In diesen Tagen widmete er sich mehr und mehr seinen immer komplexer werdenden Gedankenwelten. Er hatte die Zahl seiner Vorlesungen verringert, veröffentlichte nicht mehr und glaubte immer mal wieder, bald fertig zu sein. Nun, am 24. November, ließ er Marcus Herz per Brief wissen, »vor Ostern nicht fertig zu werden«.
Seit dem Sommersemester amtierte Kant als Dekan der Philosophischen Fakultät von Königsberg. Das Amt belastete ihn. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die neuen Studenten zu prüfen, und bald warf man ihm vor, dies allzu nachlässig zu tun. Auch gebe er ihnen zu viel Freiheit. »Ich empfange von allen Seiten Vorwürfe, wegen der Untätigkeit, darin ich seit langer Zeit zu sein scheine und bin doch wirklich niemals systematischer und anhaltender beschäftigt gewesen«, klagte er.
Magnifique! Der menschgewordene Geist einer neuen Gesellschaft traf ein. Am 3. Dezember betrat Benjamin Franklin französischen Boden. Einen Monat zuvor hatte er, gerade vom Kontinentalkongress zum Botschafter am Hof König Louis’' XVI. bestellt, in Amerika ein Schiff bestiegen. Er ließ sich in Passy, einem Ort nahe Paris, nieder, mietete eine Villa auf einer Anhöhe mit weitläufigem Garten und genoss den Umgang mit den Damen der örtlichen Gesellschaft. Besonders oft besuchte er den Salon der Witwe des Philosophen Helvétius im benachbarten Auteuil.
In Frankreich schlug Franklin sofort nahezu grenzenlose Verehrung entgegen, und bald war sein Gesicht »fast genauso bekannt wie das des Mondes«, wie er seiner Schwester nach Hause berichtete.
Während Franklin jetzt in Europa versuchte, auf diplomatischem Wege die amerikanische Sache voranzubringen, versuchte sein Schützling Thomas Paine auf der anderen Seite des Atlantik, den Bürgern der Kolonien mit einfachen, ermutigenden und sogar aufrüttelnden Worten den Sinn des Kampfes nahezubringen, den immer mehr von ihnen unter Einsatz ihres Lebens führten. Er verfasste zwölf Pamphlete. Sie erschienen nacheinander mit dem Titel American Crisis. Der erste Text, veröffentlicht am 19. Dezember im Pennsylvannia Journal, begann mit dem berühmt gewordenen Satz »Dies sind die Zeiten, die die Seelen der Menschen auf die Probe stellen« (»These are the times that try men’s souls«). Denn an der Front stand es schlecht. Er wusste es genau, denn seit wenigen Monaten gehörte er als Mitarbeiter zum Stab George Washingtons.
Seit der Einnahme von Boston war für George Washington und seine Männer Niederlage auf Niederlage gefolgt. Ende August konnte der britische General William Howe durch den Sieg in der Schlacht auf Long Island den Zugriff auf den Hafen von New York erringen. Mangelnde Erfahrung, zahlenmäßige Unterlegenheit der Truppen und unklare Befehlswege in Washingtons Stab hatten zu einer demütigenden Niederlage geführt.
Am 8. September hatte Washington an den Kontinentalkongress geschrieben: »Wir sollten in jedem Fall einer großen Entscheidungsschlacht aus dem Weg gehen«, was er bald zu seiner Taktik machte. Nach weiteren Niederlagen in den Schlachten von White Plains und Fort Washington, dem Verlust nicht nur Manhattans, sondern ganz New Yorks war Washington dem Feind fast nur noch ausgewichen und hatte sich schließlich nach Süden zurückgezogen. Immer wieder attackiert von den Briten, ging es nach New Jersey und schließlich über den Grenzfluss Delaware nach Pennsylvania. Die Männer waren entkräftet, demoralisiert und litten Hunger. Die Mannschaftsstärke nahm dramatisch ab. Jetzt, vor Weihnachten, desertierten viele. Bei anderen endete die Dienstzeit ganz regulär. Sie würden in den nächsten Tagen nach Hause gehen. Unter Washingtons Generälen, von denen einige sich sowieso für die besseren Befehlshaber hielten, wie etwa Horatio Gates und Charles Lee, schwand das Vertrauen in ihren Oberbefehlshaber. Mancher zeigte offen seine Missbilligung.
In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag tat George Washington das, womit weder Freund noch Feind rechneten: er entschloss sich zum Angriff. Er und seine Männer bestiegen mehrere Boote und überquerten den Delaware. Auf der anderen Seite des Flusses wollte er im Morgengrauen den Feind überraschen und das Dörfchen Trenton einnehmen.
Die Überquerung des Flusses wurde zu einem logistischen Meisterstück. In zehn Stunden gelang es, fast 2500 Kämpfer überzusetzen. Danach mussten die Männer, unzureichend bekleidet und häufig nur mit um die Füße gewickelten Lumpen, noch einen vierstündigen Fußmarsch durch die Winterkälte nach Trenton bewältigen, einem Flecken mit zwei Straßen und wenigen Dutzend Häusern. Dort hatten sich drei Regimenter »Hessians« einquartiert, die bei den Amerikanern wegen ihrer effektiven und rücksichtslosen Kriegsführung mit weit besserer Ausrüstung gefürchtet waren. Der Landgraf von Hessen-Kassel hatte zum Teil zwangsrekrutierte Soldaten aus seinem Land gegen Geld an den britischen König verliehen.
Um 8 Uhr in der Frühe gelang Washington der Überraschungsangriff. Nach kurzem Straßenkampf gehörte ihm der Sieg. 22 Hessen waren tot. Washington musste nur zwei Tote beklagen. Sie waren auf dem Weg nach Trenton erfroren. Noch am gleichen Tag setzte er mit seinen Truppen, den erbeuteten Waffen und den gefangenen Söldnern wieder über den Eisschollen tragenden Delaware. Im etwa 30 Meilen südwestlich gelegenen Philadelphia ließ er die Gefangenen durch die Straßen laufen, um den Sieg zur Schau zu stellen. Allerdings rechnete er mit einem Gegenangriff der Briten, und in der Tat näherte sich schon General Charles Cornwallis mit eilig aus den Winterlagern geholten Truppen. Einem Angriff wollte sich Washington erneut in Trenton entgegenstellen. Am 30. Dezember überquerte er abermals den Delaware, zog mit seiner Armee wieder in die Stadt und begann sich an deren Rändern zu verschanzen.
Im südlichen Indischen Ozean erreichte Cook zu Weihnachten den besagten Archipel ohne festgelegten Namen. Schon auf der Reise zuvor hatte er hier mit Reinhold und Georg Forster Station gemacht. In einem Logbucheintrag bezeichnete er diesmal den Archipel, eine große schroffe Hauptinsel mit zahlreichen verstreuten Eilanden, als die »Inseln der Trostlosigkeit« (»Islands of Desolation«), nannte sie dann aber Kerguelen-Inseln, nach ihrem vermutlichen Entdecker, dem französischen Kapitän Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec.
In London lebte währenddessen Cooks ehemaliger Reisebegleiter Georg Forster auf seiner eigenen selbstgewählten Insel der Trostlosigkeit. Das hatte noch immer mit den Buchprojekten zu Cooks letzter Reise zu tun. Nachdem die endgültige Absage des Earls of Sandwich an Vater Forster vorlag, hatte Georg Forster im Spätsommer angesichts der nach wie vor großen Geldnot der Familie damit begonnen, selbst ein Buch über die Südseereise zu verfassen.
Seitdem arbeitete er Tag und Nacht in nahezu jedem wachen Moment, verließ kaum das Zimmer und litt unter Kopfschmerzen, Durchfall und Erkältung. Am letzten Tag des Jahres klagte er seinem Freund Vollpracht: »Ich habe mich krank gearbeitet und bin diese zwei letzten Monate November und Dezember höchst elend […] fast zum Skelett geworden«.