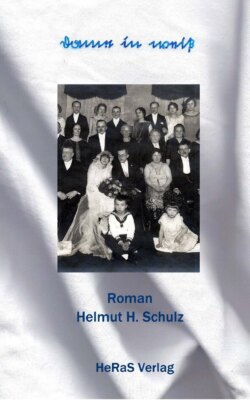Читать книгу Dame in Weiß - Helmut H. Schulz - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 3
An jenem Tag war mir klar, dass sich etwas unwiderruflich in meinem sechs Jahre alten Leben verändern würde. Alles sprach dafür: die Gewichtigkeit, mit der sich mein Vater anzog, die Krawatte umlegte, die bunte Schultüte, ein nach frischem Leder duftender Schulranzen, eine im Holzrahmen steckende Schiefertafel und ein schmaler rechteckiger Kasten für Griffel. An langer Schnur sah aus dem Ranzen ein Schwamm hervor.
Erhöht wurde mein Missbehagen durch Wollstrümpfe, die meine empfindliche Haut reizten, ein Paar neue Schuhe, deren Kappen drückten, obwohl Verena sie mit dem Hammer weichgeklopft hatte. Ich weigerte mich vergeblich, eine Mütze aufzusetzen; es ging auch nicht um die Mütze. Ich wehrte mich noch gegen den Zwang, aber ich ahnte schon, dass ich verlieren würde, schon verloren hatte.
»Die werden dir schon Zucht beibringen«, verhieß mein Vater, um sogleich zu mildern: »Vielleicht gefällt es dir ja auch.«
Ich war erschöpft, bevor ich der Schule überhaupt begegnet war, und hatte ein Gefühl äußerster Hilflosigkeit. Diesem Zustand entsprang ein Gegenmittel, stachelte mich zu etwas an, das Hass auf meinen Vater, auf alles, was sich anschickte mich in Zucht zunehmen, sehr ähnlich sah.
»Also gehen wir«, mein Vater stülpte den Hut auf, zog ihn mit beiden Händen zurecht, und Verena, die nicht mitging, sondern uns auf dem Rückweg abpassen wollte, knöpfte mir den Mantel zu. Es muss an meinem Einschulungstag kalt oder zumindest kühl gewesen sein. Zuletzt hängte sie mir den Ranzen um die Schultern; eine kleine Tasche, die Brottasche, baumelte an meiner Hüfte. Meine Mutter gab mir einen Kuss, und mein Vater, der adrette Buchhalter, griff nach der Schultüte, die in meinem Falle Attrappe war, denn ich verabscheute Bonbons und Schokolade.
»Dein Vater hat gesagt, tu mir den Gefallen und mach ein anderes Gesicht.« Ein Einwand Verenas, den ich etliche Male gehört hatte. Ich hatte Grund, schlecht aufgelegt zu sein, bei dem, was mir geschah; ein riesiges graues Haus, dessen Tor wie eine Falle hinter mir zuschnappte, eine Herde anderer Jungen mit ihren Vätern, Müttern oder mit beiden. So füllte sich der Hof mit bedrückten kleinen Menschen und ernsten großen.
Grau bestimmte hier alles, die Wände, die Flure mit den langen Hakenreihen zum Aufhängen der Mäntel, die Klassenzimmer, die fest miteinander verschraubten Bankreihen. Es gab keine Teppiche, keine Gardinen wie in meiner gewohnten Umgebung, keine Möbel, mit Ausnahme der Bänke, einem Schrank und dem Lehrerpult, Dinge, die ich nicht als Möbel ansah; und vor allem sog ich den Geruch von Angst, die Ausdünstung von Schmutz, Schweiß und etwas Unbeschreibbarem ein, jenen Geruch, den Kasernen, Schulen, Internate und ähnliche Einrichtungen besitzen, der wie ein Lähmungsgift wirkt. Die anderen zu beachten, hatte ich keine Zeit; mit mir beschäftigt, sah ich nicht, was sie taten, aber unterdrücktes Heulen drang doch in meine Ohren, und meine Nase witterte Angstschweiß, der aus den Poren erregter Kinder aufstieg.
Das Tor hatte sich hinter uns geschlossen; ein krummer Kerl im Drillichanzug stand grinsend Wache, und ich gewahrte, dass die Großen darangingen, der Sache eine andere, heitere Seite abzugewinnen; sie begannen sich miteinander bekannt zu machen, die Hüte zu ziehen, sich die Hände zu schütteln und Eindrücke auszutauschen; sicherlich kannten sich die einen oder anderen bereits.
Mein Vater hielt sich etwas abseits, ich musterte ihn. Heute übertrage ich Äußerliches, später Gesehenes auf die frühe Episode: Der im Stehkragen mit umgelegten Ecken kann nur in eine frühere Zeit gehören. Christoph ist damals ein nicht sehr großer, weder zur Korpulenz neigender noch hagerer Mann gewesen; in den eleganten Sachen bewegte er sich ohne übertriebenes Gehabe, die Sachen passten zu ihm, er schien für sie gemacht. Seine Hände öffneten eine Schachtel Overstolz, um eine Zigarette herauszunehmen. Dann besann er sich wohl darauf, wo er war, und ich sah, wie ein paar ältere Herren den Schulhof betraten. Einer von ihnen redete die versammelten Eltern laut an. Ich verstand nicht, was er sagte, aber nach dieser Rede zog mich mein Vater in eine Ecke des Schulhofs zu einer Gruppe anderer Jungen. Nach und nach selektierten die Lehrer ihre Zöglinge aus der Masse Kinder, und allmählich löste sich die Menge auf, mit dem Ergebnis, dass drei erste Klassen gebildet worden waren.
Unser Lehrer führte uns ins Klassenzimmer, blind folgte ich der Herde, jetzt getrennt von meinem Vater, der mit den übrigen Eltern ein Stück zurückblieb. Und hier auf dem Wege ins Klassenzimmer entdeckte ich die furchtbaren Wahrheiten, die auf mich warteten. Der Geruch dieses Hauses trog nicht. Ich war schon untergegangen in der Masse Abzurichtender, und ich hasste meinen Vater, weil er mir nicht half. Ich belegte irgendeine Bank, ohne auf meinen Nachbarn zu achten, schob, wie uns der Lehrer geheißen, die Mappe unter die Bank, die Brottasche daneben, brachte meinen Mantel auf den Flur und hängte die verhasste Mütze an einen Haken, ahnend, dass die lächelnde, geduldige Nachsicht mit unserer konfusen Unerfahrenheit der anwesenden, uns schützenden Eltern wegen vorgetäuscht war. Alle diese geforderten Verhaltensweisen würden zu festen Regeln werden, zu einem System von Lob und Tadel, Anerkennung und Strafe. Außerdem konnten die unbeaufsichtigten Sachen wegkommen oder gestohlen werden.
Wir saßen; man bedeutete uns, wir sollten die Hände auf dem Pult falten, wie beim Gebet in der Kirche, und nicht mit den Füßen scharren; auch hätten wir den Mund zu halten. Längs der Wände standen die Eltern, ihren nach Fassung ringenden Sprösslingen zunickend oder ihnen drohend. Auch mein Vater stand dort, aber er hielt sich weit ab von mir, absichtlich, wie ich glaubte.
Nun verlas unser Lehrer die Namen der Kinder. Jedes erhob sich aus der Bank und sagte hier, worauf der Lehrer den Jungen musterte und ihn sich wieder setzen ließ. Mein Name kam, ich nahm ihn wohl auf, reagierte jedoch nicht, obwohl ich den Vorgang durchaus begriffen hatte. Der Lehrer musste meinen Namen mehrmals wiederholen. Die Eltern reckten ihre Hälse, und die Kinder sahen sich nach mir um. Schließlich stand ich auf und sagte mein hier, wie es verlangt wurde. Aufbrandendes Gelächter zog Kindern, Eltern und Lehrern meinen Zorn zu, aber ich heulte nicht. Mir war klar geworden, dass Tränen hier nichts nutzten, sondern nur als Zeichen der Unterwerfung gedeutet wurden. Den Heulern legte der Lehrer die Hand auf den Kopf oder zog sie an sich, wie ich beobachtet hatte. Mir waren Menschen immer verdächtig, die mir ihre körperliche Nähe aufdrängen wollten; ich ging ihnen aus dem Wege, und wie richtig meine Ahnungen waren, erwies sich an Lehrer Zissel sehr bald. Nach dem Aufrufen hoffte ich für heute entlassen zu werden, aber uns wurde erst ein Märchen vorgelesen, eines jener Märchen, die ich durch Mutter oder Tanten längst kannte. Nicht dass ich heute noch sagen könnte, welches Märchen Herr Zissel vorlas; aber der Ton, die Stimmung sind mir deutlich. Über den Buchrand schickte der Lehrer lauernde Blicke in Richtung der Klasse, ohne Grund und Anlass, einfach aus Gewohnheit zu beobachten, sich hintergangen zu fühlen. Dann endlich schlug die Stunde der Freiheit.
»Du sollst dich benommen haben wie ein Schwachkopf«, Verena deutete diese Episode gewiss hunderte Male in ihrem Leben, sie gab ihr den Wert eines Tests. »Dein Vater kam deinetwegen sehr niedergeschlagen nach Hause, denn du warst ja sein ganzer Stolz. Keiner von uns verstand dich. Hier und vor allem bei deinen Großeltern musste man dich eher bremsen. Wir hatten erwartet, du würdest begreifen, was mit dir geschah.«
Das kam später, viel später. An jenem Tage gingen wir schweigend nach Hause. Auf einem Platz lief uns Verena entgegen, ein Mann mit einem schwarzen Apparat saß auf einer Parkbank. Als er uns kommen sah, baute er ein Gestell auf und setzte den Kasten darauf. Wir stellten uns vor ihm hin, mit Tüte und ohne Tüte, mit Verena und ohne sie, mit meinem Vater, ohne ihn und schließlich alle zusammen. Die Sonne brach hervor, es wehte ein scharfer Wind, und die Haut an meinen Schenkeln brannte von der Berührung mit den rauen Wollstrümpfen. Verena drückte mich an sich, und als wir gingen, vergaß ich die Schultüte. Sie blieb auf der Bank zurück, und ich setzte mich dem Verdacht aus, sie absichtlich liegen gelassen zu haben.
Eine Masse Gewalt gewordener Ideologie scheint mir meine Familie heute; mein Großvater Friedrich Wilhelm erstrahlte erdbraun. Mein Vater Christoph trug das Schwarz einer Organisation, die sich Werkschar nannte. Etliche Onkel und Vettern waren Soldaten, die Frauen gehörten verschiedenen Vereinen an, der NS-Frauenschaft vorzugsweise, und der Allen vermittelte Optimismus entlud sich gelegentlich in prahlerischer Heiterkeit. Nur der alte Mattias umkreiste wie ein Wolf im zivilen Grau den Haufen Zukunftssüchtiger, und meine Tante. Barbara verspottete die Bundschuhweiber in den weißen Halbsöckchen, den straff gekämmten Haaren mit dem kleinen Zwiebelknoten, verspottete die wabbelnden Formen. Ausgenommen der alte Mattias, arbeitete keiner in Betrieben oder wenigstens Branchen, wo Einsicht in die Verhältnisse möglich gewesen wäre. Von seinen drei Töchtern hatte mein Großvater bisher nur eine verheiratet. Dank dieser Schwäche meiner Familie blieb ich vorerst das erste und letzte Kind, an dem alle teilhaben wollten.
Ich trottete morgens zur Schule, immer denselben Weg, den mir meine Mutter eingeprägt hatte. Verena brachte mich nur die ersten Tage und holte mich auch nur wenige Tage ab.
Die Straßen waren kaum befahren, gegen halb acht überquerte ich den Damm der Hallandstraße und musste ein paar Straßen kreuz und quer gehen bis zur Schule, bis zu dem großen Tor, das sich für ein paar Stunden hinter mir schloss. Ich kam zu spät, wenn mich etwas ablenkte, einmal ein gestürztes Pferd. Mich interessierte, wie der Kutscher eine Decke unter die Vorderbeine des Tieres legte. Es stellte sich heraus, dass der eine Vorderfuß gebrochen war. Er knickte immer wieder ab, und der Kutscher begriff sein Missgeschick zu spät; er prügelte noch eine ganze Weile auf dem Gaul herum, bis ein paar Leute stehen blieben und sich für die Kreatur ins Mittel legten. Das Bild ist fest in meinem Kopf geblieben: Wintermorgen, frisch gefallener Schnee, ein scharfer, aufweckender Geruch, brennende Laternen und das sich abmühende Pferd.
Aus Furcht und Nervosität vergaß ich viel, z. B. Zählpfennige für die Rechenstunde; die Griffel quietschten auf der Schiefertafel, es war ein mühseliges und erfolgloses Üben, die Griffel brachen leicht entzwei, wenn der Kasten herunterfiel. Es gab eine Fibel mit Buchstaben und Silben, die wir beim Lesen zu Wörtern zusammensetzen mussten, das ist 0-ma, O-ma und O-pa. Bald begriff ich, dass diese magischen Zeichen den Schlüssel zu einer mir unbekannten Welt bildeten, dass die Bücher im Schrank meiner Eltern aus ebensolchen Zeichen zusammengesetzt waren und dass ihre Kenntnis einen bestimmten Besitz bedeutete. Für das Rechnen fand ich vorerst noch keine reale Beziehung zu meinem Leben. Religion war ein Pflichtfach an der Volksschule, wie sie jetzt hieß - von der Gemeindeschule zur Volksschule, ein Begriffswandel, noch wurde Religion unterrichtet, und so entsprach die Gemeindeschule der einstigen Kirchengemeinde, und nicht lange zurück, da übte die Kirche auch Kontrollen über die Schule aus.
Auf der Suche nach Vorbildern entdeckten wir, Goll, Bruchner, Jendokeit und ich, Hans Stadel, die Nachmittagsvorstellungen der Kinos. ›Tom Mix, der Held von Texas›, ›Der Weiße Adler›, solche Titel sind mir in Erinnerung geblieben, nicht aber die Inhalte der Filme, nicht, was eigentlich passierte. Immerhin richtete sich unser Wünschen auf den Besitz eines Federschmuckes, eines Gewehres oder Beiles, wir überfielen einander mit Geheul und konnten uns lange nicht für diese oder jene Rolle entscheiden, für Weiß oder Rot.
Ludwig Goll, Sohn eines Schriftleiters, uns sicherlich am weitesten voraus, wohnte mit seinen Eltern in der Kissingenstraße. Damals schon besaß er ein jugendlich-düsteres Gesicht. Er öffnete mir einen Weg zu sich und zu mir selbst, indem er mir seine Gemütsbewegungen schilderte, Goll verwies mich auf meine Seele, die eigentlich, laut Verena und unserem Katecheten, Gott vorbehalten bleiben sollte. Goll las auch schon ziemlich fließend. Klassenbester wurde er unter Lehrer Zissels Leitung aber nicht. Nur wir Kinder achteten in Goll den geborenen Führer. Zu Goll stand ich auf vertrautem Fuße, er lud mich häufig zu sich ein, um mir Klavierstücke vorzuspielen. Ich lernte Violine; und durch Goll begriff ich, dass Musik etwas anderes bedeutet als Verenas Schrulle, zumal Goll auch praktisch half, Takt und Notenwerte schon beherrschte.
Die Golls besaßen eine große Wohnung. Golls Vater arbeitete viel zu Hause. Alles drehte sich um den Redakteur. Zu uns kam Ludwig auch. Verena verhielt sich ihm gegenüber zurückhaltend. Manchmal spielten sie zusammen vierhändig.
Ebenso nahe, wenn nicht näher, stand mir Hansjoachim Jendokeit, ein Junge von brünetter Hautfarbe, mit schwarzem Haar, langgliedrigen Fingern, ein Praktiker, der Zierfische hielt, elektrische Klingeln baute und Fahrräder reparierte. Sein Vater war Kaufmann, Versicherungskaufmann. Was Goll sich überlegen erarbeitete, fiel Jendokeit in den Schoß. Er spielte Querflöte, verstand nichts von Takt und Noten, aber drängelte sich dank einem guten musikalischen Empfinden in Golls Sonaten, ohne zu stören. Er kam ebenfalls zu uns, und Verena fütterte ihn mit Keks und gab ihm Apfelsaft zu trinken.
Dieter Bruchner gehörte halb und halb zu uns, was kaum an ihm lag, er wurde von seiner Mutter streng gehalten. Sein Vater arbeitete am Theater, aber nicht als Schauspieler.
Außer diesen Freunden gab es noch Zugvögel, die eine Zeit lang kamen, wegblieben, wieder einflogen und sich erneut zurückzogen, wie Schott, dessen Vater ein Farbengeschäft besaß. Schott, der immer reichlich mit Geld versehen war und dessen Grinsen wir alle als abstoßend empfanden.
Aus welchem Grunde wir vier oder zeitweilig fünf uns zusammenfanden, drückte der allwissende Ludwig so aus: »Wir gehören zusammen, wir machen doch diese Pantinenschule nur noch zwei Jahre mit.«
Dank meiner Freunde überwand ich die Furcht vor Lehrer Zissel und fasste das Ziel in den Blick, der Pantinenschule möglichst schnell zu entrinnen.
›Treptow in Flammen›, Verena und mein Vater würden in Urlaub fahren, ich sollte zu Mattias nach Wendisch-Rietz oder in die Berliner Wohnung. Wir fuhren mit einem neuen, gebraucht gekauften Wagen nach Treptow, Verena, mein Vater, ich und meine Freunde, um Abschied zu feiern für die Dauer der Ferien. Den Wagen hatte der alte Mattias bezahlt, und wir waren die Ersten aus unserem Bekanntenkreis, die ein Auto besaßen.
Es war eine große Limousine, durch ein Glasfenster im Innenraum geteilt. Verena hatte die Scheibe zurückgeschoben, um mit uns reden zu können, wahrscheinlich mehr noch, um zu hören, was wir redeten.
»Ihr habt geredet, was kleine Jungen so reden, ihr ward natürlich begeistert von dem Auto, von der Fahrt und den in Aussicht stehenden Vergnügungen.«
Treptow in Flammen, damals ein wöchentliches Großfeuerwerk. Als wir in dem Vergnügungspark ankamen, waren wir überwältigt: die Menge Menschen, der Lärm, das Angebot an Möglichkeiten.
»Ihr wolltet unbedingt alles oder soviel wie nur möglich sehen und machen.«
Ich erinnere mich an einen Mann, der mit einer Riesenkanone auftrat. Goll vermutete: »Der schießt sich selbst in die Luft.«
Ich hielt es für unmöglich sich in die Luft zu schießen, ohne getötet zu werden, aber Goll zuckte die Schultern: »Mein Vater hat so was erzählt, ich glaube, die Zeitung musste es einrücken.«
Damit wurde das Unmögliche wahrscheinlich.
Das Rohr der Kanone wurde hochgedreht, mit aller Umständlichkeit zogen die Gehilfen des Artisten ein Netz. Das Rohr ragte steil in den Himmel, und es wurde zur Gewissheit, dass sich dieser Mann in die Luft schießen lassen würde.
»Es ist ungefährlich«, sagte mein Vater, »wahrscheinlich ist eine Art Sprungfeder in dem Rohr, und es kommt nur darauf an, dass der Mann in das Netz fällt.«
Goll nickte spöttisch, und seine Miene machte mir bewusst, dass sich mein Vater albern benahm, sich und uns über die Gefahr hinwegtäuschen zu wollen.
Nun stieg der Mann noch in einen Schutzanzug, ich verstand, dass er die Spannung in diesen Sekunden erhöhen wollte, aber ich konnte jetzt keine Spannung mehr empfinden, nachdem Goll die Sache derart abgetan hatte. Nur Verena nahm alles für bare Münze, wie ich ihren ängstlichen Blicken entnahm. Endlich kletterte der Mann durch einen Einstieg in die Kanone. Der Schuss krachte, oben flog der Mann aus dem Rohr und landete mit ausgebreiteten Armen im Netz. Ein bisschen Bewunderung kam über uns.
Jendokeit sagte: »Hat geklappt.«
Mein Vater nickte. »Wollt ihr was trinken oder essen?« Wir suchten ein Zelt auf und aßen etwas, dann trollten wir zum Karussell, zum Riesenrad, und allmählich senkte sich der Abend, das große Feuerwerk begann, die Liebesinsel leuchtete rot, grün und weiß.
»Deine erste Zeit in der Volksschule«, Verena lächelte nachsichtig.
Wir standen im Treptower Park auf der Höhe der Sternwarte, seit jenem Tag des Feuerwerks waren viele Jahre vergangen. In der Allee wuchsen Ahornbäume, ihre Rinden schimmerten hell wie die Haut weißer Elefanten. Zu Tausenden hingen die stachligen Samenkapseln in den Zweigen. Der Refraktor der Sternwarte war ausgefahren, das Rohr stand spitzwinklig über dem Dach des Gebäudes, und mir fielen die Nächte ein, die ich hier vor Jahrzehnten mit meinem Vater verbracht hatte, in Beobachtungen und Berechnungen vertieft.
»Ludwig war ein ernstes Kind, aber auch sehr vorlaut«, sagte Verena, »ich hätte dir geraten, den Umgang mit ihm einzuschränken, wäre das möglich gewesen. Ich wusste, dass ihr zwei Jahre später ohnehin auf dem Gymnasium zusammentreffen würdet. Ich ging mit deiner Schwester, das war übrigens der Grund, weshalb wir dich in diesen Ferien nicht mitnahmen.«
Das stimmte, und doch sagte sie die Unwahrheit. Wie immer suchte sich Verena als unschuldig darzustellen, wie immer bemühte sie das Schicksal; wir konnten nicht anders, an uns hat es wahrlich nicht gelegen.
»Mama, ihr habt euren Urlaub stets allein verbracht, ich war euch im Wege.«
»Wie kannst du das sagen!? Wir hätten dich ...? Im Wege bist du uns nicht gewesen, wir haben alles für dich getan, alles. Einmal haben wir dich zumindest mitgenommen.«
Sie hatten mich mitgenommen nach Heringsdorf, aber vierzehn Tage darauf reiste ich mit dem alten Mattias nach Berlin zurück und weiter nach Wendisch-Rietz,
»Damals war ich mit Felix schwanger; und ich habe mich geschämt vor dir, einem großen Jungen.« Sie schob ihren Arm unter meinen und führte mich weiter. »Gibt es das Eierhaus noch? Ich meine, wir sollten einkehren?«
»Das ist zu weit, Mama. Wir fahren nachher in ein anderes Lokal.«
Sie gab sich zufrieden. Wir gingen hinunter zum Wasser und sahen hinüber zur ehemaligen Liebesinsel.
»Schrecklich ist diese Sucht, heute alles mit neuen Namen zu belegen.«
Ich fand das zwar auch, sagte aber nichts, denn was sie Sucht nannte, entsprang dem Bedürfnis, sich anzueignen, was einst anderen gehört hatte, in Besitz zu nehmen durch neue Namen, ein magischer Akt.
»Eher wohl Überredung, Täuschung.« Sie ahnte, was ich dachte, zwischen uns gab es seit Langem keine Geheimnisse mehr. Wir spielten unsere Rollen, unser Spiel um Vergangenheit und Gegenwart.
Sie kehrte zum ersten Gegenstand unseres Gespräches zurück. »Hat es dich getroffen, dass Ludwig damals erkrankte?«
Es war eine meiner schlimmsten Erinnerungen. Wir hatten im Park gespielt. Mit einem selbst gebauten Wagen, einem ehemaligen Kinderwagenchassis, waren wir zu dritt einen Berg hinuntergerollt, immer wieder und mit allem Mutwillen, der in solch ein Spiel kommen kann, mit Rempeln und Stoßen, bis sich Goll am Knie eine Risswunde zuzog. Aus der Verletzung entwickelte sich eine Hüftgelenkentzündung, Ludwig lag monatelang in Gips, und als er aufstand, zeigte es sich, dass sein Bein steif geworden war.
»Es war beinahe steif«, sagte Verena, »und das Schlimmste ist, dass du dir die Mitschuld daran gibst. Dein Freund Jendokeit, der Sohn dieses SS-Mannes, hat es natürlich leichter ertragen.«
Warnend drückte ich ihren Arm.
»Bin ich wieder zu weit gegangen? Habe ich nicht recht?«
»Du hast nicht recht, Verena Stadel, und letzten Endes haben wir es gerade nötig, uns über andere aufzuhalten.«
Auch Jendokeit fühlte sich damals schuldig. Wir besuchten Goll beinahe täglich. Er lag auf der Couch, seine Mutter pflegte ihn, und wir saßen um das Lager herum.
»Wenn du wieder auf bist, Weißer Adler, bauen wir uns eine Höhle.«
Goll sah Jendokeit prüfend an, dann entstand ein leichtes Lächeln auf seinem düsteren Gesicht.
»Wenn die Sieben Ratsfeuer lohen«, fügte ich hinzu, »und der Graue Biber wandert, dann wollen sich meine roten Brüder am Großen Felsen versammeln, um zu beraten, wie dem Weißen Adler zu helfen ist.«
Freundlich nickte Goll, aber ich hatte das Gefühl, ihm war unser kindliches Spiel schon recht gleichgültig geworden. Sein ›Howgh‹ klang mehr wie eine Höflichkeit als nach einer Zustimmung.
»Wir haben uns endgültig für die Apachen entschieden«, bemerkte Jendokeit. Er zog seine Flöte, blies hinein und spielte ein paar Takte eines selbst gefundenen Motivs. Wir fieberten im Sommer neununddreißig darauf, endlich die Schule zu wechseln. Zissel ging uns allen auf die Nerven. Er wusste, dass wir ihm bald entronnen sein würden.
»Solange ihr hier seid, habt ihr zu gehorchen, ich kann euch noch böse mitspielen.«
Es war Jendokeit, dem über die Hände geschlagen wurde, mit einem dünnen spanischen Rohr. Nur wenige Kinder hielten diese furchtbare Züchtigung aus. Jendokeit verbiss den Schmerz, die Tränen schossen ihm aus den Augen, nässten sein Gesicht, er hüpfte vor Schmerz von einem Fuß auf den anderen. Ich hielt vor Schreck und Mitgefühl den Atem an, spürte meinen Herzschlag. Lehrer Zissel hatte es darauf abgesehen, Jendokeit zu einem schreienden Bündel Angst herabzuprügeln, wir hörten das Keuchen des Lehrers, mit überschnappender Stimme befahl er: »Hände vor.« Jendokeit hielt die Hände jetzt hinter dem Rücken. Er weigerte sich, sie noch einmal hinzuhalten, lieber empfing er die Schläge über Schultern und Hals. Auch als er in seiner Bank saß, weinte er nur lautlos, und da er mein Nachbar war, spürte ich seine Erregung und Erschütterung, spürte aber auch seinen Mut und seinen Stolz. Und dann geschah noch etwas Unbegreifliches. Lehrer Zissel ging nach vorn, setzte sich hinter das Lehrerpult, legte den Kopf auf die Unterarme und heulte kindisch und ungehemmt. Die Klasse begann zu kichern, aus Jendokeits Kehle stieg das Lachen zuerst auf ...
»Dass du diese Übertreibungen nicht lassen kannst«, sagte Verena bei unserem Gang durch die Allee in Treptow, »ich bezweifle, ob du dich wirklich noch so genau an alles erinnerst, und du warst immer sensibel, wahrscheinlich hat keins der Kinder damals so empfunden wie du.«
»Heißt das: Du billigst diese Züchtigung?«
. »Jendokeit ist ein netter Junge gewesen, etwas wild vielleicht, sicher aber hat er eine dicke Haut gehabt.«
»Mama!«
»Reg dich nicht schon wieder auf«, ich merkte, dass sie mich zurückdirigierte, und mir war es recht. »Man soll nicht so schrecklich dick auftragen. Alles ist halb so schlimm, genau genommen«
Alles war halb so schlimm. Lehrer Zissel hielt die Klasse nach dem Morgengruß Heil Hitler, im Chor gesprochen und in soldatischer Haltung, immer noch einige Augenblicke fest, um uns die neuen Ereignisse mitzuteilen: Deutschland hat Österreich heimgeholt, Deutschland hat die Saar heimgeholt, Deutschland hat Memel heimgeholt, Deutschland hat die Sudeten heimgeholt, Großdeutschland, Deutschland, Deutschland über alles ...
Ich entsinne mich nicht der genauen Texte all dieser Reden, ich spüre noch die Stimmung, das allgemeine Gefühl, es geht aufwärts, es geht uns gut, wir sind was, wir haben was, wir werden noch mehr sein und noch mehr haben, und ich stand selbst zu oft unter den Wartenden, wenn der Führer in der schwarzen Limousine durch die Straße Unter den Linden rollte, stand dicht hinter der Postenkette, vor mir die paar Schritte Niemandsland mit der nächsten Postenkette, und wir besaßen ja auch ein Radio, hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen seinen Sendern. Erfolg über den Umweg des verheißenen und erfüllten Wohlstandes. Wahrlich, wer sollte gegen diese Männer sein?
»Genau das«, sagte Verena, »und der Blockwart, so was wie, ein Hausvertrauensmann heute, und der Luftschutz, so etwas wie Zivilverteidigung heute. Ich kann nur sagen, so viel hat sich nicht verändert ...«
In der Aula unserer Schule versammelten sich Lehrer und Schüler. An der Stirnwand des Saales befand sich ein Arrangement aus Fahnen, einem großen Führerbild und dem Rednerpult. Neben dem Pult der aufgeklappte Flügel. Sehr hoch über dem Bild und den Hakenkreuzfahnen ein Spruch: Leben ist Kampf, und wer nicht kämpfen will in dieser Welt des ewigen Ringens, verdient das Leben nicht.
Die kleineren Jungen saßen auf den vorderen Reihen der Bänke, der kriegerische Klang von Fanfaren, das dumpfe Schlagen der Trommeln, das Bewusstsein, vor einem Ereignis zu stehen, das uns betraf, die ernsten Gesichter der größeren Jungen in ihren Uniformen, das bunte Tamtam - alles versetzte uns in Spannung. Durch den frei gelassenen Mittelgang dröhnte der Gleichschritt, vierzehnjährige Jungen marschierten herein, betraten ohne Tritt das Podium und nahmen hinter dem Pult und vor dem Führerbild in einer langen Reihe Aufstellung. Jeder stemmte den Schaft seiner Fahne neben sich auf die Dielen, umklammerte die Mitte des Schaftes und ließ das Fahnentuch durch die freie Hand gleiten, Ruhe trat ein. Hinter uns begann ein Harmonium zu spielen, das Stück erkannten wir drei als eine Bach-Fuge. Nach dem Ausklingen des letzten Taktes sprach der Rektor, es war Krieg, es wurde zurückgeschossen, der Rektor war sicher, dass Polen in wenigen Wochen niedergeworfen werde, dass die deutsche Wehrmacht unübertroffen sei und dass uns kleinen deutschen Jungen auch eine Aufgabe zukomme, die der Vaterlandsliebe, der Treue zum Führer.
Während der Rektor sprach, behielten die großen Jungen mit den Fahnen ihre starren Gesichter, sie zuckten mit keiner Wimper, rührten kein Glied, und ich bewunderte ihre Standhaftigkeit, wusste ich doch, wie schwer es einem fallen konnte, ein paar Minuten lang stillzustehen. So wie diese Jungen sahen auch die Gesichter derer aus, die von den Kinoleinwänden herabstrahlten. Sie alle waren die Verkörperung des Hitlerjungen Quex, der von einer Bande schirmbemützter Strolche, für welche es keine Bezeichnung gab -Kommune, Rot-Mord reichten doch nicht aus, um meinen Kopf mit deutlicheren Bildern zu füllen-, ermordet worden war, ein Film, der uns mit Trauer, Hass auf irgendwas und Stolz auf uns selbst erfüllt hatte.
Nach der Rede des Rektors traten ein paar Jungen vor und sprachen einen Text: Deutschland! Fallen wir, Haupt bei Haupt ... Dazu präludierte und begleitete untermalend das Harmonium. Eine bedrückende, aber feierlich gehobene Stimmung breitete sich aus. Nach dem chorartigen Sprechgesang sprach unser Lehrer Zissel, er legte dar, dass kein Grund zur Besorgnis vorhanden sei, unsere Väter und Brüder ständen schon tief im Feindesland, unsere Stukas verbreiteten Angst und Schrecken, wenn die Piloten, junge Menschen gleich uns, ihre Maschine in die Feindziele todesverachtend hineinsteuerten, wir kannten das Geheul der Stukas aus den Wochenschauen. Nach dieser Rede sang die Versammlung stehend, mit erhobener Hand das Lied der Hitlerjugend. Zuletzt formierte sich der Trupp zum Abmarsch, und mit Trommeln und Fanfaren verließen sie die Aula. Für uns waren diese Jungen begnadet, heiliggesprochen ...
Sonst veränderte der Krieg vorerst nichts, jedenfalls spürte ich keine Veränderung bei den Großen. Erst im Verlaufe einiger Wochen stellte ich bei meinen Verwandten unterschiedliche Reaktionen fest. Was uns Jungen betraf, so interessierte uns die technische Seite des Krieges. Wir besaßen Sammlungen von Modellen der Flugzeugtypen, der Panzer und Schiffe und ähnlichen kriegerischen Krimskrams, wie er für ein paar Pfennige im Winterhilfswerk angeboten wurde. Wir schacherten Kriegsandenken, die irgendein Vater oder Bruder geschickt oder mit heimgebracht hatte, Granatsplitter, Waffen, Rangabzeichen, der Tauschmarkt auf, dem Schulhof war die eigentliche Kriegssensation.
Es gab auch schlimme Bilder in den Wochenschauen, zum ersten Mal wurden wir mit dem Schrecken konfrontiert, ermordete und zu Tode gefolterte Volksdeutsche, aufgenommen von Frontberichterstattern nach der Einnahme - Befreiung - polnischer Städte, unterlegt mit drohender Musik; wir wurden im ersten Kriegsjahr einer emotionellen Erziehung unterworfen, der wir uns nirgends entziehen konnten. Auf Schritt und Tritt standen wir Feinden oder Freunden gegenüber. Mit vereinfachenden Orientierungen sollten wir uns, zurechtfinden. Sollten wir uns zurechtfinden? Politische oder ideologische Erziehung im Kindesalter ist immer gleich mit dem Erwecken von Emotionen, mit Hassgefühlen oder mit Zuneigung gegen oder für etwas, das sich kindlicher Beurteilung entzieht, ein gelegtes Muster, dem man nicht mehr entrinnt. Unser Handeln vollzog sich auf der Basis der Zustimmung zum Krieg, zum Kampf als Lebensform; unser Hass auf den Feind bezog seinen Brennstoff aus der Angst vor einem ähnlichen Schicksal wie das gefolterter Volksdeutscher, und wir suchten immer wieder diese Filmaufnahmen. Die Gier nach dem Schrecken gehörte schon zu uns. Dieser Manipulationsvorgang ist uralt, es bedurfte keiner Wissenschaft, um die·Praxis voranzutreiben. Wer will, kann bei Xenophon, bei. Thukydides nachlesen, wie es gemacht wird: Der Feind ist immer böse. Seine Ziele sind immer verwerflich. Nicht nur, wer auf der Seite des Feindes steht, ist mit rabiaten Mitteln vom kämpfenden Volk auszuschließen, sondern auch der, welcher nach Wahrheit sucht, wo es keine Wahrheit mehr gibt.
Für gehobene Ansprüche lieferte die Presse differenzierteres Anschauungsmaterial. Jendokeit kannte die technischen Daten aller Maschinenwaffen, er hatte sie eher in seinem Kopf gestaut, als er einen der Lehrsätze des Euklid anwenden konnte. Wir begriffen sehr gut, dass die Überlegenheit der Waffen die Grundlage unserer Siege war, der beste Jäger, das beste Unterseeboot - und täglich, stündlich war Krieg für uns. Wenn die Sender ihre Übertragungen unterbrachen und die mit Fanfaren eingeleiteten Sondermeldungen ausstrahlten: Heute früh drangen deutsche U-Boote ... und wir suchten uns die Einzelheiten zusammen, ein U-Boot bezwang die Enge von Scapa Flow und torpedierte die britische Flotte zu Hause, der tollkühne U-Bootfahrer entkam sogar. Jagdflieger bemalten ihre Maschinen mit Symbolen für ihre Abschüsse, es entstand ein sportlicher Wettbewerb unter Soldaten um Tötungsquoten. Ihre Namen standen in den Zeitungen, ihre Bilder wurden gehandelt. Der Krieg ergriff von der Unterhaltungsindustrie Besitz - für ein Achtzig-Millionen-Volk war die erste Phase des Zweiten Weltkrieges zu einem Fußballspiel geworden, und in der Tat, die Prognosen trafen auch immer prompt ein: Polen fiel, der Eintritt Englands und Frankreichs in den Krieg bedeutete keine Änderung der inneren Situation.
Und schließlich geschah noch das Wunderbare, wir fanden in den Straßen Berlins endlich auch Granatsplitter.
»Ich hatte den Eindruck, dass ihr noch etwas in der Volksschule lerntet« - Verena am Klavier. Wir versuchten, uns wieder einmal näherzukommen. Ich sah voraus, dass auch dieser neue Versuch scheitern würde. Woran?
»An deiner Rechthaberei«, sagte meine Mutter. Sie sah merkwürdig aus unter der Bubikopfperücke, deren tiefschwarz nicht zu ihr passte. Auch die Größe der Perücke stand im Widerspruch zu ihrem kleinen Greisinnengesicht, den schmalen Lippen, die sie mit einem grellen Stift nachgezogen hatte. Ihr wuchs ein Altersbart, und ihre zerbrechlichen Finger konnten die Masse der Goldringe kaum halten, sie musste die Ringe abziehen, wenn sie Klavier spielte.
»Du siehst aus wie eine Mumie, Mama.«
»Findest du?« Sie zupfte an ihrer Bluse herum, strich den Rock über den Knien glatt und steckte sich die Ringe wieder auf.
»Ich meine, deine Versuche, jung zu wirken, sind albern.«
Sie erläuterte: »Du warst mit deinen zehn Jahren ein unausstehlicher Bengel, alles hatte ich von diesem ängstlichen und schüchternen Jungen erwartet, nur das nicht. Natürlich hattet ihr schuld, dass der arme Ludwig ein steifes Bein behielt, du und Hansjoachim, Du vergisst bei deiner Schilderung der damaligen Zustände allzu leicht, dass du alles mit heutigen Augen siehst, aus deiner heutigen Einstellung und deinem Wissen heraus. Damals befandst du dich in Übereinstimmung mit dir und mit dieser Volksschule.«
»Mama? Warum schickt man Kinder auf höhere Schulen, wenn sie doch nichts nutzen?«
Sie lachte. »Was hattest du erwartet? Oder richtiger, was hätten wir deiner Meinung nach damals tun sollen? Wir taten das, was auch heute Hunderttausende tun, wir opferten die paar Getreidekörner auf dem Altar des Staatskultes und gingen in andere Tempel, um uns zu amüsieren. Diktaturen sind immer aufdringlich, wie du vielleicht schon festgestellt hast, sie fordern immer nur im Namen eines unbegreiflichen Vehikels, des Staates, des Volkes, der Klasse. Wir beschränkten uns auf den erhobenen Arm, die zwanzig Pfennig für das Winterhilfswerk; wir klebten Plaketten an unsere Wohnungstür, wir flaggten an den geforderten Tagen.«
Hatte sie nicht doch ein bestimmtes Gefühl des Einverständnisses mit diesen banalen Handlungen ausgedrückt? Und kam es dem Staat nicht gerade auf dieses Einverständnis an?
»Sicher, darauf kam es an. Immer wenn bürgerliches Leben bis an die Grenze des Erträglichen strapaziert wird, bedarf es der Zustimmung durch uns, den Bürger, mag diese Zustimmung noch so unbestimmt ausfallen.«
Seit Jahrzehnten lebte sie mit ihren Vorstellungen, kam selten noch aus dem Haus und traf immer mit denselben Menschen zusammen. Sie suchte auch keine neuen Bekanntschaften, dafür erneuerte sie, auf sich gestellt, die alten und lebte stark aus Gelesenem heraus.
Sie bekannte: »Ich hatte das gleiche Pech wie du, zu einer unglücklichen Zeit aufgewachsen zu sein. Meine Schwester, die von dir vergötterte Barbara, später geboren als ich, durfte nach dem Lyzeum die Kunstschule besuchen. Auguste, noch später zur Welt gekommen, wurde Lehrerin. Nur ich musste neunzehnhundertachtzehn in die Lehre zu Max Hirsch. Du darfst nicht vergessen, dass drei Mädchen eine hohe Belastung für einen Lehrerhaushalt bedeuteten.«
»Ihr ward natürlich konservativ, katholisch, national, Zentrum?«
Meine Mutter überlegte einen Augenblick, dann sagte sie mit Nachdruck: »Nein, nichts von alledem. Nur wenige Menschen waren damals überhaupt ideologisiert. Die Monarchie war eine uralte Einrichtung, eine unumstößliche Tatsache. Sie hatte mit dem öffentlichen oder dem bürgerlichen Leben nicht das Mindeste zu tun. Der Kaiser galt als eine gottähnliche Person im Narrenkostüm des obersten Soldaten, made in Germany. Wenn es überhaupt eine Ideologie gab, dann war es, die Tradition.«
Ich hielt ihr entgegen, dass sie das Bürgertum ihrer Schicht im Blick hatte, dass eine Menge Leute die Gottähnlichkeit des Kaisers anzweifelten, dass die stärkste Partei die Sozialdemokratische gewesen ist, aber Verena stellte sich taub.»Vielleicht etwas später, nicht in der Periode, die ich meine.«
Es entstand eine Pause. Solche Pausen ließ Verena zu, wenn sie auf ein neues Thema überleiten wollte.
»Ich hätte ein humanistisches Gymnasium lieber gesehen als die Oberrealschule, aber dein Vater setzte sich in dieser Frage durch.«
Der alte Stadel hockte auf seinem Schreibtisch, den rechten Fuß, auf die Sitzfläche des Stuhles gestellt. Zwei Männer waren noch im Zimmer, Handwerker, die seit Langem für Stadel arbeiteten. Die Männer tranken Bier aus Flaschen. Ich saß auch im Zimmer und wollte mit Zeichenstift auf Papier festhalten, was ich sah: Die geröteten Gesichter der Männer, ihre langsamen Bewegungen, wenn sie aus den Flaschen tranken, brachte aber nichts zuwege.
Seit den Septembertagen murrte und maulte der alte Stadel herum. Schon leiser Widerspruch ließ ihn hochgehen wie eine Zündladung. »Der Herr mit der Schuhwichse unter der Neese«, und zu mir, »hör mal jetzt weg«, er konnte seinen Handwerkern vertrauen, »der Herr seift uns ein. Was das betrifft ...«
Er fuhr fort, die Lage zu schildern und entwarf eine dunkle Zukunft. Meine wachsame Großmutter erschien, nahm den Männern die Flaschen weg und empfahl: »Wenn die Herren sich etwas leiser unterhalten wollten?«
Darauf ging der alte Stadel wirklich hoch. »Wie mich diese Weiber ankotzen mit den Hängetitten und den Zwiebeln. Hoch das Bein, der Führer braucht Soldaten. Eine Frau ist ja was anderes als eine Brutmaschine. Und jetzt noch das. Dieser Krieg ...«. Er schien sehr besorgt, was seinen Zorn milderte.
Meine Großmutter nahm mich mit hinaus, ließ mich nicht mehr aus den Augen, schälte eine Apfelsine und gab mir die Stücke gezuckert auf einem Teller. »Iss das mit Verstand, lange werden wir solche Sachen nicht mehr kriegen.«
Marta Stadel, geborene Bittner, hieß: die Kohlkoppen. Ihr Haar war immer schon fast weiß, wurde berichtet. Sie erschien mir nicht alt, sondern einfach stark, und ich schätzte sie wegen ihrer Ruhe. Auch Mattias Stadel schätzte sie, wie alle wussten, von ihr ließ er sich leiten.
Das Zimmer in der Seumestraße war mit soliden alten Möbeln eingerichtet und geschmückt mit einem riesigen Bild in schwerem Rahmen. Alles wirkte hier fest, unverrückbar, sicher. In einer Ecke stand der Säbel des ehemaligen Husaren Stadel. Ich zog ihn aus der Scheide und fuchtelte damit herum.
»War es nicht gestern noch der Weiße Adler?«, fragte meine Großmutter spottend.
Sie nahm mir den Säbel weg und schob ihn wieder in die Scheide. »Du haust mir noch was runter.«
Sie trug ein blaues, einfaches Kleid mit einem schmalen Gürtel, am Kragen war das Kleid weiß abgesetzt, und ihr Hals schob sich kräftig aus dem Blau des Kleides. Ihre Augen waren von einem warmen Grau, und die Hände hatten eine angenehme Form, das richtige Maß, wie ich empfand. Plötzlich fragte sie: »Wer wird der erste Tote in unserer Familie sein, Hannes?« '
Ich wusste keine Antwort. Krieg und Schrecken waren für mich noch keine zusammenhängende Erscheinung. Aber dass Soldaten im Felde starben, wusste ich. Von allen Männern, die ich kannte, kam nur mein Vater als Soldat in Betracht. Niemand sonst. Dass mein Vater Soldat werden und fallen könnte, war mir nicht vorstellbar.
Sie starb ein Jahr nach Kriegsbeginn.
Es war Mitte Dezember, nasskalt und neblig. Aus einem tief hängenden Himmel rieselte Schneeregen. Meine Familie stand auf dem Platz vor der Leichenhalle. Das schwarze Tuch der Mäntel glänzte vor Nässe, und in den Zylinderkrempen sammelte·sich Schmelzwasser. Die Frauen hielten ihre Gesichter hinter schwarzen Schleiern versteckt, unter denen man ihre Trauer ahnte; ich hätte allen Dreien gern in die Augen gesehen. Trauer war mir kein Begriff, ich empfand keine Trauer, ich empfand nur Grauen und fürchtete mich vor dem Augenblick, wo ich die Tote sehen würde.
»Wir haben lange darüber nachgedacht, ob du schon verständig genug warst, von deiner Großmutter Abschied zu nehmen. Dann entschieden wir, es wäre besser, du würdest sie noch einmal sehen. Leid macht sittlich.«
Leid macht den sittlich, der schon einen sittlichen Begriff besitzt. Es war ein scheußlicher Tag. Kälte kroch mir die Beine hoch, und ich, erwog, eine Ohnmacht vorzutäuschen, um auf mich aufmerksam zu machen: Seht, auch ich leide.
Der alte Stadel legte mir die Hand auf die Schulter. Er weinte, ohne das Gesicht zu verziehen, ich fühlte seinen Schmerz und bewunderte seine Selbstbeherrschung. Nur die harten, wimpernlosen Lider schlugen schneller als gewöhnlich; mit jedem Lidschlag flogen Tropfen wie aus einer Schleuder. Erzogen, den Tatsachen nicht auszuweichen, sah ich meinen Großvater aufmerksam an. Zum ersten Mal erfasste ich ihn ganz, die kraftvolle, mittelgroße Gestalt, seinen Kopf mit den kräftig gebildeten Zügen, mit Wangenfalten, mahlenden Kiefern, die lang herabhängende Nase.
»Am Abend davor hat sie gesagt, nun hör doch mal zu, wenn ich dir was erzähle«, begann er, »gerade heute will ich dir was erzählen. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, ich weiß, dass wir gebratenen Fisch aßen und Bier tranken. Nachts bekam sie einen Gehirnschlag. Sie lebte noch, als der Arzt kam. Während er sie untersuchte, starb sie. Auf ihrer Nähmaschine liegt noch ihr Zeug, sie ist immer mit mir rumgezogen, mein Junge, ich bin viel auf Reisen gewesen, bis ich dann in Berlin fest wurde. Sie ist tot, vergiss sie nicht.«
Mir wurde bei, dieser Erzählung klar, dass er nicht gelogen, hatte. Er war wirklich in Amerika gewesen, und es gab auch diesen Seeoffizier, mit dem er die Schlacht bei Skagerrak durchgestanden, jenen Mann, der meinem Großvater später die Verwalterstelle verschaffte, ihm zu Wohlstand verhalf. Und ich begriff auch, dass er eine Schuld abtragen wollte; er war nicht mehr sicher, ob er richtig gehandelt hatte.
Barbara gesellte sich zu uns, und damit waren die mir nahestehenden Menschen um mich. Wir gingen hinunter in die Leichenhalle, dumpfer Geruch nach Verwesung schlug mir entgegen. Ich geriet in, Panik. Die beiden neben mir schoben mich vor sich her, näher an den offenen Sarg heran. Zu Häupten meiner toten Großmutter brannten Kerzen. Zunächst sah ich nichts als eine weiße, zerfließende Masse, von den Füßen bis zum Kopf war die Kohlkoppen nicht in das herrliche Weiß eines Segels am Sommertag gehüllt, sondern in das graue, schmutzige oder bestaubte Weiß, wie ich es hier zum ersten Mal sah. Weiter erblickte ich einen formlosen Klumpen, einen Haufen grünlichen Stoffes, den ich zu meinem Schrecken als die Hände meiner Großmutter erkannte oder eben nicht erkannte, den Händen fehlte das Leben. Man hatte sie nach christlicher Bestattungssitte gefaltet, aber den übereinanderliegenden, halb miteinander verflochtenen Händen gebrach es an Kraft und an Wärme. Schwer konnte ich mir vorstellen, dass mich diese Hände noch vor ein paar Tagen gestreichelt hatten. Meine Großmutter war eigentlich brünett. Jetzt sah ihr Gesicht grünlich-grau aus. Auch die weißen Haare wirkten leblos wie Glaswolle. Ich sagte mir, diese furchtbare Starre, diese absolute Reglosigkeit, dieses endgültige Nichts, das ist der Tod, der gleiche, der mit den Stukas fliegt, und so ähnlich wie meine Großmutter sehen die Kinototen in Wirklichkeit aus, wenn man sie aufbahrt, was man ja zweifellos tut, denn jeder Tote hat Angehörige. Zugleich kontrollierte ich diesen Einfall, der mit persönlicher Trauer um einen Menschen gar nichts zu tun hatte, und mir fiel ihre Frage ein: Wer wird der erste Tote unserer Familie sein? Für mich verknüpften sich endlich beide Ereignisse, Krieg und Schrecken, ich fand einen Zusammenhang darin und stand ziemlich ratlos und nach Fassung ringend vor dieser Toten.
Meine Tante Barbara trat näher an den Sarg heran. Ich wurde erst gewahr, dass sie einen Handstrauß mitgebracht hatte, als sie versuchte, die Hände der Toten zu lösen, um den Strauß dazwischen zu stecken. Ich fand die Kaltblütigkeit meiner Tante beachtlich, wollte ihr nicht nachstehen und tat unbedachterweise einen Schritt auf den Sarg zu. Da schlug mir ein unbeschreiblicher Geruch entgegen. Ich wankte, flüchtete zurück, prallte gegen meinen Großvater, der meine Schultern fasste und mich wie einen Schild vor sich hielt. Unterdessen war ein Mann herangekommen, der meiner Tante half. Er trat hinter den Sarg zurück, und ich entdeckte einen zweiten Mann. Beide hielten Mützen in den Händen. An ihrem Ernst und Respekt fand ich meine Haltung wieder. Mich umdrehend, sah ich meine Familie hinter uns versammelt. Ich stand ganz vorn, man billigte mir eine wichtige Rolle zu. Die Tote hatte an mir gehangen, an ihrem ersten Enkel, die Familie setzte Hoffnungen in meine Entwicklung, und hier in der Leichenhalle entdeckte ich den Vorzug, jung zu sein, alles noch vor mir zu haben: das Leben.
Als wir hinaufgingen, hallten die Schläge, und auf meinen fragenden Blick sagte mein Großvater, man schließe jetzt den Sarg. Wir traten in die Kapelle ein. Der Pfarrer kam uns entgegen. Er reichte allen die Hand, dann formierte sich ein Zug, und der Geistliche setzte sich an die Spitze. Eine Orgel begann zu spielen, ein Chor sang: Ein feste Burg ist unser Gott / Ein gute Wehr und Waffen / Er hilft uns frei aus aller Not / Die uns jetzt hat betroffen / Der alt böse Feind / Mit Ernst er's jetzt meint; / Groß Macht und viel List / Sein grausam Rüstung ist; / Auf Erd ist nicht seinsgleichen.
Ich unterwarf mich willenlos dieser Stimmung, ähnlich der in unserer Aula. Während die Orgel ausklang, legten wir unsere Kränze und Sträuße in die Hände der Männer, die den Sarg aufgestellt hatten. In der Kapelle brannten zahlreiche Kerzen, trotzdem stieg eisige Kälte von den Fliesen auf. Ich saß neben meinem Großvater und meiner Tante Barbara.
Wir beteten schweigend. Das heißt, ich betete nicht, faltete nur die Hände. Ich hatte kein Gebet, und es kam mir sinnlos vor, eine Formel an einen Unsichtbaren zu richten, der das alles ja gewollt hatte oder zumindest zugelassen. Mich in ein Stillhalten und Zustimmen zu begeben, einen Dank auszudrücken oder mich überhaupt menschlich zu diesem Tod zu verhalten - das brachte ich noch nicht fertig.
Nach der Einleitung sprach der Geistliche. Ich hörte einen zusammenhängenden Bericht über das Leben meiner Großmutter, hörte, dass sie in Schwedt geboren war, 1880, Weißnäherin lernte, früh heiratete, in glücklicher Ehe gelebt hatte und ohne lange Krankheit gestorben war. Mir schien das wenig, ihre Lebenslust, ihre Güte und Tatkraft, ihre äußere Erscheinung blieben mir unberücksichtigt. Der Geistliche kannte meine Großmutter nicht so wie ich.
Es war von Auferstehung die Rede.
Die Tote sollte entweder jetzt schon oder in Kürze strahlend zum Leben erweckt werden, in eine friedliche Ferne gerückt auf uns warten. Demnach würde ein andersgeartetes Leben anfangen. »Nimm ihre Seele auf in das himmlische Paradies, wie du die Seele des Schächers am Kreuz hast aufgenommen. Lass ihre Seele von den lieben Engeln getragen werden wie die Seele des armen Lazarus und verleihe ihr eine fröhliche Auferstehung am Jüngsten Tag. Erhöre uns; 0 Vater aller Gnaden, an seiner Statt. Erhöre deinen Sohn, unseren einzigen Heiland und Mittler, der zu deiner Rechten sitzt und für sie und uns alle bittet, und sei uns gnädig um des Verdienstes seines heiligen Leidens und Sterbens willen. In solchem Vertrauen befehlen wir ihre Seele in deine väterliche Huld. Amen.«
Die Feier strebte ihrem Höhepunkt zu, und ich verstand immer weniger. Weinen konnte ich nicht, als die Familie auf den Plätzen hinter mir das herbeigerufene oder aufgestaute Leid in Tränen und Schmerzenslauten kundtat. Ich fühlte diesen Sog, wusste, dass ich noch etwas Anderes, Wichtigeres empfand, ohne den klaren Ausdruck dafür zu finden. Unter Orgelklang wurde der Sarg hinausgefahren. Und wieder formierte sich der Zug hinter dem Geistlichen, dem Wagen mit dem Sarg. Dicht dahinter ging ich mit meinem Großvater und meiner Tante Barbara, trug meinen Strauß und blinzelte in die fahle Wintersonne. Der Schneeregen hatte aufgehört. Es roch mich Nässe, nach modernden Pflanzen und frischem Tannengrün. Wind blies lichte Wolken vor die Sonne, das ergab ein Wechselspiel von Licht und Schatten. Im Licht sah die schwarze Kleidung verstaubt und erbärmlich aus.
Wir erreichten die Grube. Dort hockte ein Totengräber mit Hacke und Spaten, er zog sich zurück, als er uns kommen sah. Und nun wickelte sich alles schneller ab, als ich geglaubt. Mit geübten Griffen zogen die Leichenträger Stricke unter den Sarg, betraten zwei starke Bohlen links und rechts der Grube. Jemand vorn sprach eine Formel, Ruhe in Frieden, und der Sarg senkte sich. Zu Erde sollst du wieder werden. Wir warfen drei Hände voll Erde auf den Sarg und drückten uns die Hände, wie mir schien, nach einer feststehenden Regel.
Dann griff das Leben wieder nach uns.
In der Seumestraße hatten Frauen das Essen vorbereitet; da allen kalt war, wurde Schnaps und Wein getrunken. Die Männer rauchten. Noch waren die Spiegel zugehängt, aber der Duft nach gebratenem Fleisch durchzog die Wohnung. Vereinzelt führten Angehörige wieder normale Gespräche, über die Lage, über den Krieg, über die Geschäfte, über alles Mögliche. Dazu tranken sie immer mehr, und endlich wurde die Suppe aufgetragen. Ich saß neben Tante Barbara und neben meinem Großvater als eine der Hauptpersonen, eine Rangerhöhung, die ich begriff und die mir gefiel. An der einen Seite der Tafel saßen meine Mutter Verena Stadel und mein Vater, an der anderen Auguste Meister, geborene Arzt, mit ihrem Mann, einem Oberstudienrat. Letzterer war mir unheimlich. Mir fiel auf, dass keiner der Gäste den Oberstudienrat ansprach ...
»Das war so, meine arme Gusti hatte Heinz während des Studiums kennengelernt. Sie hatte, ich glaube sechsunddreißig, eine Fehlgeburt mit ziemlichen Komplikationen. Jedenfalls musste sie sich einer Operation unterziehen, mit der Folge dauernder Unfruchtbarkeit. Darauf ließ sich Heinz mit anderen Frauen ein. Das wussten wir. Gusti litt unter all diesen Dingen, wie nur eine Frau leiden kann. Wir verachteten Heinz ...«
Weiter am Tisch saßen mein anderer Großvater, Friedrich Wilhelm Arzt, und seine Frau. Mein Bruder Felix lief hin und her. Vier Jahre alt, begriff er noch nichts, mein Bruder, mein kleiner Bruder. Die übrigen Gäste standen der Toten nicht sehr nahe, nicht so nahe wie wir.
Es gab Fisch und als Hauptgericht Fleisch mit Gemüse. Wir aßen so üppig wie sonst auch. Spät am Abend fuhren wir nach Hause. Erschöpft schlief ich bis in den Mittag. Von der Schule war ich befreit worden.
Am folgenden Tage ging ich zu Barbara Arzt. Meine Tante beugte sich über das Zeichenbrett, sie trug hohe weiche Filzstiefel, eine lose hängende Bluse mit einer dicken Strickjacke darüber und einen wollenen braunen, langen Rock. Der Kälte wegen brannte ein elektrischer Heizofen. Von der Zentralheizung stiegen Wärmewellen gegen das Fenster auf. Ich bildete mir ein, die warme Luft flimmern zu sehen. Meine Tante hielt den Pinsel mit den Zahnen, strich sich das Haar nach hinten und steckte es mit einigen Spangen fest. Ich zog meine Schuhe aus und schob dem Hund die Füße unter den Bauch. Wenn meine Tante lächelte, glänzten ihre Zähne weiß und regelmäßig.
»Glaubst du, dass sie im Himmel ist?«
»Wer? Deine Großmutter? Nein. Ihr Leichnam löst sich allmählich auf; dann bleiben noch Knochen übrig, bis auch die Knochen zerfallen.«
»Aber warum heißt es dann, verleihe ihr eine fröhliche Auferstehung am Jüngsten Tag? Was ist das, der Jüngste Tag?«
Sie legte den Pinsel weg und suchte nach einer Zigarette. »Im Kittel an der Tür«, ich holte die Schachtel. Sie nahm eine, ließ sich Feuer geben, rauchte ein paar Züge und setzte sich. Der Hund bewegte den Kopf hin und her, suchte bald den Blick des einen, bald den des anderen,
»Ja«, sagte sie, »warum? Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Groß Macht und viel List, auf Erd' ist nicht seins Gleichen.« Sie redete mit sich, ich hörte ihr zu, an ihre Art gewöhnt, meine Fragen selten direkt zu beantworten. »Du willst mir doch nicht einreden, euer Religionslehrer hätte euch nicht erzählt, wie das Paradies beschaffen ist.«
»Aber du glaubst doch nicht daran«, beharrte ich.
»Nein, ich glaube nicht daran. Trotzdem habe ich einen Halt nicht in diesem Glauben, aber in dieser Kirche, sofern es sich nicht um die Kirche handelt, in welcher in Reitstiefeln und Uniform die braune, Vorsehung gepriesen wird.«
Obwohl ich nicht die Spur von dem Gesagten begriff, stimmte ich ihr mit Freuden zu. Sie konnte nicht irren; in dem Blick ihrer strahlend schönen Augen lag eine Ausstrahlung, der ich erliegen wollte.
»Kleiner Mann, es ist ein weiter Weg bis zu meinem Verständnis dieser Sachen. Ich kann dir leider nur wenig helfen. Es gibt kein Zeichen dafür, dass sie nicht im Paradies leben könnte, als Seele oder als Schatten, aber es gibt eben auch kein Zeichen für das Gegenteil. Das ist das Dilemma jeden Glaubens. Wir sind Christen aus Tradition; ob und was wir glauben, ist beinahe schon unwichtig geworden. - An deiner Stelle würde ich es vorerst beim Glauben belassen.«
Hätte sie gewusst, wie sehr ich sie verehrte, so würde sie meine Zustimmung weniger hoch bewertet haben.
»Gut, aber ich frage dich noch mal.«
Sie nickte. »Gut, ja, in zehn Jahren.«
»Was ist mit Onkel Heinz?«
»Meinem Schwager? Da ist es keine Frage des Glaubens, es ist eine Frage der Zuneigung; der Liebe.« Sie senkte den Kopf, weil ich ihre Augen nicht sehen sollte, was mich wunderte. Offenheit war zwischen uns die Regel. »Jetzt ist Schluss mit Fragen.«
Aus ihren Antworten suchte ich mir ein Bild von ihren Gedanken zu machen. Ich wollte ihr in allem zustimmen, wollte auf ihrer Seite sein.
»Warum ist er so, ich weiß nicht wie. Du magst ihn doch auch nicht?«
Ihr Gesicht verdüsterte sich. »Ich verstehe ihn nicht, noch weniger begreife ich meine Schwester. Für mich ist Kinderlosigkeit keine Tragödie.«
Jetzt schmerzte mich der Gedanke, sie würde Kinder nicht lieben. Sie las meine Gedanken und kniff ein Auge zu. »Ich habe ja dich. Das muss vorerst reichen.« Aber sie log, ich merkte, sie spielte mir etwas vor. Warum?
Ich brüstete mich mit meiner Größe, meinem Alter, deutete mein Wachstum an, und vielleicht war auch unsere Beziehung, für uns beide undurchschaubar, erotisch gefärbt. Jedenfalls hatte ich einen Blick für ihre Gestalt, für ihre Bewegungen. Ich wagte nicht, meine Tante zu berühren, und sehnte mich zugleich nach dieser Berührung. Sie liebte mich sehr, aber sie zog eine Grenze, die ich nicht überschreiten durfte. Da sie mich meistens wie einen Gleichgestellten behandelte, verlangte sie auch die Leistungen eines Erwachsenen von mir, soweit diese im Bereich von Gefühlen lagen. Keine übertriebenen Liebesbezeigungen also.
Für mich zusammenhanglos, erklärte sie plötzlich: »Du wirst mal ein Mann, und du wirst ebenso selbstgefällig und eitel werden, wie alle Männer sind. Wenn du ein bisschen Kraft aufbringst, wenn du ein wenig Gefühl erwerben kannst, um unter die Oberfläche zu kommen, dann wirst du vielleicht später ganz erträglich sein.« Gegen ihre sonstige Gewohnheit zog sie meinen Kopf an ihre Brust. »Und sie machen aus euch lauter kleine Mamelucken, ohne dass ihr es merkt und wollt. Ihr stimmt sogar zu, ihr fühlt euch gut. Das sind Dinge, die ihr erst später austragen werdet, vielleicht euer ganzes Leben lang. Dieses Gefühl eurer überlegenen weißen Hautfarbe, eurer europäischen Zivilisation werdet ihr nie ganz abstreifen; euer Verstand wird sich einmal gegen das richten, was man euch heute zwingt aufzunehmen. Trauer hast du gestern kaum empfunden, du musstest dich überwinden, du hast dich gesehen, und hast dich weggewünscht. Stimmt es?«
Sie ließ mich los.
»Mach uns einen Tee«, sie drückte die Zigarette aus, »um fünf kommt« sie nannte den Vornamen des Mannes, mit dem sie gerade zusammenlebte. »Deine Eifersucht ist lächerlich, kleiner Mann. Er vertreibt dich nicht. Bleib ruhig hier.«
Ich versuchte Verena davon zu überzeugen, dass es nicht auf Worte ankomme, aber sie interessierte sich für eine Nebensache: »Es sieht ihr ähnlich. Ich wiederhole, Barbara schlug ganz aus der Art, und sie zog Menschen an wie ein Magnet.«
Das stimmte, ich pflichtete Verena bei.
»Ich muss dich wohl aus deinem Himmel herunterholen, indem du immer noch zu leben scheinst, soweit es meine Schwester Barbara angeht. Mein Vater unterstützte sie nicht mehr, als es herauskam, dass sie mit ihrem Schwager, diesem Heinz, ein Verhältnis hatte.«
Ich erschrak, wehrte ab, aber meine Mutter übersah meine Hand, oder sie wollte sie nicht sehen.
»Nicht die Männer, die du kennst, hatten Bedeutung in ihrem Leben, möglicherweise auch die, aber ein längeres Verhältnis hatte sie mit Heinz, natürlich musste sie es vor dir verheimlichen, musste dich belügen. Und da hast du einen Zug an Barbara, der dir nicht gefallen wird; sie war nicht so unerschrocken in Bezug auf die öffentliche Meinung, wie du glaubst. Sie beugte sich unter das Joch, das wir alle tragen. Sie hat auch Kinder gewollt und einen Mann, sie besaß sogar einen tragischen, der Familie sonst fremden Zug. Ich habe ihr zweimal bei einem Abort geholfen, einmal wäre sie beinahe verblutet. Es war furchtbar.«
»Schluss, Verena Stadel, es reicht.«
Meine Mutter reckte sich siegesgewiss auf.
»Du bist doch versessen auf Wahrheit, du möchtest sie doch aus mir herausholen, ehe ich sterbe? Wahrheit, die dir nicht bekommt, weil du immer noch in Traumwelten lebst, weil du dich immer noch für was Besonderes hältst.«
Ich zuckte die Schultern.
»Eins freilich stimmt«, sagte meine Mutter, »mit dem Tod meiner Schwiegermutter begann alles, alles.«
»Mama, warum hat der alte Stadel Barbara geliebt? Warum ließ er sie nicht von seiner Seite, damals bei der Beerdigung?«
Sie hob bedauernd die Schultern. »Kann ich keine Auskunft geben.« Sie nickte sich zu. »Was übrigens die Erotik betrifft, so kannst du recht haben, Barbara besaß eine solche Ausstrahlung, und du warst genau das Kind, das solche frühen Signale empfangen konnte ...«