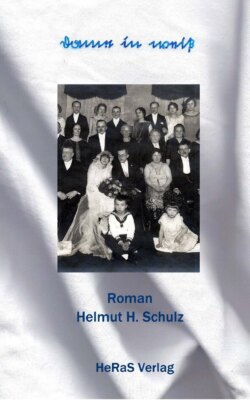Читать книгу Dame in Weiß - Helmut H. Schulz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 5
Zehnjährig machte ich einen Schritt ins soziale Leben, den Ersten. Den Ersten? Zumindest einen Wichtigen ...
»Wir kauften deine erste Uniform, Hannes, ich entsinne mich daran wie heute. Da gab es ein Geschäft für Uniformen und Effekten in der Schönhauser Allee. Dort bekamen wir alles, was du brauchtest, die schwarze Cordhose, das braune Hemd mit den Achselstücken und den aufgenähten Taschen, den Lederknoten, durch den ihr das schwarze Fahrtentuch zogt, und ein Käppi. Dazu gehörten ein Koppel mit Schulterriemen und ein Paar Bundschuhe. Wir kauften auch gleich die, Winteruniform, lange Hosen und Bluse; so etwas wie einen Waffenrock. Das Fahrtenmesser bekamst du erst nach einer Zeit der Bewährung, ich glaube, ihr musstet einen Schwur leisten oder etwas Ähnliches ...«
Jendokeit, der Schleppfuß Goll, Bruchner und Schott, so hockten wir eines Nachmittags uniformiert, das Käppi übers Knie gelegt, in meinem Zimmer in der Hallandstraße. Goll musste das Bein seitlich wegstrecken. Wir begutachteten uns.
»He, Teja, ist deine Hose nicht etwas lang geraten?«
Goll schüttelte den Kopf. Getragen wurde die Hose eine Handbreit über dem Knie, es gab für alles Vorschriften. Die Hand lang über den Nasenrücken gelegt, musste die Spitze des Käppis in der Verlängerung des Zeigefingers liegen; leicht schräg durfte das Käppi jedoch stehen.
Schott, zwar nicht der Größte von uns, aber der Behäbigste und Schwerste, sah in Uniform miserabel aus. Jendokeit hatte, wie es schien, nie etwas anderes getragen, und das lahme Bein gab Goll zusammen mit der Uniform sogar etwas Gestandenes, im Kampf Gewesenes.
Meine Mutter kam herein, »Lasst euch mal ansehen.«
Wir stellten uns in eine Reihe, verlegen lachend, aber mit Stolz auf die neue Würde, und meine Mutter rückte an den Sachen, bis sie mit deren Sitz zufrieden war ...
»Ihr seid richtig nette kleine Jungen gewesen, wie Kadetten: die kurz geschnittenen Haare, die sauberen Hände und die fröhlichen, frischen Gesichter, gesund und wohlgenährt - man konnte vergessen, dass wir uns im zweiten Kriegsjahr befanden.«
Auf dem Hof einer Schule standen wir in Reih und Glied, der Länge nach, in drei Staffeln. Ein größerer Junge stand mit gespreizten Beinen vor uns, die Hände in die Seiten gestemmt, und musterte uns ernst. Auf seinen Wink kamen ein paar andere ältere Jungen, die unsere Fußstellungen korrigierten - wie ein rechter Winkel gebildet wurde, wussten die wenigsten von uns, aber genau in diesem Winkel hatten die Füße zu stehen. Die Hände an der Hosennaht, Arme leicht angewinkelt, sodass eine Lücke zwischen Armbeuge und Körper entstand - so lernten wir die ersten militärischen Kommandos, lernten den Gleichschritt, das Ohne-Tritt-Marsch, lernten, wie man richtig rechtsum macht, wie man grüßt, den Arm hochreißt und den Kopf zum Vorgesetzten hindreht
Wir hatten Vorgesetzte mit Fangschnüren von der Achsel bis zur Brusttasche und Rangabzeichen auf den Ärmeln. Und wir hatten eine Fahne. Und wir hatten Trommeln, die langen, dumpf bellenden Landsknechtstrommeln, die im Rhythmus des Marschtritts der alten Heere dröhnten: Hüt-dich-Bauer-ich-komm, hüt-dich-Bauer-ich-komm ..., eine Schlagfolge, die auf längere Dauer in einen stumpfsinnigen Trott fallen lässt, man geht nur noch mit halbem Bewusstsein, aber man geht, an diesen Kolonnenschritt gefesselt,
Nach unserem Eintritt in das Jungvolk hatten wir wöchentlich zweimal Dienst, Geländespiele nach dem Schema: Der Feind sucht die Fahne zu gewinnen - die Partei, welche die Fahne zuletzt im Besitz hat, ist die Siegerpartei. Bann hieß der dem Fähnlein folgende größere Verband, dann folgten das Gebiet und der Gau.
Wir lernten Lieder, das Deutschlandlied mit allen Strophen, das Lied der Hitlerjugend, das Horst-Wessel-Lied; wir zogen zu den Stätten vergangener Kämpfe und gedachten schweigend der Opfer.
»Jedenfalls hattet ihr eine Aufgabe, ihr wusstet, wohin, und du bist wie deine Freunde gern in die Jugendstunden gegangen. Leider hattest du schon etwas übertrieben Hartes in deinem Wesen, etwas Introvertiertes, möchte ich sagen, das wurde durch diese Erziehung nur noch verstärkt, aber das lag wohl überhaupt in der Zeit. Was ich damals an Heftpflaster für dich verbraucht habe ...«
Die Aufmärsche aus irgendwelchen Anlässen, auf dem Reichssportfeld, auf dem Tempelhofer Feld: hunderttausend uniformierte Jugendliche, Tausende Fahnen aus allen Gebieten und Gauen, eine Reiterkavalkade mit wehenden Bannern, Motorradstaffeln - unten auf dem Feld sorgsam gedrillte Jungen, die sich auf Kommando drehten und wendeten. Sonnenwendfest. Riesige Holzstöße loderten, im exakten Karree die deutsche Jugend, schweigend ...
Meine Tante Barbara erregte sich, ihre Stirn glänzte feucht. Das Pony musste verkauft, der Neufundländer nach Hammelspring gebracht werden Auguste, die Schwester Verenas und Barbaras, Verena und ich saßen um den Tisch in der Veranda. Die Türen waren geschlossen, es wehte durch die Ritzen. Barbara stocherte wütend im Ofenloch herum und legte große Holzscheite nach.
»Also, was wollt ihr von mir?«
Das Haar hing ihr seitlich über die Schläfen, sie sah blass aus - ich war auf Distanz gegangen und wartete ab, was geschehen würde.
»Es hat keinen Zweck, sich zu sträuben, wenn Vater das Haus verkaufen will. Er braucht es nicht, und du ...«
Barbara nickte ihrer Schwester Gusti zu. »Und ich? Es ist wahrhaftig nicht meine Schuld, dass du und Heinz nicht miteinander auskommt.«
Sie unterbrach sich und meine Mutter sagte mit schwerem Seufzer: »Unter Schwestern - Herrgottnochmal. können wir denn nicht mal einen Augenblick lang, ich will ja nicht sagen, Liebe füreinander empfinden, das ist wohl nicht möglich, aber doch wenigstens Verständnis aufbringen?«
»Verständnis? Nennen wir doch das Kind beim Namen, ihr wollt mich los, sein, mich, das schwarze Schaf.«
»Du hast dich selbst zum, schwarzen Schaf gemacht.«
Sie fuhr auf. »Seit wir diesen irrsinnigen Krieg haben, seid ihr alle verrückt geworden, aber denkt an mich, es wird ein schlimmes Ende nehmen, und dann wird das Geschrei groß sein über uns angetanes Unrecht.«
Gusti lächelte überlegen, und Verena winkte ab.
»Ja, lassen wir das«, sagte Barbara. Sie ließ sich in einem Sessel nieder, zündete eine Zigarette an, und ich sah ihre Hände zittern.
Dann sagte sie: »Könnt ihr denn nicht die Zeit abwarten? Ihr werdet mich sowieso bald los.«
»Niemand will dich loswerden, Barbara«, erwiderte meine Mutter, »das wird allmählich zur fixen Idee bei dir. Du willst anders leben als wir, etwas anderes sein, und du verletzt dabei dauernd unsere Gefühle - von mir will ich nicht reden.«
Meine Tante Gusti trug glatt gekämmtes Haar hinten einen Zopf, Dirndlbluse und bestickten Rock. Meine Mutter Verena trug an diesem Tag ein graues Kostüm mit vielen Glocken und Falten; sie gab acht, dieses Kleidungsstück nicht zu drücken. Nur meine Tante Barbara sah aus wie eine Schlampe. Ihre Fingernägel waren kurz geschnitten und die Hände farbfleckig.
»Könnt ihr mir sagen, was dem Alten die paar tausend Mark nutzen«, fragte sie. »Es ist nicht so, dass ihr mich aus Berlin weghaben wollt?«
Die Schwestern gaben keine, Antwort.
»Also ist es so?«
Meine Tante Gusti sagte: »Ich kann dich überhaupt nicht verstehen, Barbara.«
»Jedenfalls habe ich damit gerechnet, hierher zurück zu können, wenn ich nicht mehr dienstverpflichtet sein sollte, das heißt, wenn dieser Krieg einmal ein Ende hat. Ich brauche diese Räume für meine Arbeit. Das wisst ihr gut.«
Meine Mutter sagte: »Dann kauf doch das Haus.«
»Ich soll für etwas zahlen, das mir zusteht? Das ist nicht dein Ernst, Rena.«
»Aber ja, was heißt zusteht, dir steht der vierte Teil des Hauses zu, nicht das ganze Haus, falls Vater stirbt, woran ich gar nicht denken will. «Meine Tante Barbara schüttelte den Kopf. »Wer verkauft denn in diesen Zeiten ein Haus, wo das Geld kaum noch was wert ist?«
»Was meinst du mit diesen Zeiten?«
Alle schrien durcheinander, und später gaben sie sich zum Abschied nicht die Hand. Ich hielt meiner Tante Barbara die Rechte hin - sie sah mich prüfend oder misstrauisch an.
Das Realgymnasium hatte uns Jungen verschluckt. Wir stöhnten unter der Stofflast und unser soziales Bewusstsein unterschied uns von den Volksschülern. Unsere Schulwelt war von Doktoren und Oberlehrern, von Studienräten und Rektoren bevölkert. Unsere Schule nahm Kinder aus allen Stadtteilen auf, und so bildeten sich von Anfang an Gruppen, die sich kannten und zusammenhielten. In der Mitte der drei Bankreihen saßen wir, Schott, Jendokeit, Bruchner, Goll und ich. Der Begriff Ordinarius wurde durch den Begriff Klassenlehrer ersetzt, die lateinischen Bezeichnungen der deutschen Grammatik verschwanden und machten neuen Wörtern Platz, aus Substantiv wurde Dingwort, aus Artikel Geschlechtswort. Allerdings lernten wir eine neue Schriftsprache, die lateinische. Bisher hatten wir Sütterlin geschrieben, eine Schrift, die mein Vater meisterhaft beherrschte.
Unser Klassenlehrer hieß Doktor Wetter, Schott taufte ihn Unwetter, über seine Wange liefen zwei lange Durchzieher. Er unterrichtete Deutsch und Geschichte, ließ sich jedoch in seinen Freistunden, wenn wir Sport hatten, im Fechtanzug sehen und trainierte sich.
An Neusprachen gab Doktor Nitschmann Englisch und Herr Kossack Französisch. Wir hatten Latein, kein Griechisch, aber Mathematik, nämlich die Anfangsgründe der Algebra. In den unteren Klassen unterrichtete Rektor Karnow Mathematik und Physik. Zu Staatsfeiertagen erschien die Mehrzahl der Lehrer wie wir in Uniform, ausgenommen die Frauen.
Mit Kriegsanfang hatten wir unser Auto verkaufen müssen; alle Autos gingen in die Hände der Wehrmacht über, es wurde aber eine Taxe bezahlt. Einige Fahrzeuge blieben zugelassen, im Laufe der Zeit erhielten sie Holzgasöfen. Die mussten zeitig angefeuert werden, sollten sie zur gewünschten Zeit funktionieren.
Hin und wieder flogen einzelne britische Flugzeuge über Berlin, es fielen auch Bomben. Wir pilgerten zu den Ruinen der Häuser, die getroffen worden waren. Bei den Luftschutzübungen erfuhren wir, welche Typen von Bomben mit welchen Maßnahmen wirksam bekämpft werden konnten; Stabbrandbomben mit Aufschlagzünder, mit verzögertem Aufschlagzünder gab es, mit mehreren Sprengsätzen, Sprengbomben, gegen die wenig zu machen war. Im Verlaufe des ersten Kriegsjahres waren die Böden der Häuser entrümpelt und die Holzverschläge beseitigt worden, sodass die Böden leicht zu übersehen waren. Die Keller wurden zu Luftschutzunterkünften umgerüstet; es geschah eigentlich gar nichts, nur wurden eiserne Türen eingesetzt. Man durchbrach die Kellerräume von Haus zu Haus, um Fluchtwege zu schaffen. Die Luftschutzhelfer und ihr Chef, der Luftschutzwart, besaßen Helme und eine Feuerspritze, Eimer und Löschsand, es gab Erste-Hilfe-Ausbildungen und Kästen mit Verbandszeug. In die Keller stellten wir alte Stühle, Sessel oder Sofas, Tische. Ernst nahm, keiner diese Maßnahmen. Von den Bunkern in Berlin schoss die Flak, am nächtlichen Himmel kreuzten sich die Lichtbündel der Scheinwerfer, suchten feindliche Kampfflugzeuge zu erfassen. Manchmal setzten die Flieger Leuchtkugeln, Weihnachtsbäume, die die Dächer gespenstisch beleuchteten, aber das alles war weniger Krieg als Kriegsspiel. Aus den besetzten Ländern floss ein Strom von Gütern und Lebensmitteln. Textilien konnten begrenzt auf Punktkarten bezogen werden. Natürlich entstand auch sogleich ein kleiner Markt, der schwarze Markt mit Waren zu Überpreisen.
An den Häuserwänden erschien eine dunkle Gestalt, der Schatten eines Mannes in Schlapphut und Mantel, Feind hört mit, die volkstümliche Propaganda lief auf Hochtouren, jetzt wird eisern gespart - später punktfrei Staat gemacht; Anton kommt in seinen Bau, da entdeckt er Kohlenklau...
Noch immer war der Krieg ein mehr heiteres als unerträgliches Ereignis, und die Verluste an Menschen waren gering. Wen es traf, der zählte zu einer Minderheit.
Endlich gehörten auch wir zu den Auserwählten, die an Feiertagen in die Aula marschierten, Fahnen vor uns hertragend, mit kurzen, dumpfen Marschtritten; endlich umschlang das einigende Band militärischer Disziplin auch uns. Wir fühlten den Flügelschlag der Geschichte, die Berührung mit dem Fahnentuch verlieh uns übermenschliche Kräfte. Einer heiligen Sache dienten wir, einer Sache ohne Ausdruck, ohne Begriff.
Hinter dem Redner hing eine Karte, sie zeigte Europa und Asien, eine riesige zusammenhängende Landmasse, von der wir schon eine Vorstellung besaßen. Wir unterschieden Völker, Staaten und Kontinente, wussten, was wo produziert wurde, kannten die ethnische Zusammensetzung, eingesprengte Reste germanischer Herrenvölker, die ihre bleibenden Spuren hinterlassen haben, von der Krim bis Indien, der Indoarier, der Lichtsucher, unterschieden vom Slawen oder Semiten, der durch dunkle, abscheuliche Triebe beherrscht wird. Meine Mutter Verena hatte es erlebt bei Max Hirsch; nun bestätigt durch Autoritäten, wahr die Beobachtung also, unbestreitbar wahr.
Wetter hielt eine Ansprache. Seit einigen Tagen tobte ein neuer Kampf, der im Osten, dem uralten germanischen Lebensraum, einst den Slawen abgetrotzt; jetzt trat die germanische Rasse ein weiteres Mal zum Kampf um den deutschen Osten an, um das heilige Gut des Reiches, um das die Ordensheere ruhmvoll gekämpft unter Heinrich von Jungingen, ihrem Hochmeister. Schmählich, nach Slawensitte, war der Vertrag von bolschewistischen Untermenschen gebrochen worden. Der Führer war jedoch dem Schlag zuvorgekommen, und - Wetter ging zu sachlichen Darlegungen über - der Zeigestock des Lehrers fuhr über die Karte. Dort standen deutsche Panzer, deutsche Soldaten trieben die Feinde zu paaren.
Die Bühne wurde verdunkelt, wir blieben mit dem Rücken zur Leinwand stehen, wir sahen also nichts von dem Film, der dort gezeigt wurde, aber wir kannten die Bilder ohnehin, die Reihen anstürmender Bolschewisten, die vor die deutschen Maschinengewehre gejagt wurden, angetrieben vom Kommissar, der keinen Pardon kannte. Zu dumpfer Musik glitt das Auge der Kamera über die getöteten Menschen, ein Anblick, uns längst vertraut, keiner von uns zuckte mit einer Wimper. Das Licht ging an, und Wetter schloss seine Rede mit Zuversicht. Der Endsieg stand nahe bevor, war der bolschewistische Feind erst niedergerungen, so mussten die Feinde im Westen in die Knie gehen. Und ganz besonders kam es auf die deutsche Jugend an, hier, heute, in diesem Schicksalskampf der Deutschen.
Der Fanfarenzug des Gebietes blies erregende Signale. Die flachen Trommeln rasselten, wir zogen aus der Aula.
Es war der letzte Tag, den ich mit meinem Vater verbrachte, er trug schon Feldgrau.
»Papa, wo kommst du hin?«
Ich wusste, dass er seinen Einsatzraum nicht kannte, und wenn er ihn gekannt hätte, würde er ihn uns nicht gesagt haben.
»Nicht an die Front«, erklärte er, »nach Polen, ins Hinterland.«
Seine Dienststelle brauchte ihn, er war ein wichtiger Techniker für das Nachrichtenwesen.
»Vielleicht werde ich euch nachholen«, versprach er, »würdest du gern für immer in Polen leben?« Da er sah, dass ich ihm nicht folgen konnte, erläuterte er: »Es scheint so zu kommen, dass wir diesen Raum besiedeln werden, germanisieren.« Ich spürte Unsicherheit in seiner Stimme, erkannte, dass er sich noch sträubte, als Tatsache anzunehmen, was er mitteilte. »Germanisieren - wir würden selbstverständlich Vorrechte eingeräumt bekommen.« Er schien zu zweifeln und lächelte verlegen.
Es war ein freundlicher Tag, wir spazierten durch den Bürgerpark. Es waren nur wenige Leute außer uns unterwegs. Die mächtigen alten Bäume hatten etwas Beruhigendes, Dauerhaftes. Unter einer Brücke sprang das Wasser der Panke über grün bewachsene Steine. Ich dachte an Wendisch-Rietz, an den alten Stadel, dachte an das Haus in der Wilhelmshagener Straße, das verkauft werden sollte, und hatte Sehnsucht nach Frieden, weil wir alle wegen dieses Krieges getrennt wurden.
»Ich will nicht nach Polen.«
Er legte mir die Hand auf die Schulter. »Es war nur so gefragt, hat keine Bedeutung. Ich denke auch nicht daran, nach Polen zu ziehen, ich kann ja nicht mal Polnisch.«
»Was wirst du dort machen?«
»Strippen ziehen«, sagte er verächtlich. »Oder andere welche ziehen lassen, einen Wählersaal einrichten, was weiß ich. Wer weiß denn schon was?«
Ich hörte Ärger, Zorn und Hilflosigkeit in seinen Worten mitschwingen und antwortete mit den Sätzen, die ich in der Schule gelernt hatte, vom nötigen Schicksalskampf der Deutschen, vom Volk ohne Raum.
»Wir gehen jetzt auseinander, mein Sohn. Wer weiß, ob und wann wir uns wiedersehen. Leben gibt es nur einmal, und dass dieses Leben nichts wert sein soll, gemessen an anderen Werten wie Volk und Raum und was sonst noch, ist ein komplizierter Gedankengang«, er zögerte, fand eine Formulierung und schloss, »ein zweckmäßiger Gedankengang.«
Ich spürte, dass er noch mehr sagen wollte, wartete, dass er weitersprechen würde. »In vier Jahren wirst du eingesegnet, und ich hoffe, dass wir dann alle wieder beisammen sind.«
»Du bist ja kaum noch zu Hause gewesen.«
Er wiegte den Kopf. »Du hast natürlich gespürt, dass deine Mutter und ich in manchen Fragen nicht einer Meinung sind. Das muss und wird sich jedoch jetzt ändern.«
In letzter Zeit ging er kaum aus, er verschanzte sich in seinem Zimmer hinter dem Schreibtisch, beschäftigte sich intensiver als früher mit seinen Büchern, Herbarien und Sternenkarten. Unvermutet hatte er begonnen, Russisch zu lernen, er gab viel Geld für Bücher aus. Englisch für den Handelskaufmann, französische Konversation. Manchmal, wenn er nicht zu Hause war, sah ich mich auf seinem Schreibtisch um, und mich bestürzte, wie fern mir der Mann war, der mit uns lebte, uns ernährte und versorgte, der mein Vater war. Damals sah ich, dass er allein war und es sein wollte.
»Wenn du weg bist, wo sollen wir Felix einschulen?«
Er zuckte die Schultern, »Das müsst ihr allein entscheiden.
Ich glaube, du bist der Einzige, dem noch an einem Familienleben liegt, mein Sohn.«
Er hatte mich beobachtet; hieß das, er hatte sich Gedanken über mich gemacht?
»Kann ich dein Mikroskop haben, wenn du weg bist, Papa?«
Er nickte.
»Du wirst auch nicht mehr lange in Berlin bleiben. Die Schulen sollen aus der Stadt heraus, wegen der Luftangriffe.«
Durch die zunehmenden Luftangriffe fielen beinahe in jeder, Woche mehrere Stunden aus.
»Man wird euch irgendwohin schicken«, sagte er, »du musst mit, es hilft nichts.«
»Und Mama und Felix?«
»Sie können auch nicht hierbleiben. Mein Vater wird sie aufnehmen, falls es nötig werden sollte.«
Der alte Stadel hatte wieder geheiratet, er ließ sich kaum noch bei uns blicken. Ob er in Wendisch-Rietz oder woanders lebte, wusste ich nicht.
»Dein Großvater ist ein vitaler Mann«, erklärte mein Vater lächelnd, »weiß der Himmel, woher er die Kraft nimmt. Aber helfen wird er euch schon.«
»Mir doch nicht.«
Keiner würde mehr leicht zu erreichen sein. Die Familie zerstreute sich.
»Wenn ich wenigstens mit Felix zusammenbleiben könnte.«
»Das wird nicht gehen.«
Wir verließen unseren Platz an der Brücke und gingen weiter in den Park hinein. Dort lag das Schloss. Es sah sehr schön aus; zum ersten Mal fiel es mir auf.
»Wohnt eigentlich noch einer drin?«
Mein Vater wusste es nicht.
»Der Park hat viel gelitten«, sagte meine Mutter Jahre später. »Aber er ist noch heute sehr, schön, dort ist die Brücke; aber ich glaube natürlich kein Wort von dem, was ihr hier angeblich gesprochen habt. Es war vielmehr so, dass dein Vater nicht den leisesten Zweifel hinsichtlich der Mission im Osten hegte. Wir wussten damals nicht, was wir heute wissen. Und es war tatsächlich die Rede davon, uns in Kielce, oder war es Radomsk, anzusiedeln. So rosig war unsere Lage nicht. Wahrscheinlich hätten wir uns in Polen bedeutend besser gestanden.«
Sie stieß ihren Regenschirm in den weichen Boden, deutete mit der Spitze auf eine Eiche und sagte: »Die gab es damals schon. Die Eichen werden wohl noch lange stehen. Ist unser Leben so nichtig, an diesen Bäumen gemessen?«
»Er war in Kielce, Mama, in Radomsk und in Krakow.«
»Richtig, du bist in Oberschlesien gewesen. Ich lebte in Kerstenbruch bei dem Bruder des alten Stadel, ach ja, ich hatte Veronika schon«, sie stieß mich an, »was hat deine Schwester eigentlich gesagt, ehe sie abreiste«?
»Was soll sie gesagt haben?«
»Ihr hattet doch wieder die alte Geschichte vor, ich weiß Bescheid.« Sie seufzte, wie es ihre Art war, wenn sie vorgab, ein Geständnis abzulegen. »Hannes, ich weiß wirklich nicht genau, ob sie von diesem jungen Fliegeroffizier ist oder von deinem Vater, zeitlich wäre beides möglich. Dein Vater war in dieser Hinsicht ein ruhiger Mann, mehr als ruhig, mehr als ich gewünscht hätte. Trotzdem haben wir immer ehelich gelebt, das sollst du wissen. Wir hatten damals nicht viel gemeinsam. Und seltsamerweise wollte ich dieses Kind, gerade wegen der Ungewissheit, ich wollte deine Schwester.« Sie legte Aufrichtigkeit in ihre Stimme. »Als sie zur Welt gekommen war und du ihr den anderen Namen gegeben hattest, als du mir zu verstehen gabst, dass du alles wusstest oder zu wissen meintest, da war ich erschrocken.«
Ich fiel ihr ins Wort. »Mama, was soll das heute noch? Die Sache ist ganz einfach. Ich hatte Augen im Kopf. Im Krieg reift Jugend immer schneller als zu gewöhnlichen Zeiten.«
»Siehst du, gewöhnliche Zeiten«, begeistert stimmte sie zu. »Es waren ungewöhnliche Zeiten. Aber es ist auch wahr, dass es mich schmerzte, weil alle auseinandergingen, ich nach Kerstenbruch, du nach Oberschlesien, dein Vater nach Kielce, meine Schwester nach Weimar. Und der alte Stadel lebte ganz in Wendisch-Rietz, jeder von uns war nur noch von Fremden umgeben.«
»Deine ungewöhnlichen Zeiten sind also auch für dich nicht leicht gewesen, Mutter?«
Sie ließ mich stehen und strebte dem Hauptweg zu, der zur Straße führte und in die Schönhauser einmündete. Ich folgte ihr. Wir setzten uns ins Auto. Ich fuhr an.
»Du bist unausstehlich«, sagte sie.
Nach einer Pause: »Weshalb man euch, damals auf Schiffe verladen hat, ist mir bis heute schleierhaft. Mit der Bahn wäre die Sache binnen eines Tages zu erledigen gewesen.«
»Ich habe es auch nicht begriffen, aber es ist eben so gewesen. Wahrscheinlich war es der billigste Transportraum, den es damals gab.«
Der alte Stadel half beim Packen. Zwei Koffer wollte Verena mitnehmen, Wäsche und Kleidung für sich und Veronika. Mattias bremste seine Schwiegertochter. »Du kannst nicht alles mitnehmen, Rena.«
Er sah auf die Uhr, die an einer schweren goldenen Kette hing, und drängte: »Mach, beeil dich, in zehn Minuten kommt mein Bruder.«
Meine Mutter hielt ein zerknülltes feuchtes Taschentuch in der Hand, und ich litt die Qual der bevorstehenden Trennung, des, Verlustes all dieser Sachen, die unser Zuhause ausgemacht hatten. Später saßen wir neben den beiden prallen Koffern und dem Kinderwagen, in dem meine kleine Schwester Veronika schlief.
»Solltest du nicht auch deinen anderen Jungen mitnehmen«, fragte der Alte.
Sie schüttelte den Kopf. »Felix ist bei meinen Eltern gut aufgehoben.«
Die Stimmung war frostig. Wenn Mattias noch etwas für seine Schwiegertochter tat, dann wegen seines Sohnes. Er reichte ihr zwei Finger, als er sich von ihr verabschiedete. Mich presste sie an sich; ich habe in meiner Kindheit einige Dutzend Male diese Art Schmerz durchlebt, bis mich der Aufwand an Gefühl erschöpft hatte. Wenn Trennung schon unvermeidlich war, wenn sich schon nichts dagegen tun ließ, dann war es besser, man ignorierte die Trennung, man gab sich besser nur die Hand, als sähe man sich in zwei Stunden wieder.
»Mein Junge, bleib gesund und schreib sofort deine Adresse.«
»Ja, Mama.«
»Damit ich dir auch sofort schreiben kann, hörst du? Lass mich nicht ewig auf ein Lebenszeichen warten. Eine Karte genügt mir.«
»Ja, Mama, natürlich, ich schreib dir sofort.«
»Versprich es mir!«
»Ich versprech es, ich schreibe dir sofort eine Karte.«
Sie zitterte, und sie tat mir leid, aber ich konnte nichts tun, ich konnte ihr und mir nicht helfen.
»Schreib an Papa, er wartet auch.«
Sie wurde von einem heftigen Weinkrampf geschüttelt, der Bruder des alten Stadel, ein dicker alter Mann, zog ein großes buntes Tuch hervor und heulte mit.
Ich sah ihm ohne Neugier ins Gesicht.
»Ich weiß, dass du mit allem zurechtkommst, Hannes, ich weiß, dass du dich in dieser Welt zurechtfindest - es ist entsetzlich. «
Ich sah, dass ihre Tränen am Versiegen waren. »Du musst gehen, Parteigenossin Stadel, Sieg heil.«
Sie zuckte zusammen, sah zuerst mich, dann den alten Mattias an. »Das klingt ja ...«
Er hielt ihr den Mantel hin. »Macht ein Ende, sonst steht ihr auf dem Bahnhof, und der Zug ist weg.«
Sie schlüpfte in die Ärmel ihres Mantels, strich sich mit den Händen die nach oben gekämmten Haare glatt, dann gab sie mir die Hand und beugte sich herunter, um mir die Wange hinzuhalten.
Ich küsste sie. »Also leb wohl.«
Sie polterten die Treppe hinunter, die beiden Alten brachten meine Mutter nach unten, dann kam der alte Mattias wieder herauf. Mir würden noch drei Tage bleiben, bis meine Stunde schlug. Dann sollte Mattias die Wohnung verschließen und die Schlüssel an sich nehmen. Von Zeit zu Zeit, nach jedem Luftangriff, würde er nach dem Rechten sehen, falls es noch was zusehen gab.
»Was willst du mal werden? Ich meine, es ist Zeit, sich, darüber den Kopf zu zerbrechen.«
Alles andere, nur nicht das. Vor mir lagen noch mindestens sechs Schuljahre. Sollte der Krieg dauern, würde ich Soldat werden, Flieger oder U-Bootfahrer.
Er wiegte den Kopf. » U-Bootfahrer, glaube einem alten Knaben, der Stücker zehn Jahre Seemann gewesen ist, auch bei der Kriegsmarine, der kaiserlichen, damals«, er schluckte, »was ich sagen wollte ...« aber dann vergaß er, was er sagen wollte, oder er hielt es nicht für richtig, seine Meinung zu sagen. Er machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Du bist reif für deine Jahre. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du ihr viel geholfen hast.«
Ich nickte. Er fuhr auf: »Kannst du nicht reden? Stehst da wie ein Holzklotz. Meinst du, mir gefällt das alles?«
»Mir gefällt es«, sagte ich mit Nachdruck.
»Verfluchte Hunde«, stöhnte er, »elende Zucht.«
Ich beobachtete seine mächtigen Hände, entschlossen, mich nicht von ihm schlagen zu lassen. »Wen meinst du mit elende Zucht?«
»Halt dein gottloses Maul, du Strolch.«
Seine Hilflosigkeit entlud sich im Zorn gegen mich.
»Wann müssen wir weg«, fragte er.
»Freitag früh, neun Uhr, Jannowitzbrücke.«
»Komm mir nicht so oft unter die Augen bis dahin. Wäre ich doch erst wieder auf dem Hof.« Der Hof, gemeint war das Bauernhaus in Wendisch-Rietz, nahm ihn jetzt stark in Anspruch. Seine Berliner Wohnung hatte er aufgegeben. Er kam nur noch in die Stadt, um seine Geschäfte zu erledigen, um die Mieten zu kassieren und in den Häusern nach dem Rechten zu sehen. Repariert wurde nichts mehr, ausgenommen die Bombenschäden, soweit das möglich war.
Er knipste Licht an, um am Schreibtisch seines Sohnes zu lesen. Die Ecke des Zimmers empfing auch am Tage zu wenig Licht. Mein Großvater sah in die Sternenkarten, die Kalender und Berechnungen, flüchtig und unkonzentriert.
»Da hat sich nun einer sein halbes Leben lang mit Nützlichem beschäftigt.« Er drehte sich um. »Du bist noch da?«
»Wo sollte ich sonst sein«
Ich verließ ihn und fuhr in die Wilhelmshagener Straße.
Frühherbstliche Stimmung lag über der Siedlung, das Laub fiel hier und dort schon ab, der kleine künstliche Teich mit den Riedgewächsen war leer, überhaupt machte der Garten einen verwilderten Eindruck. An der Gartentür fehlte unser Namensschild, das heißt, das der Familie Arzt. Ich spähte durch die Zaunlücken, das Haus schien noch nicht bezogen zu sein. Ich kletterte über den Zaun und ging an die Rückseite des Hauses. Die Tür war verschlossen, aber ich wusste, wie ich sie ohne Schlüssel öffnen konnte, angelte den Dietrich unter dem Dachbalken hervor, ein Versteck, das nur Barbara und ich kannten, und schloss die Tür auf. Drinnen schlug mir ein feuchter, modriger Geruch entgegen. Hier war lange nicht geheizt worden. In den Ecken der Veranda glänzte es silbrig.
Ich ging nach oben in die Zimmer, die uns früher als Schlafräume gedient hatten. Sie waren ausgeräumt. Was ich eigentlich suchte, wenn ich nicht nur einen letzten Blick in eine mir vertraute Umgebung tun wollte, hätte ich kaum sagen können. Lange blieb ich nicht. Ich ging wieder nach unten, verschloss die Haustür und steckte den Dietrich in die Jackentasche. Bevor ich das Grundstück verließ, drückte ich die Schuppentür auf, dort stand das Fahrrad meiner Tante, sie hatte es nicht mitgenommen, oder sie würde es noch abholen. Ich stellte es beiseite. Einen Hammer mit abgebrochenem Stiel nahm ich vom Boden auf, trat aus dem Schuppen heraus und stellte mich so, dass ich dem großen Verandafenster gegenüberstand. Auf dem dunklen Glas spiegelt sich das Bild des Gartens - wie ein Geisterbild. Erst in dem Spiegelbild bemerkte ich, dass kein Wind wehte, dass sich kein Blatt bewegte. Und plötzlich fand ich einen Grund hier zu sein und nahm Abschied.
Als die Scheibe zerbrach und der Hammer drinnen aufschlug, fiel auch das Bild zusammen. Ohne Eile ging ich um das Haus herum und sprang über den Zaun.
Abends rief ich von Goll aus zu Hause an, um meinem Großvater zu sagen, dass ich die Nacht bei meinem Freund bleiben würde. Ich wartete auf einen Einwand, da sich am Ende des Drahtes nichts rührte, nahm ich an, der Alte hätte nichts dagegen und hängte auf.
Schott verteilte Zigaretten; er rauchte geübt, und seine großen weißen Hände erinnerten an die Tatzen von Eisbären. Sein Kopf war rund und schien direkt auf dem Brustkorb zu sitzen. Auf dem Kugelkopf rollten und ringelten sich Locken, die wir komisch fanden und die Schott selbst auch komisch fand, ohne sich darüber zu ärgern. Außerdem war sein Gesicht stark gefaltet. Wetter hatte ihn bei irgendeiner Gelegenheit den Faun genannt, hin und wieder benutzten wir auch diesen Spitznamen, aber er lag uns nicht besonders, wie uns die griechische Mythologie überhaupt fremd anmutete.
Goll-Teja rauchte vorsichtig in einer selbstbewussten und bedeutsamen Art, die ich lächerlich fand. Auf einen Streit mit Goll ließ sich aber keiner von uns gern ein, seinen galligen Spott, seine Ironie ertrugen wir nicht. Düster blickten die dunklen, etwas trüben Augen auf das glimmende Ende der Zigarette. Sein Bein würde sich nicht mehr bessern, er hatte oft starke Schmerzen und musste deshalb Tabletten nehmen. Irgendwie hob ihn das alles heraus und prägte ihn. Er trat ans Klavier, die Zigarette im Mundwinkel, und unterhielt uns mit Schlagern aus jener Zeit. Er spielte nicht mehr so exakt wie früher. Wir kamen uns ziemlich erwachsen vor.
Jendokeit war seiner Querflöte treu geblieben. Er paffte jetzt hastig, ohne den Rauch einzuatmen, und Tränen rollten aus seinen Augen.
»Schlappe Sau«, bemerkte Schott, »du musst den Rauch einatmen.«
Er machte es vor, aber Jendokeit war so vernünftig, ihm dieses Kunststück nicht nachzumachen.
Bruchner rauchte besser, was ihm Schotts Lob eintrug. Bruchner hielt sich jetzt an uns. Sein Vater war eingezogen; Jendokeits Vater war eingezogen, Schotts Vater war eingezogen, nur Gons Vater, der Schriftleiter, stand an der Heimatfront. Zwar trug er eine Uniform, nannte sich Frontberichterstatter und war oft wochenlang abwesend, aber ein Soldat war er trotzdem nicht.
Ich tat, als verstünde ich was vom Rauchen, und es gelang mir, Schott zu täuschen. Mein Körper sperrte sich gegen die Zumutung, dass ihm statt Luft Rauch zugeführt werden sollte. Hustenanfälle würgten mich, wenn ich einen Lungenzug riskierte, und schließlich drückte ich den Stummel aus und war froh, dieses Männerspiel hinter mich gebracht zu haben.
»Weiber sollen auch mitfahren«, bemerkte Schott.
Mit unserem Transport sollten Mädchen nach Oberschlesien gebracht werden. Mädchen begannen uns zu fesseln; manche waren sichtlich entwickelt. Schott erbot sich, seine Männlichkeit zu beweisen. Goll sagte kühl; »Lass deinen Penis, wo er ist.« Er lächelte. »Sera juvenum venus, eoque inexausta..., und so weiter. Tacitus, Germania.«
Schott stöhnte gequält.
»Spät erst lernen die Jungen die Liebe kennen - ich nehme an, wir werden demnächst wieder auf Tacitus verwiesen werden. Ich habe mich vorher umgesehen.«
Er war uns voraus, Tacitus hätte keiner von uns übersetzen können; es hieß, wir würden wieder Unterricht in Latein bekommen.
Später langte Goll in sein Bücherregal und legte uns den Band Tacitus vor. Er enthielt eine Übersetzung, sie war handschriftlich kommentiert, ich nahm an, von Golls Vater.
»Mein Großvater hat mich heute gefragt, was ich werden will«, ein Themawechsel schien mir fällig, und auf die Frage des Alten hatte ich mir überlegt, was ich werden könnte, und wollte hören, wie die anderen darüber dachten.
»Und was hast du gesagt«, fragte Bruchner.
Bruchner hatte unter uns wenig Gesicht. Er tat, was man von ihm verlangte, ohne zu meckern, aber ihm fehlte Begeisterung, wie uns schien. »Nichts, keine Ahnung.«
Die anderen stimmten zu.
»Was soll diese Scheißfrage«, sagte Schott. »Solange Krieg ist, gehen wir sicherlich zur Penne - wie lautet der Lehrsatz, nach welchem im Dreieck die Kathetenquadrate gleich ...«
»Ganz recht«, pflichtete Goll bei, »wir haben sechs Jahre vor uns. Da ist der Krieg zu Ende, und Europa sieht anders aus.«
»Und wenn, er länger dauert«, fragte Schott, »dreißig Jahre?«
Es ging über unsere Vorstellungskraft, was wäre, wenn der Krieg so lange dauerte.
»Ich frage mich«, sagte Goll, »ob ich eigentlich gern nach Oberschlesien fahre. Ich meine, was machen sie denn da mit uns?«
»Wir sollen doch wegen der Bomben aus Berlin weg«, warf ich ein.
Bruchner sagte: »Mein Vater ist vermisst, bei Leningrad.«
»Seit wann weißt du das?«, fragte Goll sachlich.
»Seit gestern.«
»Du musst dich auf alles gefasst machen«, meinte Goll. »Gefangene machen die Bolschewisten nicht.«
»Wenn mein Vater gefallen sein sollte, nimmt mich meine Mutter von der Schule sagt sie.«
Die Schule kostete monatlich zwanzig Mark, außerdem kamen fast alle halbe Jahre die Kosten für Schulbücher hinzu und Lernmittel, Rechenstäbe, Atlanten. Die hohe Schule stellte auch höhere Kostenforderungen bei den, freien Veranstaltungen, den Radtouren, den gemeinsamen Ferien und Theaterbesuchen.
»Wo hat dein Vater gelegen?«
Goll breitete die Karte aus, wir suchten den Ort, wo Bruchners Vater vermutlich gefallen war. An seinem Tod zweifelte keiner.
Dann fragte Schott: »Was sind denn eigentlich Bolschewisten?«
»Die sind anders als wir«, Jendokeit griff in das Gespräch ein, »mein Vater sagt, sie erscheinen uns nur als Menschen, in Wirklichkeit sind sie tief unter Menschen stehend.«
»Die haben wahnsinnig viel Land.«
Jendokeit zeigte die leeren Hände. »Wir haben ja gesehen, wie es im Sowjetparadies zugeht. «
Er spielte auf eine Ausstellung an, die in einem Zeltbau auf dem Berliner Lustgarten von sich reden gemacht hatte. Natürlich waren wir hingegangen. Folter- und Verhörmethoden der GPU waren dort geschildert, Menschen in gewöhnlichen Lebenslagen wurden gezeigt: abgehärmt, mangelhaft bekleidet, schmutzstarrend und bösartig.
»Genau«, sagte Jendokeit, »stellt euch vor, die kommen zu uns her. Die schlachten alles ab.«
Bestätigend nickte Goll. »Mein Vater ist ja da gewesen, er hat erzählt, dass er manchmal entsetzt war über den Dreck und die Armut.«
Schott: »Wieso nennen sie diesen Misthaufen dann selbst ein Paradies?«
»Vielleicht war es vorher noch dreckiger«, sagte Goll. »Wisst ihr, was Pfordte gesagt hat?« Pfordte gab Geschichte. »Dieses Land hat noch nie einer besiegt.«
Auf mich hatten weniger die Worte, mochten sie eine Tatsache ausdrücken oder nicht, Eindruck gemacht, als der Tonfall der Sorge. Pfordte hatte beide Hände auf die Karte gelegt; das Gebiet von der Weichsel bis an den Pazifischen Ozean umspannend.
»Wir wissen sogar noch mehr«, wandte sich Goll an mich, »mein Vater hat anfragen lassen, wie Pfordtes Äußerung zu verstehen sei. Darauf hat der Herr Oberlehrer eine schriftliche Erklärung abgegeben, er zweifle selbstverständlich nicht daran, dass der Führer Stalin in die Knie zwingen
werde.«
»Sieg heil«, sagte Schott, »Pfordte ist ein Arschloch. Warum hatten wir eigentlich einen Pakt mit Stalin?«
Wir verquatschten den Nachmittag.
Die anderen gingen, ich blieb und aß mit den Golls zu Abend.
»Ihr werdet ein schönes Stück von der Welt sehen«, sagte Herr Goll.
»Du musst noch einen Brief schreiben«, sagte die Mutter, »Ludwig kann nicht alles mitmachen mit seinem Bein.«
»Ich werde schreiben, beruhige dich. Und Ludwig wird wohl allein entscheiden können, wozu er körperlich imstande ist und wozu nicht.«
Goll-Teja nickte.
Der Vater redete weiter. »Es ist vielleicht ein bisschen hart für euch, schließlich seid ihr noch keine Erwachsenen, aber im Lager ist es jedenfalls besser als hier. Die Luftangriffe dieser Gangster zwingen uns zu Evakuierungen. Vor allem müssen wir die Jugend vor Schaden bewahren.«
Der Schriftleiter flößte mir viel Respekt ein.
»Bruchners Vater ist bei Leningrad gefallen, Vater«, sagte Goll.
»Die arme Frau.« Es war das erste Mal, dass sich Golls Mutter am Gespräch beteiligte.
»Der Krieg wird spätestens in einem Jahr zu Ende sein.
Dann sind die Kräfte der Russen erschöpft. Sie müssen einen Waffenstillstand anbieten. Das entlastet die Westfront - kurz gesagt, ihr seid noch zu wenig mit Wissen ausgerüstet, um alle Einzelheiten zu erkennen, aber in spätestens einem Jahr trägt Europa ein anderes Gesicht, das Gesicht des Deutschtums. Natürlich ist jeder Gefallene ein Toter zu viel, Ludwig.«
Wir schwiegen und aßen weiter.
»Du bist allein«, fragte mich Frau Goll. »Ludwig sagte so etwas.«
Ich erklärte, dass mein Großvater mich bis zu unserer Abreise betreuen werde.
»Du kannst ganz hierbleiben bis zur Abreise. Ihr seid doch Freunde, ihr müsst jetzt zusammenhalten.«
»Vielen Dank.«
Sie war freundlich und sehr besorgt.
Wir lagen in unseren Betten, Goll hatte die Verdunkelung hochgezogen. Draußen brannte kein Licht, auch die wenigen Autos fuhren mit abgeblendeten Scheinwerfern, eine Maske mit einem kleinen Schlitz. Und doch tröstete uns das bisschen Licht.
»Glaubst du, dass wir in einem Jahr zurück sein werden?«
»Nein.« Ich glaubte es nicht. Selbst wenn der Krieg zu Ende wäre, blieben noch Fragen. Würde mein Vater zu uns zurückkommen? Was wurde aus Barbara, die in Weimar dienstverpflichtet war? Und aus Felix, meinem Bruder? Vielleicht fehlte uns dann auch das Geld, um mich weiter zur Schule zu schicken. Mein Großvater Mattias Stadel war bisher für vieles aufgekommen, war mit Geld eingesprungen, aber würde er sich noch um uns kümmern, wenn mein Vater meine Mutter verließ? Ich erzählte Goll, dass sich meine Eltern vielleicht trennen würden, ohne ihm die Gründe zu nennen.
»Denk jetzt nicht darüber nach, Hans. Ich finde es von deinem Vater gemein, jetzt, im Krieg, aber machen kannst du nichts. Vielleicht ist es gut, dass du wegkommst.«
Am Kai der Jannowitzbrücke versammelten sich einige Hundert Jungen und Mädchen. Unser Gepäck, Tornister, Rucksäcke, Taschen, Koffer, packten wir auf einen Haufen. Alle trugen pflichtgemäß Uniform. Unserer Abreise aus Berlin fehlte der Glanz des Aufbruchs, es regnete in feinen Fäden, die uns bis auf die Haut durchnässt haben würden, hätten wir uns nicht Zeltplanen umgehängt. Dann fehlte aber auch das Tamtam - keine Trommeln, keine Fanfaren, keine Lieder. Auf dem trüben Spreewasser schaukelten sanft die Ausflugsdampfer, auf die wir verladen werden sollten.
Kommandos ertönten. Wir wurden aufgerufen, griffen nach unseren Sachen und rannten zum Stellplatz; drängelten uns hastig in die Reihe, wechselten rasch die Plätze, um die Größten nach vorn an die Spitze zu lassen. Von einer Liste wurden Namen verlesen; die Aufgerufenen schrien hier und machten einen Schritt aus dem Glied nach vorn. Ich streifte Jendokeit mit dem Ärmel, er sah mich kurz an und flüsterte: »Wir müssen zusammenbleiben; Hans, hast du gehört?«
Wir kamen auf kleine und mittlere Spreedampfer, die sonst dem Ausflugsverkehr dienten. Vorn im Bug wurden unsere Sachen verstaut, mit einer großen Plane zugedeckt und fest verschnürt. Etwas Warmes zu essen würde es tagsüber nicht geben.
Die Schiffe legten ab. Es regnete stark, der Wind trieb den Regen ins offene Vorschiff, auf der Persenning bildeten sich kleine Pfützen, Ölgestank verbreitete sich, die Fenster beschlugen vom Atemdunst der vielen kleinen uniformierten Jungen, die alle durcheinander schrien, um ihre Angst und ihren Schrecken vor der Zukunft zu überwinden. An der kleinen Toilette standen sie Schlange, scharfer Uringeruch stieg in den Schiffsraum. An den Türen wachten die Führer und wiesen jeden zurück, der nach draußen wollte. Ich durfte nach oben. In der frischen, feuchten Luft ließ es sich eher aushalten.
Ich blieb noch eine Weile stehen, Treptow tauchte auf; ich erinnerte mich der Festwiese mit dem Mann, der sich aus einer Kanone schießen ließ, und an das Feuerwerk. Dann kamen Oberschöneweide und Köpenick mit dem spitzen Rathausturm und den beiden Brücken. Hier teilt sich die Spree, der eine Arm fließt in den Müggelsee und heißt alte Spree, der andere fließt in die Dahme. Wir fuhren die Dahme aufwärts. Unsere Dampfer machten jetzt schnellere Fahrt. Vor dem Bug des Schiffes, auf dem ich stand, bildete sich, eine Welle, aber ich ging nicht weg, sondern zog die feuchte, kühle Luft in die, Lungen, Mir war klar, dass ich für eine ungewisse Zeit wegging.