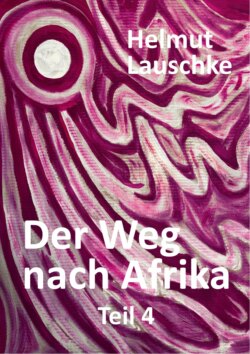Читать книгу Der Weg nach Afrika - Teil4 - Helmut Lauschke - Страница 4
Der schwarze Freitag
ОглавлениеDie Zweierdelegation nahm sich die zweite Woche in Deutschland, als der schwarze Freitag kam. Es war der 19. Februar 1988 ein Zahltag, an dem Menschen, so einige Schwestern, in der Barclay's Bank Schlange standen, um ihre Gehaltschecks gegen bares Geld einzulösen. An den Schaltertheken schoben sie noch die Querformate mit den aufgedruckten Zahlen von Datum und Geldbetrag und den beiden Unterschriften durch den Spalt unter der dick verglasten Trennwand mit dem Sprechloch weiter oben und bekamen dafür die bunteren, oft nachgeahmten Scheine mit den Münzen hinter dem Komma zurück, steckten das Gewechselte in Taschen weg, als sieben vor eins die ganze Bank in die Luft flog. Die Riesenladung Dynamit hatte das Dach hoch katapultiert, die Seitenmauern weggesprengt und vierunddreissig Menschen in den Tod gerissen. Es gab eine grosse Zahl an Verletzten und Schwerverletzten, die wie auf einem laufenden Fliessband gebracht wurden mit Verbrennungen, zerschmetterten und abgerissenen Armen und Beinen, zerrissenen Gesichtern, Armen, Händen und Füssen. Schwestern und Ärzte legten Infusionen, machten Wiederbelebung dort, wo das Leben zu kippen drohte, machten Verbände, wo eine Operation nicht erforderlich war. Da kamen die Patienten in den Sälen auf den Boden, denen es besser ging, um Betten für die Verletzten freizumachen. In allen Op-Räumen wurde operiert, sogar Dr. Ruth, die Gynäkologin, stieg da mit ein, und operierte Dinge, die sie noch nie getan hatte. Einige der Verletzten waren durch die Verbrennungen fürchterlich entstellt. So kam eine Frau im 'theatre 2' auf den Op-Tisch, der das verbrannte Gesicht zu einem Mondgesicht aufgequollen war, das es unmöglich machte, ihr Alter zu schätzen. Sie hatte weitere Verbrennungen an den Armen, über Brustkorb und dem Rücken. Die Gewalt der Explosion hatte ihr den rechten Unterschenkel abgerissen. Die Schwestern sagten, dass sie Sarah sei, eine junge Schwesternhelferin, die vor dem Gang zur Bank eine hübsche, junge Frau gewesen war. Ihr schnitt Dr. Ferdinand im Schnellverfahren den Rest des Beines ab und nähte die überhängenden Weichteillefzen über dem kurzen Oberschenkelstumpf zusammen. Dann versorgte er die vielen Risswunden im Gesicht, an Armen und Händen und legte die Verbände an, die den grösseren Teil des Körpers bedeckten. Ihr wurde das Leben gerettet auf Kosten der Lebensqualität. Für Sarah sollte ein anderes Leben beginnen, von dem sie noch nicht geträumt hatte. Auch der neue Chirurg, der nun nicht mehr so neu war, versorgte im 'theatre 3' Brandwunden und machte Amputationen an Fingern und Füssen. Die Schwestern rannten, wischten den Boden, räumten die gebrauchten Instrumente in die Siebe zurück und brachten neue, verpackte Instrumentensets, wechselten Sauerstoffflaschen und füllten die Narkosegeräte mit flüssigem Lachgas auf. In der Desinfektionsabteilung wurden die Instrumente blutfrei gebürstet, neu verpackt und mit Volldampf sterilisiert. Es war die Not, die alle im Teamgeist vereinte, und keiner nahm Notiz von den durchschwitzten, grünen Hemden und Hosen. Not war der grosse Meister, der jegliches Nörgeln und Zaudern verbot. Alle steigerten sich bis zur obersten Leistungsgrenze, verschütteten ihr Adrenalin, mit dem sie sonst vorsichtiger umgingen. So war die Erschöpfung, die alle nach sechs Stunden befiel, als der letzte Verletzte das 'theatre' verliess, ein Beweis für die aussergewöhnliche Anstrengung und Leistung. Der schwarze Freitag nahm seine zweite Tücke. So gingen schlagartig alle Lichter aus, als sich Dr. Ferdinand im Umkleideraum den Schweiss vom Körper rieb und dabei war, sich das Zivile überzuziehen. Warum das noch dazukommen musste, das wusste er in diesem Augenblick nicht und bekam es auch später nicht heraus, als das Anlegemanöver schon Jahre zurücklag. Der schwarze Kinderarzt als der amtierende Superintendent und ärztliche Direktor in einer Person erschien vor der Ausgangstür des 'theatre', als Dr. Ferdinand das 'theatre' verliess. Draussen, als er auf ihn stiess, stellte der amtierende Superintendent banal fest, dass da ein "power cut" sei, den ein Schaden am Hauptkabel verursachte, was nicht mehr banal, sondern völlig unverständlich war. Da war Glück im zweiten Unglück, dass die Verletzten versorgt waren, bevor der Stromausfall das ganze Hospital befiel und lahmlegte. Da ging nun nichts mehr, und auch in der Nacht sollte es dunkel im 'theatre', dem 'Outpatient department' und in den Sälen bleiben.
Die beiden Sterilisatoren hatten den Dampf und Geist aufgegeben, und die Schwestern dort räumten und bürsteten die Instrumente im Dämmerlicht sauber, so gut da noch sauber zu bürsten war. Ein Unglück kommt selten allein, eine Lebensweisheit, die sich hier an diesem Nachmittag erneut bewahrheitet hatte. Diese Wahrheit holte rasch alle Überflieger jedweder Art auf den Boden der traurigen Tatsache zurück. Die wartenden Patienten, die im 'Outpatient department' im Dämmerlicht sassen, wurden auf ihre Dringlichkeit hin geprüft. Dort trafen die Schwestern die notwendige Auslese, machten aus der geringeren Dringlichkeit die aufgeschobene Dringlichkeit und schickten einen Grossteil der Patienten wieder nach Hause, um am nächsten Morgen bei Tageslicht zu erscheinen. Die dringlichen Fälle mit dem Aufschubsverbot wurden dann und in der Nacht bei Kerzenlicht untersucht und behandelt. Operationen konnten nicht druchgeführt werden. So mussten chirurgische Fälle zum evangelisch-lutherischen Missionshospital nach Onandjokwe weitergeleitet werden, das fünfundvierzig Kilometer von Oshakati entfernt lag.
Dr. Ferdinand verliess das Hospital bei Dunkelheit. Er hatte nochmals nach den Patienten gesehen und Notizen in den Krankenblättern nachgetragen. Es war still über dem Vorplatz, als er ihn überquerte. Der Betonboden vor der Rezeption war von Patienten dicht angereiht, die dort unter Tüchern und Decken lagen und übernachteten. Es waren mehr Patienten als sonst, unter denen auch jene waren, die im Dämmerlicht auf den Bänken in der OPD sassen und darauf warteten, vom Arzt gesehen zu werden, denen die Schwestern aufgrund des Stromausfalls den Status der aufgeschobenen Dringlichkeit gaben und aufs Licht des nächsten Tages vertrösteten. Der Pförtner schob das Tor hinter ihm zu und setzte sich auf seinen Stuhl zurück. Dr. Ferdinand nahm den kürzeren Weg zwischen Stacheldraht und zerfleddertem Lattenzaun und an den fünf leerstehenden, hochgestelzten Blockhäusern vorbei, passierte den Kontrollpunkt am Dorfeingang mit dem zerknitterten 'Permit'-Papier in der Hand, sah vor ihm streunende Hunde die Strasse entlanglaufen, die ihren Kopf geradeaus hielten und von ihm keine Notiz nahmen. Er ging durch eine Sandwolke, die sich legte, und sah von der Fünferkolonne der 'Elands' mit den langen Rohren den letzten von hinten. Dann öffnete er vor seiner Wohnstelle das Tor, schob es wieder zu und legte den Riegel ins Schloss. Die Sandalen mit den durchschwitzten Korksohlen streifte er in der Veranda ab, zog sich im Wohnzimmer das klebrige Hemd vom Körper, warf es über die Sessellehne und machte in der Küche eine Tasse Tee. Mit der Tasse setzte er sich auf die Stufe vor der Veranda und zündete eine Zigarette an. So schwarz war ein Freitag noch nicht gewesen wie dieser, an dem gleich massenweise Menschen in den Tod gerissen wurden. Er erinnerte sich an die russischen Tiefflieger über Pirna, die den Bus zerschossen, den der Vater zur Flucht der Familie, einiger Patienten und Freunde organisiert hatte, der sie durch das ehemalige Böhmisch Mähren zu den besseren Amerikanern fahren sollte, wo dann bei Aussig die gefürchteten Russen kamen, die den Kindern von den urigen 'T-34' Schokoladen und Süssigkeiten runterwarfen. Nach dem Tieffliegerangriff über Pirna lagen die Toten zerschossen in den Strassen, und die Verletzten bluteten sich aus. Er dachte darüber nach, warum der Mensch es nicht seinlassen kann, andere Menschen umzubringen. Da war er sich sicher, dass da die Politik im Spiele war, wo der eine den Erfolg dem andern nicht gönnt, der da kein Pardon und keine Skrupel kennt, das Leben unschuldiger Menschen gleich mit zu vernichten. Die Verrohung im Denken mit der rücksichtslosen Besessenheit nach Macht macht aus dem Menschen den Barbaren, der beim Töten nichts mehr empfindet, auch nicht, wenn er sich vorher an wehrlosen Frauen und Mädchen vergeht. Es war ein Freitag, den er so schwarz nicht wieder erleben wollte. Dr. Ferdinand setzte sich ins Wohnzimmer und las den siebten Psalm in der Buber'schen Verdeutschung: "DU, mein Gott, an dem ich mich berge, befreie mich von all meinen Verfolgern, rette mich!, sonst zerreisst man löwengleich meine Seele, zerspellt, und kein Rettender ist. // Steh auf, DU, in deinem Zorn, erhebe dich wider das Aufwallen meiner Bedränger, rege dich mir zu in dem Gericht, das du entbietest!" Wie oft mögen sich die Juden diesen Psalm vorgesagt haben, als sie nackt Schlange vor den Gaskammern in Auschwitz und Treblinka standen, dachte er in diesem Augenblick. Dr. Ferdinand war erschöpft, doch Hunger hatte er nicht. Er holte sich die zweite Tasse Tee und machte die folgende Notiz:
Nicht nur verfressen seid ihr und spuckt den Wortkern der Not wie einen billigen Kirschkern aus, ihr seht noch zu, wie da gemordet wird, seid selbst Zeuge und fresst weiter.
Um Himmelswillen!, wo fresst ihr euch hin?, und seid doch Teil des Mordes! Von euren Mäulern trieft das Fett, wenn die andern nichts zu essen haben, nur reden wollt ihr nicht, wenn ihr reden solltet.
Was denkt ihr, wer ihr eigentlich seid? Habt ihr Gott in euren Taschen, wenn ihr das Taschentuch herauszieht und das Fett euch von den Lippen, den Essschweiss aus euren Gesichtern wischt?
Denkt ihr euch denn nichts dabei, wenn ihr seht, dass andere hungern, gefoltert und ermordet werden?
Das kann doch nicht sein, solang die Kirche noch im Dorfe steht, wo die Psalme gelesen und nachgesprochen werden!
Ihr, mit den fetten Ärschen, lasst die andern ruchlos verkommen? Geht das schon soweit?
Habt ihr's nicht von den Kindern gelernt, die euch die Plastiken auf die vollen Tische knallen, die Bilder mit den Wasserbäuchen um die Ohren hauen, dass ihr mal zur Besinnung kommen müsst und statt zu fressen jetzt arbeiten und antworten sollt!
Ist es wirklich schon soweit, dass ihr's wisst und das Gewissen schweigt, ihr euch nichts mehr dabei denkt, was da jeden Tag passiert, weil ihr so verfressen seid?
Dann soll euch doch der Teufel holen, egal, wie erhaben ihr euch dünkt!
Die Zeit rennt aus, vergesst es nicht, auch ihr kommt an die Reihe, da werdet ihr's bekommen, um was ihr euch verfressen habt.
Die Hähne krähten den Samstagmorgen ein, die Sonne schickte ihre ersten Strahlen in den Tag. Die Nacht war ruhig gewesen. Dr. Ferdinand nahm den Hörer ab und legte ihn wieder auf. Da war Totenstille. Er ging unter die Brause, um sich den Schlaf vom Körper zu waschen und setzte sich mit der Tasse Kaffee in den ausgesessenen Sessel, um Zeuge des Sonnenaufgangs zu sein und aus ihm das Wissen abzuleiten, dass das Leben weitergeht. Er machte sich auf den Weg zum Hospital und wollte ihn als Spazierweg verstehen. Katzen huschten hinter hohen Grasbüscheln und lauerten. Hunde liefen gedankenlos über die Strasse, als hätten sie nichts im Sinn. Der Wachhabende an der Sperrschranke verschluckte sein Gähnen, als Dr. Ferdinand ihm das "goeiemôre" sagte und das verknitterte 'Permit'-Papier in der Hand hielt. Der Pförtner an der Toreinfahrt sass auf dem Stuhl und pellte das Ei, steckte es in den Mund und verrieb die Eierschalen mit dem Schuh im Sand. Er überquerte den Vorplatz, wo die Menschen vor der Rezeption dicht gedrängt auf dem Betonboden lagen. Im ersten Raum der Intensivstation lag Sarah, deren Gesicht geschwollen war, dass sie die Augen nicht öffnen konnte. Die Temperatur ihres Körpers war erhöht, sie musste mehr Flüssigkeit trinken. Der Blutdruck hielt sich an der unteren, der Puls an der oberen Grenze. Sie schlief, da ihr die Schwester kurz vorher die Spritze gegen die Schmerzen gegeben hatte. Er trug ihr Befinden mit den lebenswichtigen Daten im Krankenblatt ein, sah nach den andern Patienten und notierte deren Lebensdaten ebenfalls. Dr. Ferdinand ging noch durch die anderen Säle, um auch dort nach den Patienten zu sehn, die das Unglück des schwarzen Freitags hart getroffen hatte. Dann schaute er noch ins 'Outpatient department', wo die Patienten vom vergangenen Abend sassen, denen die Schwestern aufgrund des Stromausfalls die aufgeschobene Dringlichkeit zugesprochen und sie aufs Licht des nächsten Morgens vertröstet hatten. Da es keine chirurgisch Verletzten gab, trat er den Rückweg an, nahm den Weg über das Postamt, wo er einen Brief aus Deutschland aus dem Postfach zog, kaufte im kleinen Supermarkt Brot, Aufstrich und Zigaretten und ging zur Wohnstelle zurück. Er streifte die Sandalen in der Veranda ab und machte sich in der Küche einen Tee, in den er zwei Teelöffel Zucker einrührte. Der Brief kam vom Bruder, der wissen wollte, wie es ging, ob es etwas Neues zu berichten gab. Er schrieb von der Arbeit in Deutschland, wo die Menschen im Dauerstress stecken, weil sie anders nicht mehr leben könnten. Alle machten ein ernstes Gesicht, weil das Finanzamt immer tiefer in den Taschen griff. Die Zahl der Arbeitslosen nehme zu, doch die Gewerkschaften streiken weiter. Die grossen Unternehmen verlegen ihre Werke nach Asien und Amerika, um billiger zu produzieren und die hohen Lohn- und Lohnnebenkosten zu umgehen. So nehme die Armut im Lande zu und mit ihr die Diebstähle in den Kaufhäusern und der Autos von den Parkplätzen. Die Autos fahren dann mit neuen Besitzern in den Ostblockländern weiter oder werden über Italien und den Balkan nach Afrika verschifft. Millionenbeträge gingen in die DDR, die ihre politischen Gefangenen zu Höchstpreisen verhökerten und mit dem Menschenhandel ihre Devisenlöcher stopfen.
Aus Afrika wusste der Bruder zu berichten, dass sich die südafrikanische Armee aus Angola zurückziehe, die dem Dr. Jonas Savimbi und seiner UNITA (União Nacional da Independencia Total de Angola) den Rest überlasse. Da dachte der Bruder in Afrika an die letzte Entscheidungsschlacht, wie sie der Brigadegeneral bezeichnete, als er mit erhobenem Zeigefinger sagte, dass da viel auf dem Spiele stehe und das Pulverfass erwähnte, auf dem er wie die andern Weissen sässen, das jederzeit hochgehen könne. Dr. Ferdinand legte den Brief zur Seite und zündete sich eine Zigarette an. Er dachte an die Menschen in Deutschland, die dem Wirtschaftswunder der fünfziger Jahre nachtrauerten und denen es im Vergleich zu den Menschen vor der angolanischen Grenze noch ausgezeichnet ging. Was würden die Menschen sagen, wenn dort die Bank in dem Augenblick in die Luft gesprengt würde, wenn sie vor den Schaltern Schlange ständen, um ihre Schecks gegen Bares einzulösen? Doch damit war seit dem Ende der RFA mit der Philosophiestudentin Ulrike Meinhof und dem Rechtsanwalt Andreas Baader, für den sich der Existentialphilosoph, Schriftsteller, Theaterstückschreiber und Erzähler Jean-Paul Satre ('Wege der Freiheit', 'Der Aufschub', 'Der Pfahl im Fleische', 'Tote ohne Begräbnis') noch eingesetzt hatte, wohl nicht mehr zu rechnen.
Dr. Ferdinand setzte sich gegen elf ins Auto und fuhr zur katholischen Missionsstation nach Okatana. An der Sperrschranke des zweiten Dorfausgangs mit der MG-Doppelstellung auf dem Wasserturm, der vor einem Jahr einen Granatenschlag abbekommen hatte, dass er schief stand, und wieder ins Lot gesetzt wurde, zeigte er sein 'Permit'-Papier vor, liess das Auto mit Verschieben der Vordersitze von innen inspizieren, und setzte die Fahrt fort. Er bog nach etwa einem Kilometer von der geteerten, strategischen Ost-West-Strasse nach rechts ab, passierte die vorwiegend von angolanischen Flüchtlingen bewohnte Blechhüttensiedlung mit den hängenden Tüchern vor den Eingängen und den gaffenden, schäbig gekleideten oder nackten Kindern, die am Strassenrand standen und grosse Augen machten. Da liefen die ständig knabbernden Ziegen zwischen den tuchverhängten Blechgestellen hin und her, gefolgt von abgemagerten Hunden. Dort lag die bunte Wäsche zum Trocknen auf den Dächern, wo daneben wenige, dürre Rinder in enger Umzäunung standen und auf ihren Schlachttag warteten. Vor ihm liess er zwei Schweine die Strasse in Richtung angolanische Siedlung überqueren, bevor sich die Räder durch den lockeren Sand mit den tief eingefahrenen 'Casspir'-Spuren wühlten. Er kam am Wasserturm vorbei, der etwa hundert Meter links von der Sandstrasse stand, von dessen Dach ihm das MG fast eine von rechts verplättet hätte, als er eines Nachts auf dem Rückweg von Okatana nach Oshakati war und nicht angehalten hatte, als ihm die Leuchtraketen in den Farben blau, gelb, rot das sofortige Anhalten signalisierten, was er damals nicht lesen konnte und die Farbenfreude der Raketen für einen freundlichen Nachtgruss hielt.
So schlingerte er die langen fünf Kilometer bis zur Mission, wo ihn die Patres freundlich begrüssten. Sie standen unter dem grossen Baum vor dem Eingang zum Haus der Patres. "Das ist ja schlimm, was da passierte", sagte der eine Pater, der sonst immer sagte, dass es schön sei, den Doktor mal wieder zu sehen, der solange nicht mehr da war. Sie gingen ins Haus und setzten sich ins Wohnzimmer mit den langen Wandregalen, die mit theologischen Büchern, Biographien und zusammengefassten Traktaten einiger Päpste und anderer frommer Männer gefüllt waren, und dem grossen Eisschrank, aus dem der andere Pater ein kaltes Bier herausholte, es in ein Glas einschenkte und Dr. Ferdinand vorsetzte. Auf dem Tisch lagen der 'Osservatore', das offizielle Wochenblatt des Vatikans und die 'Allgemeine Zeitung' für die Deutschsprachigen in Südwest. "Es war ein schwarzer Feitag, der viele unschuldige Menschen in den Tod gerissen hat, andere, die es überlebten, durch die Verbrennungen und andere Verletzungen ein Leben überliess, an dem sie sich nicht mehr erfreuen könnten, der Kinder zu Waisen machte und die Menschen noch mehr verunsicherte, als sie es schon waren", kam er auf die Begrüssungsworte des Paters zurück, der das Wort "schlimm" gebrauchte. Sie sagten, dass es auch Familien in ihrer Gemeinde getroffen habe, wo den Kindern nun die Mütter fehlten. In einigen Familien hätte das Schicksal noch schwerer zugeschlagen, weil da beide Eltern fehlten, weil es den Vater seit langem nicht mehr gab, der entweder im Gefängnis sässe, oder mit der Swapo ins Exil gegangen war, oder erschossen oder von einer Mine zerrissen wurde. "Da kann man nur hoffen, dass das bald zu Ende geht, sonst haben wir nur noch Waisenkinder", sagte der andere Pater. Dr. Ferdinand erzählte von den Verletzten, von Sarah mit den schweren Verbrennungen, die er auf dem Op-Tisch nicht wiedererkannte, weil ihr Gesicht zugeschwollen war, die vor dem Gang zur Bank eine hübsche, junge Frau gewesen war, der er nachher, weil sie die Explosion überlebte, das rechte Bein abschneiden musste. Da sagten beide Patres aus einem Munde: "das ist ja furchtbar.” Er sprach von den vielen Operationen, als sich keiner schonte, weil die Not der Meister war, die weder ein Nörgeln noch ein Zaudern erlaubte, die Ärzte und Schwestern zu einem Team zusammenschweisste.
Als er dann vom Stromausfall sprach, nachdem der letzte Verletzte aus dem 'theatre' gefahren wurde, weil das Hauptkabel beschädigt war, da fiel es den Patres schwer, ein Wort zu sagen, weil sie an ein Wunder da nicht glauben wollten. Das Mittagsglöckchen läutete zum Essen, und die Patres luden Dr. Ferdinand zum Mittagessen ein. Ein Pater sprach das Gebet vor dem Essen, in dem er der Toten und Verletzten, ihrer Familien und der Waisenkinder gedachte und den lieben Gott mit ganz einfachen Worten um seine verspätete Barmherzigkeit bat. Zu lang wollte er sein Gebet nicht machen, und so blieben die Obdachlosen und Hungernden diesmal unerwähnt. Nach dem "Amen" schlug jeder der Patres sein Kreuz auf die Brust. Im Einnehmen der Stühle wünschten sie einander und Dr. Ferdinand einen guten Appetit. Mit dem schärferen Messer war das zarte Schweinekotelett mühelos zu schneiden. Die gedämpften Kartoffeln hatten ihre Form behalten, sie waren weder wässrig noch versalzen. Der Salat war köstlich zubereitet, und der Zitronensaft war hausgemacht. Da liess sich gut essen unter dem verglasten Foto der freundlich auf den Tisch blickenden Muttergottes an der Wand, und Dr. Ferdinand genoss das Essen, das sich von der Hospitalkost so sehr unterschied. Die Patres wussten es offenbar besser, als sie sagten, dass das Ende des Apartheidregimes greifbar nahe sei, und die Menschen voll hinter der Swapo ständen. Dr. Ferdinand wollte es gerne glauben, doch nannte er den schwarzen Freitag einen barbarischen Schlag gegen die Menschen, der einen tiefen Krater auf dem letzten Wegstück gerissen hatte.
"Wer konnte dahinter stecken?", fragte er über den Tisch. Die Antwort kam spontan: "die Swapo tut so etwas nicht." Auch die Patres hatten es erfahren, dass da wenige Minuten vor der Explosion schwarze Männer eine Kiste in der Bank abgestellt hätten, was im Gedränge der Menschen unbeachtet blieb. Sie sagten, dass es schwarze Männer nicht nur bei der Swapo, sondern auch bei der Koevoet (Brecheisen) gäbe, die weiterhin ihre nächtlichen Patrouillen mit den 'Casspirs' fuhren und hin und wieder Männer aus den Dörfern mitnähmen. Sie fügten hinzu, dass es schwer sein würde, die Schuldigen ausfindig zu machen. Nach dem kurzen Dankgebet zeigten die Patres das vergrösserte, neu ausbetonierte und blau gestrichene Schwimmbecken, das neben dem Patreshaus hinter hohen Mauern geschützt lag, zu dem sie durch eine schmale Aussentür gingen, die zu verschliessen war. Hinter der hohen Grenzmauer hatte sich das breite, gebogene Flussbett des Cuvelai zu einem See gestaut, über dem das grelle Sonnenlicht gleisste. Sie zeigten den Garten, in dem das Gemüse stand mit den grossen Salat- und Kohlköpfen, die Stangenbohnen, die die Zweimeterhöhengrenze überstiegen, wo der Boden dunkelerdig war und täglich aus den verlegten Leitungsrohren bewässert wurde. Die Gänse, bei denen es Junge gab, stolzierten durch ihren kleinen Garten an zwei Schildkröten vorbei. Sie hatten ihren kleinen Teich für sich, in den sie die Köpfe tauchten und nach dem Auftauchen mit den Schwingen hin und herschlugen. Daneben stand das grosse Vogelhaus mit den afrikanisch bunten Vögeln, die da munter dazwischenzwitscherten. Dann kam der Hühnerstall mit den Eiergelegen und den Durchgängen zu den zwei grossen, hoch eingezäunten Aussengehegen, getrennt nach jung und alt, wo einigen Hähnen der Kamm schwoll, wenn es die Hennen nicht wollten, oder das Jungvolk ihnen lästig wurde. Schliesslich machten sie den zwei Schweineställen die Aufwartung, von denen der eine durch halbhohe Trennmauern in Abteilungen für die Säue, die tragend waren und jene, die geworfen hatten, unterteilt waren, wo die Frischlinge mit der rosanen Haut vor den Zitzen der vollen Milchleisten lagen und an ihnen sogen, dabei mit den Vorderpfötchen gegen das Gesäuge der Mutter traten, um da noch mehr herauszusaugen. In den beiden letzten Abteilungen waren die Eber, erst der jüngere, der erregt grunzend und unruhig mit den Füssen in seiner Stallung auf der Stelle trat, weil er es kürzlich zum Vater brachte, und schliesslich der Stammeber, ein Riesenkerl, der da ausgestreckt lag, weil er das Ruhealter erreicht und als Vater genug Gutes geleistet hat. Er hatte ausgedient. Die Patres sprachen ihm weitere Vaterschaften ab und den nächsten Schlachttermin zu, weil es der Sohn beim Besteigen der Säue nicht weniger leidenschaftlich als der Vater machte und dabei gute Resultate erzielte. Im anderen, dem Kommunenstall, wurden die Ein- bis Vierjährigen gehalten, die durch grössere Durchgänge zum Schweinehof ausliefen und für den regelmässigen Fleischvorrat sorgten. Für den Schlachttermin hielten die Patres einen Revolver bereit, den sie, wenn es soweit war, eigenhändig dem Schwein ins Genick drückten und ihm den Gnadenschuss von hinten gaben. Sie sprachen aus Erfahrung, dass bei diesem Schuss, bei dem alles sehr schnell ginge, das Schwein erst gar nicht zu leiden hätte. Die Ställe waren von hervorragender Sauberkeit, dass man eigentlich nicht von einem Schweinestall sprechen sollte. Die Schweine der Kommune wurden täglich abgespritzt, wie ihre Stallung auch. Die Schweine bekamen eine hochwertiges, vitaminreiches Futter, wozu gestampfte Blätter vom Feigenkaktus aus dem davorliegenden Kaktusgarten als Zwischenspeise kamen, was ihnen dem wohligen Grunzen nach zu schmecken schien.
Hier war das Biotop in Ordnung, ein Mikrokosmos war auf der Mission im unheilvollen Makrokosmos heil versteckt. Es war die Leistung der Patres und der fleissigen Nonnen, die kein Aufheben davon machten, was aber anzuerkennen war. Ein Stück Frieden lag in dieser Mission eingezäunt im Durcheinander des Krieges. Dr. Ferdinand verabschiedete sich, und die Patres begleiteten ihn zum Auto. Sie gaben ihm die Worte mit: "Gott wird es schon recht machen", und "kommen Sie bald wieder!"
Beim Wegfahren waren einige ältere Schwestern, denen das Pensionsalter anzusehen war, auf dem Wege zur kleinen Kapelle gegenüber dem Patreshaus, um ihr Gebet zu verrichten. Ihre leicht nach vorn gebeugten Rücken konnte Dr. Ferdinand im Rückspiegel sehen, bevor er die Mission hinter dem offenen Tor verliess und in die erste Rechtskurve vor dem kleinen Hospital fuhr, um nach dreissig Metern die Linkskurve vor der kleinen Missionsschule zu nehmen. Die Räder des Frontantriebs wühlten sich in den aufgeworfenen Sand neben den eingefahrenen, breiten 'Casspir'-Spuren. Er fühlte sich nach den Stunden seines Dortseins erleichtert und erholt. Er sah, wie alte Männer mit kurzen Stöcken in der Hand mal auf der linken, mal auf der rechten Strassenseite einige magere Rinder vor sich hertrieben, alte Frauen schmale Äste von toten Bäumen brachen, das Holz zusammenlasen, mit jungen Palmblättern zusammenbanden, die Bündel auf den Kopf luden und sie davontrugen. Andere Frauen, einige mit kleinen Kindern auf ihre Rücken gebunden, und Mädchen trugen Eimer mit Wasser und Schüsseln mit Maiskolben und andern Feldfrüchten auf den Köpfen, ohne dass sie beim Gehen verrutschten. Das Auto schlingerte über die Fahrspuren nach beiden Seiten durch den lockeren Sand, und die Räder schlugen einige Male in die ausgefahrenen Schlaglöcher. Den Wasserturm mit der aufgesetzten MG-Stellung liess er nun rechts vom Wege liegen und dankte dem Schutzengel von damals, dass er ihn in eine dichte Sandwolke gesteckt und so vor dem Erschiessen gerettet hatte. Nach der langen Rechtskurve fuhr er an der Strassensiedlung angolanischer Flüchtlinge mit den erbärmlichen, zusammengestückten Hütten aus verdelltem Blech, verwittertem Sperrholz und verbogenen Pappen mit den herabhängenden bunten Tuchfetzen vor den Eingängen, was 'Angola' genannt wurde, vorbei, wo Schweine des mageren Formats die Strasse nach beiden Seiten überquerten, und Kinder mit dünnen Armen und Beinen in armseliger Bekleidung, die ganz kleinen nackt, am Strassenrand standen und weiter grosse Augen machten, als wären es dieselben, an denen er auf seiner Hinfahrt zur Mission vorbeigefahren war. Auf der geteerten Strasse bog er links ein und nach zwei Kilometern nach rechts. Da verliess er die Teerstrasse, und die Räder schlugen einige Male in tiefe Schlaglöcher, weil sie einfach nicht zu umfahren waren. An der Sperrschranke neben dem instandgesetzten Wasserturm mit der MG-Doppelstellung auf dem Dach wies er sich mit dem zerknitterten 'Permit'-Papier aus, während die Wachhabenden von den Seiten und von unten den Wagen unter die Lupe nahmen und dabei den Kofferraum bis zum Ersatzrad durchsuchten. Die Sonne senkte sich dem Horizont zu, als er die Wohnstelle erreichte. Er öffnete das Tor, fuhr das Auto auf seinen Platz, schob das Tor wieder zu und drückte den Riegel ins Schloss zurück.