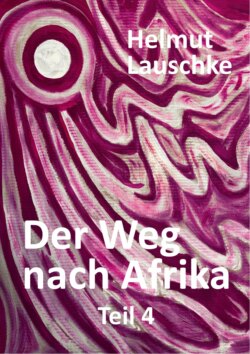Читать книгу Der Weg nach Afrika - Teil4 - Helmut Lauschke - Страница 5
Aus: Tote ohne Begräbnis – (Sartre: ‘Morts sans sépulture’)
ОглавлениеDr. Ferdinand hatte den üppigen Gemüsegarten, den Auslauf für die Gänse mit dem kleinen Teich, den beiden Schildkröten im Sand, den vollen Hühnergehegen mit den wenigen Hähnen, denen der Kamm schwoll, wenn es die Hennen nicht wollten, und die sauberen Ställe mit den gut genährten Schweinen und den tretenden Frischlingen gegen das Gesäuge der Sau im Auge, hatte das muntere Gezwitscher aus dem grossen Vogelhaus im Ohr und dachte über das Wunder des heilen Biotops auf der Mission nach mit dem eingezäunten Stück Frieden. Das war für ihn etwas Besonderes, dass es das in den Zeiten des Krieges mit seiner Eskalation gab. Er machte sich eine Tasse Kaffee und las ein Buch dazu. Die deutsche Studentin hatte ihm auf seine Bitte einige rororo-Bände von Sartre geschickt, die er an den Wochenenden, die er zu seinen Lese- und Schreibtagen ausgewählt hatte, lesen wollte. Es war Sartre's Bühnenstück 'Tote ohne Begräbnis' (Morts sans sépulture): Da spricht der Widerstandskämpfer Sorbier zu seinen Freunden, die alle in Handschellen auf dem Dachboden hocken, wo ein Stockwerk tiefer französische Milizionäre des Pétain-Regimes Geständnisse aus ihnen herausfoltern werden, in der ersten Szene des ersten Akts von "Dreihundert, die nicht sterben wollten und für nichts gestorben sind. Sie liegen zwischen den Steinen, und die Sonne schwärzt sie; man kann sie sicher von allen Fenstern aus sehen. Unsertwegen. Unsertwegen gibt es in diesem Dorf nur noch Miliz, Tote und Steine. Es wird hart sein, mit diesen Schreien in den Ohren zu krepieren." Der fünfzehnjährige Franpis hat Angst vor der Folter und geht auf und ab. Er sagt seiner älteren Schwester Lucie: "Ich muss im Kreis herumgehen. Wenn ich stillsitze, fangen meine Gedanken an zu kreisen. Ich will nicht denken." Über Sinn und Unsinn des Lebens, weil sie dem Befehl gehorchten, das Dorf einzunehmen, was ihnen missglückte, und dreihundert Menschen den sinnlosen Tod brachte, sagte Sorbier zu Canoris, dass der Mensch ein Recht habe, seinem Tod einen Sinn zu geben, weil das alles ist, was ihm noch bleibt. Henri sagte: "Wir hatten keine Zeit, sie zu begraben, auch nicht in unseren Herzen. Nein. Ich fehle nirgends, ich hinterlasse keine Leere. Ich bin aus der Welt gerutscht, und sie ist voll geblieben. Wie ein Ei. Man muss annehmen, dass ich nicht unentbehrlich war." Canoris sagt zu dem Dilemma: "Wir sind nicht dazu geschaffen, immer an den Grenzen unserer selbst zu leben." Henri meint: "Mit etwas Glück werde ich mir vielleicht sagen können, dass ich nicht für nichts sterbe." Beim Verhör eine Etage tiefer sagt Pellerin zu Henri, der vor dem Krieg Medizin studierte: "Du bist gebildet, du Schwein; (zu den Milizionären) schlagt zu." Clochet, der andere Verhörer, sagt: "Du wirst schreien, Henri, du wirst schreien. Ich sehe, wie der Schrei deine Kehle anschwellen lässt; er kriecht zu deinen Lippen hoch. Noch eine kleine Anstrengung. Dreht. (Henri schreit.) Ha! Wie du dich schämen musst. Dreht. Lasst nicht nach. (Henri schreit.) Du siehst, nur der erste Schrei kostet einen was. Jetzt wirst du reden, ganz leise, ganz natürlich." Am Schluss des ersten Verhörs (sechste Szene, zweiter Akt) sagt Clochet zu Henri; "Komm, sei nicht so stolz. Du hast geschrien, du hast doch geschrien. Morgen wirst du reden." Nach diesem Verhör sprechen die Verhörer unter sich: Pellerin: "Das Schwein!"; Landrieu: "Das ist eine Scheisse."; Clochet: "Was?"; Landrieu: "Das ist eine Scheisse, wenn einer nicht redet."; Clochet: "Er hat doch geschrien. Er hat geschrien..."; Pellerin: "Bringt das Mädchen!"; Landrieu: "Das Mädchen...Und wenn die nicht redet..."; Pellerin: "Dann..."; Landrieu: "Nichts ...Einer muss doch reden."; Clochet: "Den Blonden muss man runterbringen. Der ist reif."; Landrieu: "Den Blonden?"; Clochet: "Sorbier. Das ist ein Feigling."; Landrieu: "Ein Feigling? Hol ihn!". Beim folgenden Verhör (neunte Szene) Clochet zu Sorbier: "Du bist Jude?": Sorbier (erstaunt): "Ich? Nein."; Clochet: "Ich schwöre dir, dass du Jude bist. (die Milizionäre schlagen auf ihn ein.) Du bist nicht Jude?"; Sorbier: "Doch. Ich bin Jude."; Clochet: "Gut. Also hör zu: zuerst die Fingernägel. Das wird dir Zeit zum Nachdenken geben. Wir haben es nicht eilig, wir haben noch die ganze Nacht! Wirst du reden ? (zu den Milizionären) Nehmt die Zange und fangt an!" Sorbier, der als "Feigling" den Anschein zum Reden gab und vor Schmerzen nicht mehr sitzen konnte, wurde losgebunden. Er ging auf den Tisch der Verhörer zu und verlangte eine Zigarette. Landrieu: "Danach."; Sorbier: "Was wollt ihr wissen ? Wo der Anführer ist ? Ich weiss es. Die anderen wissen es nicht, aber ich weiss es. Ich war sein Vertrauter. Er ist...(zeigt abrupt auf einen Punkt hinter ihnen) ...da!" Die Verhörer und Milizionäre drehen sich um. Sorbier stürzt sich durchs offene Fenster, die Milizionäre können ihn nicht halten. Er springt ins Leere und schreit: "Denkst du! He, ihr da oben! Henri, Canoris, ich habe nicht geredet." Die Verhörer lehnen sich aus dem Fenster. Pellerin: "Das Schwein! Die Memme!" Die Milizionäre werden runtergeschickt, um ihn rauf zu bringen und weiter zu bearbeiten, "bis er uns unter den Händen abkratzt" (Landrieu). Sie kommen zurück: "Krepiert!" Um dem jungen Francois die Folterqualen zu ersparen, unter denen er reden würde, wird er von Henri auf dem Dachboden erdrosselt. Lucie (seine ältere Schwester) sagt da (zweite Szene, dritter Akt): "Du bist tot, und meine Augen sind trocken; verzeih mir. Ich habe keine Tränen mehr, und der Tod ist nicht mehr wichtig. Draussen liegen dreihundert im Gras, und auch ich werde morgen kalt und nackt sein, ohne dass eine Hand mir übers Haar streicht. Es gibt nichts, dem man nachtrauern müsste, weisst du. Auch das Leben ist nicht so wichtig. Adieu, du hast getan, was du konntest. Du hast vorher aufgegeben, weil du einfach noch nicht genug Kraft hattest. Niemand hat das Recht, dich zu verurteilen." Lucie wurden beim Verhör die Fingernägel mit Zangen ausgerissen. Sie wurde ausgepeitscht und vergewaltigt. Sie hatte nicht geredet, doch wurde sie in ihrem Stolz verletzt. Sie schreit es heraus (zweite Szene, vierter Akt): "Ihr habt mich vergewaltigt, und ihr schämt euch. Ich bin reingewaschen. Wo sind eure Zangen? Wo sind eure Peitschen? Heute morgen fleht ihr uns an zu leben. Und wir sagen nein. Nein! Ihr müsst eure Sache zu Ende machen." Pellerin: "Genug! Genug! (zu den Milizionären) Schlagt drauf!" Henri (dritte Szene, als sie sich auf der Verhöretage ohne die Verhörer absprachen): "Ich will dieses Kind nicht dreissig Jahre überleben. Ich will mich nicht jeden Tag fragen müssen, ob ich ihn aus Stolz umgebracht habe. Canoris, das ist so einfach. Wir haben nicht einmal Zeit, den Lauf ihrer Gewehre zu sehen ...(beim Blick aus dem Fenster) Soviel Sonne über so vielen Leichen. Diese Sonne werden wir jeden Tag wiedersehen müssen. Puah!" Lucie zu Canoris und Henri: "Idiot! Reines Herz! Du kannst gut leben, du hast ein ruhiges Gewissen. Sie haben dich ein bisschen herumgestossen, das ist alles. Mich haben sie erniedrigt, jeder Zoll meiner Haut widert mich an. Und du, der du dich aufspielst, weil du ein Kind erwürgt hast, denk mal dran, dass dieses Kind mein Bruder war und dass ich nichts gesagt habe. Ich habe alles Übel auf mich genommen; man kann mich nur noch auslöschen und alles Übel mit mir." Henri: "Es wird von uns nicht mehr verlangt, dass wir Helden sind; wir müssen leben. Gibt es nichts, dem du auf der Erde nachtrauerst ?" (Jean, den sie geliebt hatte, der als Anführer auf freiem Fusse ist). Lucie: "Nichts. Alles ist vergiftet." Henri zu Lucie: "Du wirst ihn wiedersehen, wenn du lebst ...Und die Kinder, die man im Frühling vor dem Sägewerk auf einem Baumstamm sitzen sah. Sie lächelten uns zu, wenn wir vorbeigingen, und es roch nach feuchtem Holz ...Trauerst du ihnen Nach ?" Lucie: " Sie sind geflohen, als die Deutschen kamen. Ich werde sie nicht wiederfinden." Henri: "Es gibt andere Kinder in den Lagern. Selbst über den Lagern ist ein Stück Himmel." Canoris: "Wir tun das Richtige. Man muss leben." Er geht auf einen Milizionär zu: "Sag deinen Vorgesetzten, dass wir reden werden." Landrieu (vierte Szene): "Nun ?" Canoris folgt der Anweisung Jean's, der als Anführer für kurze Zeit unerkannt mit ihnen zusammengesperrt war, die Verhörer auf die Spur in eine Grotte zu lenken, in die Jean einen toten Kameraden gelegt und seine Papiere in die Tasche des Toten gesteckt hatte. So nannte Canoris die Grotte, wo sich der "Anführer" mit den Waffen versteckt hält. Pellerin zu Landrieu (fünfte Szene): "Glaubst du, sie haben die Wahrheit gesagt ?" Landrieu: "Natürlich. Es sind Tiere ...Na? Wir haben sie schliesslich gekriegt. Hast du gesehen, wie sie abgezogen sind ? Sie waren weniger stolz als bei ihrem Einzug." Pellerin zu Landrieu: "Lässt du sie am Leben?" Landrieu: "Oh! Auf jeden Fall, jetzt..." Da kommt die Salve unter den Fenstern. Landrieu: "Was ist...? Clochet, du hast doch nicht etwa..." Clochet (lachend): "Ich war der Meinung, das ist menschlicher." Landrieu: "Schwein!"; Pellerin: "Wie würde man denn vor den Überlebenden dastehen."; Clochet: "In einem Augenblick wird niemand mehr irgend etwas über all das denken. Niemand ausser uns." Dritte Salve. Landrieu sackt zusammen: "Uff!" Clochet geht zum Radio, dreht an den Knöpfen. Musik.
Da stand die 'Uff' -Welt in ihrer hahnebüschenden Sinnlosigkeit diametral der gewachsenen, eingezäunten Sinnhaftigkeit des heilen Biotops auf der Mission gegenüber. Diese Gegensätze waren unvereinbar. Da gab es keinen Zwischenreim, weil das Dach des Verständnisses über dem 'Uff' nicht war, sehr wohl aber über dem Gemüsegarten, dem Gänseauslauf, den Hühnergehegen und Schweineställen. Das Schwein im Biotop der Mission hatte mit dem Schwein Clochet, wie Landrieu ihn nannte, nichts gemeinsam. Das Schwein auf der Mission war sauber, wurde täglich abgespritzt, war nützlich. Das Schwein Clochet war ein Mensch, der im Charakter runtergekommen war. Da war der Mensch dreckig im Gegensatz zum sauberen Schwein. Clochet war skrupellos und erschoss lachend die Opfer nach der bestialischen Folterei und Vergewaltigung der Frau, weil er beim Raddrehen der Geschichte einer späteren Abrechnung keine Chance geben wollte. Er tat es gegen den Befehl seines Vorgesetzten Landrieu, dem er deshalb auch die Erinnerung auslöschte und die dritte Salve verpasste. Alles das machte ein sauberes, natürliches Schwein nicht. Reichte es nicht, dass Menschen das Schweinefleisch essen? Musste das nützliche Schwein nun auch mit seinem Namen für die hemmungslose Gefrässigkeit des Menschen und seinen schmutzigen Charakter herhalten? Dr. Ferdinand fand es verkehrt, dass der Mensch dem Schwein etwas Unanständiges unterstellte, was dem Menschen, nicht aber dem Schwein, gehörte. Nur der Mensch hat keine Würde, der sich respektlos an seinesgleichen und den Tieren vergeht. Das Schwein, der Esel, und wie sie alle heissen, machen das nicht.
Der Mensch diskriminiert den Stolz der Tiere, wenn er ihre Namen auf Menschen setzt, denen es an Würde fehlt. Tiere haben ihren Stolz, respektieren sich untereinander. Sie kennen keine Folter und haben mit der Schlechtigkeit des Menschen nichts gemeinsam. Wie sagt doch der Dichter (Eugen Roth): "Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere." Sartre spricht von der Folter als dem Kapitalverbrechen gegen die Menschlichkeit, das noch heute auf der ganzen Welt verbreitet ist. Die Gefesselten fragen sich, ob sie unter der Folter schreien oder reden werden. Sie fragen sich nach dem Sinn eines befohlenen Unternehmens, bei dem Hunderte unschuldiger Zivilisten umgekommen sind. Sie fragen sich nach dem Sinn ihres Todes nach dem Fehlschlag des Unternehmens. Sie wissen, dass die Folterqual das Risiko des Redens hat, wenn man bis zum Verräter gefoltert wird. Selbstmord ist da nur wenigen vergönnt. Kollaborateure und Milizionäre wissen um ihre Schändlichkeit, wissen, dass sie Abschaum sind. Da sie auch wissen, dass der Krieg verloren ist, wollen sie an Menschlichkeit nichts zurücklassen. Da kommt die Bestie im Menschen heraus, wenn der Folterer das Opfer bis zum Abschaum verpeitscht, vergewaltigt und zerschlägt. Aus der Verantwortung für seine fürchterlichen Taten kann sich der Mensch dennoch nicht entziehen. Das ist es, wenn es auf den eigenen Tod zugeht, und Sorbier von den dreihundert Toten spricht, die nicht sterben wollten und für nichts gestorben sind. "Es wird hart sein, mit diesen Schreien in den Ohren zu krepieren." Das im Gegensatz zu Landrieu, der der Nachwelt ein "Uff!" hinterlässt.
‘Tote ohne Begräbnis’, ein Mahnmal der Zeit, ein Totenmonument, das nicht weniger hoch vor der angolanischen Grenze stehen könnte. Dr. Ferdinand legte das Buch zur Seite, machte sich einen Kaffee, setzte die Tasse neben sich auf die Stufe vor der Veranda und zündete eine Zigarette an. Die Sonne war hinter dem Horizont abgetaucht, und die Abendsterne flackerten ihr Licht herab. Er schaute auf die Pfoteneindrücke einer Katze und fragte sich, warum die Menschen es nicht schafften, von den Tieren zu lernen, die es doch vormachen, was natürlich, was anständig ist. Es musste etwas mit der Entfremdung zu tun haben, wo sich der Mensch von der Natur und von sich selber entfremdet, wo er sich selbst im Wege steht. Das Gewissen ist verkümmert, das Gefühl verloren, dass um sich noch was andres lebt, das ihn durchs Leben begleitet, ihn leiten möchte. Die verlorene Gemeinschaft ist ein verlorenes Sich selbst. Das Alleinsein trägt das Risiko des Ausgestossenseins in sich, wo es leicht zu Irrwegen kommen kann, die dem sozialen Frieden nicht bekommen. Das hat die Apartheid mit der weissen Hautfarbe zur Genüge gelehrt, die in einem Chaos gelandet war, wo eigentlich keiner mehr richtig weiss, wo vorn und hinten ist, weil im Drunter und Drüber des Vorrechtsdenkens die Orientierung verlorenging, es einen klaren Blick in die Zukunft nicht mehr gibt. Menschen des Abschaums hat es auch hier gegeben, die ihre Opfer hart verpeitschten, die Elektroden ans Genitale setzten und aufklebten, sie je nachdem, ob sie redeten oder nicht, unter steigenden Voltamperes zuasammenzucken liessen. Ja, die Opfer wurden entwürdigt, zu Abschaum verwandelt, ihr Stolz brutal zerschlagen. Da stieg die Wut der Ohnmacht ins Gesicht, da schlug der Ekel der Widerwärtigkeit auf den Magen. Die Menschen wussten mit ihren hohen Blutdrücken nicht mehr wohin. So war das verwüstete Feld vor der angolanischen Grenze, wo Armut und Elend herrschten, auch das Feld für die Toten ohne Begräbnis.
Dr. Ferdinand setzte sich ins Wohnzimmer und las den achten Psalm in der Buber'schen Fassung: "DU, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in allem Erdreich! // Du, dessen Hehre der Wettgesang gilt über den Himmel hin, aus der Kinder, der Säuglinge Mund hast du eine Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, zu verabschieden Feind und Rachgierigen. // Wenn ich ansehe deinen Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du hast gefestet, was ist das Menschlein, dass du sein gedenkst, der Adamssohn, dass du zuordnest ihm! // Liessest ihm ein Geringes nur mangeln, göttlich zu sein, kröntest ihn mit Ehre und Glanz, hiessest ihn walten der Werke deiner Hände. Alles setztest du ihm zu Füssen, Schafe und Rinder allsamt und auch das Getier des Feldes, den Vogel des Himmels und die Fische des Meers, was die Pfade der Meere durchwandert. // DU, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in allem Erdland!" Er las den Psalm dreimal und schrieb seine Version auf ein Blatt Papier:
Herr! Du stehst über den Regierenden der Völker, über den Richtern, die sich mit dem Recht vertun, weil sie dem Besitz mehr zusprechen als den Kindern, die mit Wasserbäuchen dastehn und vergebens hoffen.
Herr! Der Du dem Leben den Tag gibst und wieder nimmst, der Du zusammenbindest, verwebst und auseinanderlöst und das von einer menschlichen Ewigkeit zur andern tust, das ist's, was deinen Namen weit über den Verstand erhöht.
Darum singen Dir Völker die Ehre im Wettgesang zu, der aufstieg wie der Adler mit kraftvollen Schwingen, als Du noch mächtig aus den Mündern der Kinder sprachst, aus der Zartheit der Säuglinge deine Macht grandest, die wilde Bosheit der Menschen in Schranken verklemmst, die Rachsüchtigen und Folterer als Feinde auslöschst.
Ich staune trauernd deiner Grösse unter dem Himmel nach, die auch jetzt unfassbar ist, wo ich dich brauche in meiner Not. Ich möchte dich berühren und kann deine Sterne nicht zählen, ich fühle mich verstampft und bin zu klein vor dir geblieben, als dass du meiner Wenigkeit noch gedenken müsstest, mich in meiner Erbärmlichkeit dem Adamssohn zuzuordnen.
Stimmt es, dass Du den Menschen Dir ähnlich machtest, ihm den Glanz des Lichts und die Krone der Ehre gibst, ihm die Schöpfung deiner Werke zu verwalten anvertraust? Als Du den Menschen in deine Schöpfung setztest, warum hast Du ihm nicht gezeigt, wie und wohin er gehen soll?
Du siehst, dass er weder standfest ist noch richtig gehen kann, dass er die Entscheidung umflieht, das Richtige zu tun, Du siehst, wie er sich in der Taubheit schwertut, dass den Kindern das Wasser in den Bäuchen steht, die da vergebens hoffen.
Herr, Du siehst, wie Menschen deine Werke verachten und treten, und siehst auch, wie sie Unschuldige foltern und morden. Stimmt es, dass Du den Folterern und ihren Opfern die Krone der Ehre gleichermassen aufsetzt?
Herr, wo ist dein grosser Name geblieben, wo dein Heiligtum hingeraten, wenn Menschen das Verwerflichste mit deinem Namen tun?!
Dr. Ferdinand legte das Blatt zurück, stellte die Tasse in die Küche, zog sich aus, putzte die Zähne und legte sich ins Bett. Vor seinen Augen richtete sich das Totenmonument im Wüstenfeld auf, das höher und immer höher wurde und seine Spitze mit dem vertrockneten Blut in den Nachthimmel steckte, wo das Ende nicht mehr zu sehen war. Er bat um Gnade für die Menschen, die es nicht mehr schafften, weil ihnen die Last zu schwer geworden war, die ganz unten am Monument standen, sich legten und sich dem Monument unterschieben liessen, dass die Spitze immer tiefer in den Himmel stach. Dabei verrutschten die Sterne, die diesem Monument nichts entgegenzusetzen hatten: "Wo ist dein grosser Name geblieben, wo dein Heiligtum hingeraten?"