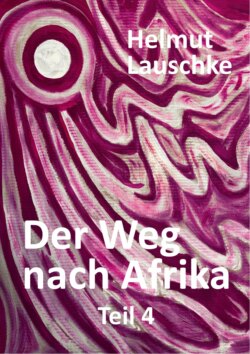Читать книгу Der Weg nach Afrika - Teil4 - Helmut Lauschke - Страница 6
Die Last des Alleinseins
ОглавлениеDie Nacht war ruhig, die Hähne krähten den Sonntag ein, nicht anders, als sie es an den Wochentagen taten. Die Sonne schickte feuerrote Strahlen in den frühen Morgen, als gäben sie die Antwort auf die letzte Frage nach dem Ort des grossen Namens und des Heiligtums, was beides nicht von dieser Welt sein konnte und am Nachthimmel im Gewirr der Sterne nicht mehr auszumachen war. Die ersten Strahlen zeigten, wie es die letzten Strahlen des vergangenen Tages auf der anderen Seite taten, hinter dem Horizont auf die Quelle ihres Lichts. Man konnte die Uhr und den Winkel im Erdlauf durch die Jahreszeiten mit der Sekundenverschiebung stellen, wenn auch nur diesseits des Horizonts. Was dann jenseits war, das blieb dem Auge ganz und nicht viel weniger dem Verstand verborgen, je höher er den Horizont setzte, wo dann die Vernunft kommen musste, um dem Nachgrübeln über die unsichtbaren Dinge ein Ende zu machen. Er hörte das sonntägliche Bimmeln des Glöckchens vom Türmchen der weiss gestrichenen Burenkirche, wenig später die noch verbliebene Burengemeinde mit ihrem Gesang der tonalen Entgleisungen. Dem Gesang fehlte die Fülle der Herzen. Die verbliebenen Stimmen waren unsicher und schüttern, fragend und zweifelnd. Da musste ein Machtwort gesprochen werden ganz ohne Zweifel, um die Restgemeinde auf die Füsse zu stellen. So war es denn auch still, wo der Dominee zum rechten Wort gefordert war, die Reparaturarbeit an den Seelen vorzunehmen, sich mit aller Kraft für den inneren Wiederaufbau einzusetzen und mit der Wortfestigkeit des Reformators die Füsse auf den Boden der Gemeinde zurückzubringen.
Dr. Ferdinand nahm den Telefonhörer ab, doch am andern Ende blieb es totenstill. Er stellte sich unter die Brause und wusch das Klebrige der Nacht mit der aufgesetzten Schicht des vergangenen Tages von der Haut. Er wollte frisch sein, um sich der Herausforderung des Sonntags zu stellen, der ihm, wie die meisten Sonntage, die Last des Alleinseins aufdrückte. Er zog sich frische Sachen an, stopfte das verschwitzte Alte in die halbautomatische Waschmaschine und stellte sie an. Er machte sich einen stärkeren Kaffee, um stärker wach zu sein. So tat er statt zwei drei Teelöffel Instantkaffee mit der Chicoreeverstärkung in die Tasse, goss kochendes Wasser darüber bis zum obersten Rand und verkleckerte einen Teil beim Einrühren des Zuckers von zwei gehäuften Teelöffeln. Er genoss den Morgenkaffee zusammen mit der Zigarette und versuchte über etwas nachzudenken, was mit dem Hospital nichts zu tun hatte. Da fiel ihm aber kaum was ein, nein, es fiel ihm überhaupt nichts ein. So nahm er sich das Blatt der vergangenen Nacht vom Verandatisch und versuchte beim Überfliegen des Geschriebenen sich an irgend etwas festzuhalten. Man kann einfach nicht aus dieser Welt entfliehen, das stiess ihm beim ersten Überfliegen auf. So überflog er das Blatt einige Male von oben nach unten, von unten nach oben, von der Mitte nach oben und unten und hielt das Blatt hoch gegen das Licht, ob er dahinter noch etwas finden konnte. Natürlich konnte er dahinter nichts finden, und so stellte er betroffen fest, dass er beim kreuz und queren Überfliegen und Dahinterschauen des Geschriebenen eben alles andere, aber kein Überflieger war. Er hätte eher ein Taucher sein können, der sich in den Wasserbäuchen der Kinder festgetaucht hatte, weshalb es für ihn schwer war, von dieser Art des Tauchens loszukommen und wie ein Bergsteiger Höhen zu erklettern, oder auf halber Höhe zumindest ein Gelände zu erreichen, wo es kein Wasser in den Bäuchen gab. Er konnte eben nicht wertfrei denken, ein Manko, das ihm den Denkweg zu den Gipfeln der Philosophie versperrte und ihm selbst den Zugang zu den höheren Etagen der Philosophieschulen verwehren würde.
So dachte er wasserbäuchig, bezugsorientiert nach, ob er dem Herrn, dem er in der vergangenen Nacht einen Brief geschrieben hatte, nachdem ihn Martin Buber durch seinen achten Psalm dazu ermuntert, ja aufgeregt hatte, einen Vorwurf machen sollte, dass er nicht mehr so mächtig aus den Mündern der Kinder spricht, wie er es einst getan hatte, weil es eben die Kinder mit den Wasserbäuchen gibt, die hilflos dastanden, mit grossen Augen nach oben blickten und vergebens hofften. Auch wenn sie es nicht sagen konnten, sie hofften auf ihn. Warum dann vergebens? Der andere Punkt war die ewige Folterei, als könnten die Menschen ohne die Folter nicht leben, als seien sie folterabhängig und foltersüchtig, wie Menschen von Nikotin, Alkohol und anderen Drogen abhängig, ja süchtig danach sind. Nur ist die Folterabhängigkeit und die Sucht des Folterns die grässlichste Art der Abhängigkeiten und Suchten, weil das Verspannen des Menschen in der Folter nicht nur fürchterlich weh tut, sondern dem Opfer da der Stolz gebrochen und dem Folterer da die Würde genommen wird, und beides auf Lebenszeit, weil die menschenwiderwärtige Schändung beide betrifft, den Geschändeten und die Vergewaltigte mit dem Zusammenbruch des Stolzes, den Schänder und Vergewaltiger durch den Verlust der Würde. Da fragte Dr. Ferdinand den Herrn, ob er die Krone der Ehre dem Schänder wie dem Geschändeten gleichermassen aufgesetzt habe und weiter aufsetzt. Er fragte ihn am Schluss seines Briefes, wo denn sein grosser Name geblieben, wo sein Heiligtum hingeraten sei, wenn Menschen das Verwerflichste mit seinem Namen tun.
Die Frage, ob es nötig ist, dass es Kinder mit Wasserbäuchen und dünnen, faltigen Hälsen gibt, die mit grossen Augen blicken und dennoch vergebens hoffen, und die Tatsache der anhaltenden Folterei, diese beiden Punkte wollte er in die Vorlage einbringen, aus der er dem Herrn den Vorwurf des Schweigens machen will. Deshalb den Schweigevorwurf, weil er den Herrn für mächtiger als die Menschen hält und sich nicht vorstellen wollte, dass der Herr diesem Wahnsinn zustimmt, wie es die Menschen tun, die da schweigen, und die so etwas Abscheuliches und Untierisches zur totalen Erniedrigung des Menschen erfunden haben, oder sich dieses schmerzlich traurige Schauspiel der Wesen mit der aufgesetzten Krone der Ehre ansehen, ohne ein Wort dazu zu sagen, anstatt mit seinem Schwert da einmal mächtig reinzuschlagen und mit den Untieren ein und für alle Mal aufzuräumen. Er sass mit der zweiten Tasse Kaffee und der zweiten Zigarette da und dachte über seinen Nachtbrief an den Herrn nach, ob er in dem Brief unhöflich oder gar ungezogen gewesen war. Das wollte er nicht, denn dafür war ihm der Herr zu gross und teuer. Es waren die nackten Tatsachen, denen er zur Verdeutlichung kein falsches Kostüm überhängen wollte, um da nichts zu vertuschen, weil erst die Tatsachen in ihrer Nacktheit die Wahrheit voll ans Licht bringen und das Unvorstellbare der Schändung zeigen, wo nackt nichts zu vertuschen ist. Er bat um Verständnis, dass sein Brief den Tatsachen entsprach und nicht übertrieben war, dass er ihn in seiner Muttersprache verfasste, weil er es anders nicht konnte, und dass das Geschriebene so wahr war, wie das Nacktsein nackt sein konnte. Er bat den Herrn, dem täglich sicherlich unzählige Notrufe und -briefe zugingen, den Brief zu lesen (und nicht den Notrufbeanworter laufen zu lassen). Der Absender stellte sich auf eine Wartezeit ein, da sich der Herr noch nie zu einer niedrigen Eile herabgelassen hatte und sich die nackten Tatsachen gründlich durch den Kopf gehen lassen sollte. Der Breifschreiber hoffte, dass sein Brief nicht unterwegs verlorenging, was hier auf dem Postwege kleiner Entfernungen häufig der Fall war. Der Brief an den Herrn hatte einen weiten Weg zurückzulegen. Er hätte den Brief aus Sicherheitsgründen per e-mail an: notruf@herr.halleluja.com.na schicken können, was auch schneller gegangen wäre, was er aber nicht tat, weil der Brief handgeschrieben sein sollte mit seiner persönlichen Unterschrift, dem er dann noch zwei Zeichnungen hinzugefügt hatte, eine von einem dreijährigen Jungen mit einem extrem ausladenden Wasserbauch auf ganz dünnen Stöckchenbeinen und die andere von einer Folterszene, wo drei Männer mit Peitschen auf eine junge Frau mit entblösstem Körper einschlugen, sie dann alle drei vergewaltigten und schliesslich erschlugen, weil sie nicht reden wollte, um ihren Mann bei der Feldarbeit nicht zu gefährden.
Den Brief mit den beiden Zeichnungen per Luftpost und eingeschrieben zu schicken, da machte das Postamt nicht mit, weil der Absender die Postfachnummer nicht auf dem Briefumschlag angegeben hatte und der Umschlag viel zu klein war, um die erforderlichen Briefmarken aufzukleben. Selbst mit einem grösseren Umschlag und Angabe der Postfachnummer hätte es die Post nicht getan, die sich für diese Art der Fernzustellung für nicht zuständig erklärte, weil sie Luftpostbriefe soweit hoch nicht beförderte, die über die Ionosphäre hinausgingen, auch wenn sie eingeschrieben waren. Da war die Technik eben noch weit zurück, dachte Dr. Ferdinand, der da eine Marktlücke sah, wo die Post bei der Grosszahl der Briefe an den Herrn allein durch den Verkauf der Briefmarken (mit den jeweiligen, ernst dreinblickenden Präsidentenköpfen) ein gutes Geschäft machen könnte.
Dr. Ferdinand machte einen kurzen Rundgang durchs Dorf, ging an den bewohnten Häusern mit den gepflegten Vorgärten und den leerstehenden Häusern mit den verkommenen Vorgärten vorbei, sah Männer in den Einfahrten ihre Autos polieren, andere unter geöffneten Motorhauben vornüber gebeugt stehen, die da mit Schlüsseln hantierten und mit Lappen wischten, sah Hunde vor den Autos und vor Hauseingängen liegen, hörte laute und leise Stimmen aus den Häusern kommen und roch den scharf gewürzten Dunst sonntäglicher Braten. So waren die Strassen, wie an jedem Sonntag, so gut wie menschenleer, auf die die Sonne brannte. Auch in den Militärcamps war es still, wo sich ausser den Wachhabenden an den Einfahrten nichts zu bewegen schien. So beendete Dr. Ferdinand seinen Rundgang, der keine Stunde dauerte, streifte die Sandalen in der Veranda ab und machte sich in der Küche eine Tasse Kaffee, zu der er zwei Scheiben Brot mit Orangenmarmelade ass. Dann prüfte er das Telefon aufs Lebenszeichen, das es noch nicht tat, und zündete sich eine Zigarette an, um die Ruhe zu geniessen, ohne an die verdammte Einsamkeit denken zu müssen. Da holte er sich die grossen Philosophen zu Rate und las bei Plotin (205-270 AD) weiter: "Der Geist ist etwas Anderes als das Denkvermögen im Menschen. Denn der Geist lässt die Denkakte zu einer Bewegung in der Seele auseinandertreten, die erkennt. Da der Geist die Ursache dieser Erkenntnis ist, kann man den Geist gleichsam sinnlich greifbar sehen, wie er über der Seele als ihr Vater thront. Es ist der Kosmos des Geistes, der sich "stillstehend", unerschütterlich bewegt. Der Geist trägt alles in sich, und jedes Teil in ihm ist alles, jedes Einzelne ist das Ganze. Der Geist ist nicht geschieden, wie die Gedanken voneinander geschieden sind. Die Teile des Geistes verfliessen nicht ineinander, wie die Gedanken ineinander verfliessen."
Da kam es ihm durch den Gedankentrichter, dass es der Geist war, der sich ständig bewegt (Perpetuum mobile) und sich nicht gönnt, als ruhende Einheit zu existieren, weil er dem jedesmal Anderssein offen ist. Wo der Geist das Denken berührt, beginnen die Gedanken zu fliessen (Heraklit: 'panta rhei'), während der Geist als Ursprung vielgestaltig, ‘ozeanisch’ bleibt. Von diesem Ursprung in seiner Omnipotenz leitet sich die Gedankenkette ab, deren Ende zum Abbild führt, das die Gedankengestalt annimmt und sich in der Form verfestigt, wenn der Geist (aus dem Ursprung der Vielgestaltigkeit) im Abbild gerinnt. Da lässt sich die ausgeformte Gestalt durch den Verstand und die Hände begreifen. Die Geburt des Abbilds wird mit der geistigen Gerinnung abgeschlossen. Nach Abschluss der physischen Gestaltung verharrt der zeugende Geist in seiner Unbegreiflichkeit, um mit seiner ungeheueren Kraft Ursprung neuer Abbilder und Gedankenketten zu sein. Doch bewahrt der Schöpfergeist die Verbindung zum Abbild und seinen Formen, schwebt quasi durch seine "stillstehende", unerschütterliche Bewegung (wie es einige Insekten beim Stehen in der Luft tun, die mal hier, mal dort und wieder anderswo stehn) über und um das Abbild herum, durchdringt es und gibt ihm die Atmung zum Leben. Die Aura der Geistigkeit umhüllt das Abbild, die beim Menschen zu seiner Persönlichkeit führt, die geistig ausstrahlt und den Augenblick hellsichtig macht. Das Schweben des Geistes über dem Abbild und seine geistige Durchdringung kann der Verstand nicht begreifen. Ihm bleibt es untersagt, den Geist in seiner Zeugungskraft zu sehen und zu messen. Was der Verstand kann, ist, sich an der Form, in der sich der Geist festgeronnen hat, also am Abbild selbst zu begreifen. In der Begriffsbildung, die durch das Abbild vorgegeben, festgelegt und verständlich ist, können sich die Gedanken auf die Schöpfung hin orientieren. Das ist ein grosses, ein unfassbares Wagnis, das sich dann lohnt, wenn der Ursprung des Seins nicht aus dem denkenden Auge verloren wird. So kommen immer neue Gedanken, die kräftig, schöpferisch sein können und das Wunder der Geburt und des Geborenen in seiner Kompaktheit ahnend durchschimmern lassen. Denn im Geborenen hat sich der Geist verdichtet, der den einsehbaren und messbaren Strukturen bis in die feinste Faser hinein die Fähigkeit und den Willen zum Leben eingehaucht hat.
Am geistgeronnenen Abbild in seiner verfestigten Form kann der Verstand sehen, messen und begreifen, dass es nach oben hin offenbleibt, weil der Geist im Ursprung noch vieles auf Lager hat, das er zur Geburt bringen kann, wenn ihn erst ein schöpferischer Gedanke berührt. So ist und durchwandert der Geist in unbegreiflicher Weise das Leben des Menschen und ganzer Völker. Der zeitlose Geist, weil er überzeitlich ist, überlässt es den Zeitgeistern, wie es der Vater seinen Kindern überlässt, in welcher Kleidung (Sprache, Musik, Kindergarten, Universität, Politik, Wissenschaft und Kunst) sie die Menschen und ihre Völker auf die Bühne der Welt treten lassen, um mit- und untereinander zu leben. Da zündete sich Dr. Ferdinand eine Zigarette an, weil er unruhig wurde, als er sich die Menschen hier in ihrer schäbigen Bekleidung und die nackten Kinder mit den ausufernden Wasserbäuchen auf den stelzigen Beinen vor die Augen stellte. Im Anblick dieser Erbärmlichkeit der runtergekommenen und entstellten, menschlichen Gestalten, die ja traurige Abbilder dieser Zeit sind, fragte er den schwebenden Zeitgeist, ob er da nicht ganz bei Troste war. Er konnte sich bei diesem Anblick nicht vorstellen, dass der Zeitgeist selbst soweit runtergekommen war, um diese Schäbigkeit am Menschen gewollt zu haben, mit anderen Worten, dass sich der Zeitgeist selbst in diesen Menschen zu solcher Schäbigkeit verronnen hatte. Er war erregt und schimpfte gegen die Zimmerdecke, rief dem Zeitsohn des Geistes, der um das Datum nicht herumkam, zu, dass er seine Augen öffnen solle, um zu sehen, was da aus ihm herauskam.
So war Dr. Ferdinand wieder drauf und dran, in die Wasserbäuche der Kinder ‘abzutauchen’. Der einfache Menschenverstand konnte es nicht begreifen, dass in den Kinderbäuchen das Wasser stieg, während es draussen kaum Wasser gab, da viele Brunnen ausgetrocknet waren. Was bildete sich der Zeitgeist ein, um sich in solche traurigen Abbilder zu vergehen? Wenn es so etwas wie eine Pathologie des Zeitgeistes gab, dann wäre das ein Forschungsgebiet von grosser Bedeutung, um da einmal bei den geistigen Ursprüngen nachzuhaken, die zu den gestaltlichen Verformungen und Vergehen führen, die in der geistgeronnenen Substanz krank sind und als Abbild zutiefst erschrecken. Das Dilemma ist da: die Menschen können nicht mehr richtig leben. Sie atmen verklemmt, schlucken die Luft in den Magen und ernähren sich falsch. Da ist nichts mehr sauber, auch nicht das Wasser, das sie trinken. Da kann es auch kein richtiges Zusammenleben geben, weil die Voraussetzungen nicht da sind, es an der einfachsten Ordnung und Sauberkeit fehlt. Es war die Frage nach der Hygiene, die er nach oben an den Zeitgeist richtete, der es zur Verschmutzung kommen liess, die sich in den Köpfen der Schänder und Folterer, der Fresssäcke und Schweiger festgesetzt hatte, wo der Schmutz mit den Minen, dem Unrat und den Toten über verwüsteten Dörfern und Feldern liegt. Es waren die Gefolterten und Vergewaltigten, die Arm- und Beinamputierten, die mit den zerschlagenen Gesichtern, den ausgestochenen und weggeschossenen Augen, die Kinder mit den Wasserbäuchen und die vielen anderen Kinder, die ohne Eltern leben müssen, die diese Verschmutzung beklagen. Sie weinen und schreien, weil sie es anders nicht ertragen. Die Pathologie des Zeitgeistes, ein Gebiet, das dem Zeitgeist entspricht (der nach dem 'Urgeist' vielgestaltig ist, also auch entarten kann), da sollte einmal gründlich nachgeforscht und gelehrt werden. Diese Pathologie gehört in die Universitäten, wenn sie die Kapazität für Lehre und Forschung noch haben und für die Zukunft der Menschheit etwas Vernünftiges beitragen wollen. Der Mensch muss sich etwas einfallen lassen, um die Hygiene ins Denken und Handeln zurückzubringen. Da können die Erkenntnisse auf dem Gebiet der Pathologie des Zeitgeistes hilfreich sein, wenn nur ernsthaft in den Zeitgeist eingedrungen und auf dem Gebiet der traurigen Abbilder und der flächendeckenden Verarmung und Verschmutzung geforscht würde. Am Geist setzt die Innovation an. Da sollte man sich nicht bei der akademischen Vorrede und Beschreibung der schmutzigen Dinge aufhalten, was jeder sieht, der die Augen offenhält. Man muss den Dingen auf den Grund gehen, um die traurigen Abbilder und die allgemeine Verschmutzung in ihren Zusammenhängen bis zum zeitgeistigen Ursprung zu verstehen. Der Zeitgeist ist krank, der in solchen abstossenden und widerwärtigen Formen festgeronnen ist. Da muss der Zeitgeist unter die Lupe genommen werden, um herauszufinden, warum er krank ist. Die blosse Beschreibung der Symptome hilft da nicht weiter. Es muss an den geistigen Ursprung herangegangen werden, wofür die Augen weit offen sein müssen, um das Denken frei von alten, verbrauchten Schemata zu halten. Das krankhaft Geronnene und das Feste der Krankheit müssen dorthin zurückverfolgt werden, wo alles begann, der Geist noch "flüssig" war und das Kranke gerade erst in die Form gegossen wurde. Der Mensch kann doch nicht so dumm sein, um sich beim grossen Dilemma, das sich immer weiter ausbreitet, zu schweigen, sich totzuschweigen. Fürs Schweigen steckt der Karren viel zu tief im Dreck, und Tote ohne Begräbnis (Sartre), die gab es übergenug.
So kann es nicht weitergehn, wenn dem Menschen am Leben und Zusammenleben noch etwas liegt. Es muss noch Menschen geben, die das begreifen, die noch sauber im Denken sind und mit diesem Denken am Überleben der Menschen arbeiten wollen. Die Menschheit soll es ihnen einmal danken, und besonders die armen Kinder. Da kann auch mal ein Vorschlag aus menschlicher Sicht kommen, der dem Zeitgeist weiterhelfen würde, der dann wieder schöne Abbilder mit gesunden Kindern und sauber denkenden Erwachsenen in die Welt bringt, wo der gestaltende Geist einen Menschen schafft, der wieder schön ist. Dr. Ferdinand hatte es sich versagt, die Kirchen und ihre zweitausendjährige Leistung für die Menschheit ins Kalkül zu ziehen, weil da ausser Lippenbekenntnissen, die sich nicht erfüllten, und einigen Mehlsäcken zu wenig kam, was den armen Menschen in ihrem Elend vor der angolanischen Grenze weiterhelfen würde.
Es war Montag. Die Vorhänge wurden für die Morgenbesprechung vor den Fenstern zurückgezogen. Dr. Ferdinand sah auf den alten Baum mit den langen Aststümpfen, die höher als der Raum waren und zum Raum hin ragten. Da kamen ihm die Arm- und Beinstümpfe in den Sinn, die er geschnitten hatte, weil es nicht anders ging, wo ihm jeder Stumpf ins Auge ‘stach’. Er dachte an das zehnjährige Mädchen, dem er wegen einer bösartigen Knochengeschwulst den rechten Arm abschnitt, um ihr das Leben zu retten oder zumindest zu verlängern. Er dachte an die vielen Kinder, die von einer Mine angerissen wurden, denen er Teile beider Arme, oder Arm und Bein, oder beide Beine vom Körper abtrennte, weil es auch da nicht anders zu machen war. Betroffene Stille lag über den Köpfen, nicht nur, weil es die Klimaanlage nicht tat, die endlich ihr schlagendes Rattern liess, sondern weil da am Freitag der vorangegangenen Woche Fürchterliches passierte, was mit dem Verstand nicht zu fassen war. Da sassen die Teilnehmer aufrecht auf den harten und den gepolsterten Stühlen, keiner lehnte sich bequem zurück, auch nicht der amtierende Superintendent, dem die Hochnäsigkeit vergangen war und der nun noch kürzer auf dem Drehsessel hinter dem Schreibtisch sass. Allen hatte es die Gesichter getroffen, keiner wagte ein vorlautes Wort. Er eröffnete die Besprechung und fand gemässigte Worte für die tiefe Trauer der Menschen und Kinder, die durch die Explosion, die die ganze Bank in die Luft sprengte, Menschen verloren hatten, die durch ihre Arbeit die Brotgeber der Familien waren. Er konnte vielleicht tiefer gefühlte Worte zur entsetzlichen Tragik finden, etwas menschlicher sprechen, aber viel konnte er nicht sagen, denn die Tatsache mit den vielen Toten und Verletzten war nicht umkehrbar.
Die Hintergründe des abscheulichen Attentats waren nicht erkennbar. Zwar hatte jeder seinen Verdacht, doch den behielt jeder für sich, weil es in der Phase der letzten Entscheidungsschlacht gefährlich sein konnte, den Verdacht auszusprechen. Es hatte sich herumgesprochen, dass Männer der schwarzen Haut eine Kiste in der Bank abgestellt hätten, was im Menschengedränge nicht beachtet wurde, doch daraus auf die Swapo zu schliessen, wie es einige Weisse im Sinn hatten, war einäugig, weil das zweite Auge sah, dass es schwarze Männer auch bei der Koevoet und beim südafrikanischen Militär gab. (Später, als das Anlegemanöver abgeschlossen war, und die schwarze Besatzung die Hebel der Macht fest in ihren Händen hielt, da wurde noch einmal in die Banksprengung und die Trümmer der Barclay's Bank hineingeleuchtet. Da ergab sich ein anderes Bild, wo die Spektralfarben beim Lichteinfall aufs Trümmerfeld, das über die Jahre so geblieben war, wie es der schwarze Freitag hinterlassen hatte, sehr nah an das neue, politische Spektrum heranreichten. Bei unvoreingenommener Lupenbetrachtung war auch da eine gewisse Einäugigkeit nicht abzusprechen. Das neue Licht war nicht flackerfrei, hatte zuwenig Weiss im Spektrum. Auch sah das eine, andere Auge ohne Lupe mehr, als zwei Augen zusammen durch die Vergrösserungsbrille sahen.) Jedenfalls hatte das Ereignis einen tiefen Krater ins letzte Wegstück zur Unabhängigkeit Namibias gerissen. Die Menschen trauten einander nicht über den Weg. Es gehörte zur südafrikanischen Strategie, Männer, der Koevoet (Brecheisen) in Swapo-PLAN-fighter Uniformen zu stecken, um die Bevölkerung auszuhorchen, an Informationen zu kommen, an die sie in den andern Uniformen nicht herankamen, weder im guten noch durch Folter. Die Strategie der vertauschten Kleider hatte die Menschen im höchsten Masse verunsichert, das Misstrauen geschürt, die Ratlosigkeit zur Verzweiflung gebracht und das Chaos komplett gemacht. Die Telefonleitungen waren unterbrochen, der amtierende Superintendent konnte nicht sagen, wann die Reparaturarbeiten am Hauptkabel abgeschlossen sein würden. Der operative Bereich des Hospitals war lahmgelegt. Die Besprechung beschränkte sich auf den schwarzen Freitag und seine Folgen, ein Themenkomplex, der schwer war und am Ende ungelöst blieb. Die Op-Liste, die an der verstochenen Korktafel im 'theatre' mit einer Reisszwecke angeheftet war, blieb für den nächsten Tag hängen. Dr. Ferdinand und der philippinische Kollege machten eine ausführliche Saalrunde. Sie gingen von Bett zu Bett, inspizierten die Wunden, entfernten Fäden, wenn es an der Zeit war, lösten Verbände und legten neue an, trugen ihre Befunde in die Krankenblätter ein.
Die Schwestern trauerten um Menschen, die bei der Explosion ums Leben gekommen waren, zeigten Mitleid mit den Hinterbliebenen, unter denen es viele Kinder gab. Sie bedauerten die Verletzten, die durch die Explosion verstümmelt wurden. Sie zeigten Stärke in der Arbeit, ohne ihre Gefühle den Patienten anmerken zu lassen, die es dennoch spürten. Den Verletzten ging es besser, das Leben drohte bei ihnen nicht mehr zu kippen. Sie taten sich schwer zu begreifen, dass ihnen das in der Bank passieren konnte. Da sagten die andern Patienten nichts und nahmen die Stümpfe klaglos hin, denn es hätte auch ihnen schlimmer kommen können. Im Kindersaal war es der zweijährige Junge, der seine linke Hand Dr. Ferdinand entgegenhielt, an der die zusammengewachsenen Finger vor einer Woche getrennt wurden. Der Engel der Schwestern löste in Engelsgeduld die Verbände von den Fingern. Der Junge sah glücklich in seine Hand, als er die Finger einzeln bewegte. Da dachte Dr. Ferdinand an das kleine Mädchen, das ihn anstrahlte, als es nach der Operation die Finger der rechten Hand bewegte. Im Bett, in dem vor drei Monaten das zehnjährige Mädchen lag, dem er wegen der bösartigen Knochengeschwulst den rechten Arm abtrennen musste, lag nun ein neunjähriges, dem er wegen eines Klumpfusses die Achillessehne verlängert hatte. Der Unterschenkel war noch im Gipsverband, der den Fuss in der notwendigen Stellung hielt. Das Mädchen war zufrieden und steckte sich mit den rechten Fingern den Mahangupapp in den Mund. Die Geschicklichkeit, mit der es den Papp zwischen die Finger nahm, verriet die tägliche Übung. Dr. Ferdinand hatte das zehnjährige Mädchen mit dem traurigen Blick vor Augen, das sich beim Pappessen bekleckerte, weil es das Greifen mit den linken Fingern noch lernen musste. Sarah lag auf der Intensivstation im ersten Raum mit verquollenem Gesicht. Sie konnte die Augen noch nicht öffnen. Der verbundene Oberkörper lag hoch, um der Gesichtsabschwellung nachzuhelfen. Der Oberschenkelstumpf lag unter einem 'Bahnhof', damit er vor jeglicher Fremdberührung verschont wurde. Sie lag an der Blutkonserve und klagte über Schmerzen, gegen die sie die Spritze in regelmässigen Abständen bekam. Die Körpertemperatur war erhöht aufgrund der verbrannten Haut. Die Antibiotika wurden ihr mit der Infusion gegeben. Sie sog den kalten Tee aus der Tasse durch einen Plastikhalm in den Mund, den sie zum Essen nicht öffnen konnte. Dr. Ferdinand wusste durch die Schwestern, wer Sarah war, aber wiedererkennen konnte er sie nicht.
Eine Teepause gab es, doch keinen Tee, da es kein kochendes Wasser gab. Sie setzten sich in den verdunkelten Teeraum, in den das Tageslicht durch die kleine Durchreiche und die offene Tür aus dem Unkleideraum kam. Die beiden Narkoseärztinnen sassen schon da und schwiegen in das Halbdunkel des Raumes. So tat es der philippinische Kollege auch. Alle sassen da wie bestellt und nicht abgeholt, und jeder ging seinen eigenen Gedanken nach. Da heulten die Sirenen über dem Dorfe auf. Sie heulten in drei Wellen. Dr. Lizette sagte das "ag nee!" (ach nein!) schon in einer routinierten Weise. Wenig später böllerten die Haubitzen, und die dumpfen Einschläge der Granaten irgendwo im Felde waren zu hören, die wenige Sekunden nach jedem Abschuss folgten. Im Teeraum entschärfte Dr. Christine die Situation treffsicher mit der Bemerkung, dass es an diesem Morgen weder Kaffee noch Tee gäbe. Dann ging doch eine Granate nicht soweit vom Hospital nieder, deren Einschlag die Wände erzittern liess. Dr. Lizette wiederholte ihr "ag nee!" lauter und mit ernstem Gesicht. Dr. Ferdinand dachte an den schwarzen Freitag und seine Folgen und sagte, dass alles seine Folgen hat. "Wenn jetzt Verletzte kommen, können wir nichts machen", sagte Dr. Lizette, und der philippinische Kollege schaute ihr sprachlos ins Gesicht, weil er da offenbar auch an seine Familie dachte. Da der Einschlag in der Nähe sich von den Haubitzeneinschlägen im Felde.durch die längere Detonationsdauer unterschied, war es für Dr. Ferdinand nicht klar, ob da nicht die Swapo im Gefecht stand und ihren Gürtel schnallte.
Der Weg in das Namibia von morgen wurde mit Granaten freigeschossen, den beide Seiten mit riesigen Löchern vertrichterten und unpassierbar machten, dass es schwer war sich vorzustellen, welchen Weg die neue Mannschaft antreten würde, wenn die alte erstmal verschwunden war. Es gab so gut wie keinen Zweifel mehr, dass da ein Weg gefunden wird, der von Norden aus über die angolanische Grenze führt. Die südafrikanische Armee zog ihre schweren Waffen aus dem Süden Angolas zurück. Dr. Jonas Savimbi füllte diese Lücke mit seinen Truppen (UNITA - União Nacional da Independencia Total de Angola), die amerikanisch und südafrikanisch ausgerüstet waren, denen von Norden die Truppen des Präsidenten Eduardos dos Santas (MPLA - Movimento Popular de Libertação de Angola) und die Kampfeinheiten der Swapo (South-West Africa People’s Organisation) entgegentraten, die mit sowjetischen Waffen und ostdeutschem Gerät ausgerüstet waren und von MIG's mit kubanischen Piloten aus der Luft unterstützt wurden.
Dr. Ferdinand und sein philippinischer Kollege hatten ihre Stühle im Untersuchungsraum 4 eingenommen und begannen mit der Durchsicht der Patienten, die aus den umliegenden Kliniken geschickt und aus den weiter entfernten Hospitälern mit Fahrzeugen gebracht wurden. Ein Mann setzte einen achtjährigen Jungen auf den Schemel, dem beim Sturz vom Baum der rechte Unterschenkel gebrochen war. Da ein Röntgen ohne Strom nicht möglich war, ging Dr. Ferdinand mit den beiden in den Gipsraum, gab dem Jungen auf der Liege die Spritze für die Kurznarkose ins Gesäss und richtete die Fraktur nach klinischem Ermessen und Augenmass ein. Der Mann, der nicht der Vater des Jungen war, zog den Grosszeh des Fusses nach oben. Er sagte nichts, als er beim Anlegen des Gispverbandes einige Spritzer abbekam. Nach dem Manöver der Fraktureinrichtung und dem Gipsen waren beide Beine gleich lang, und die Grosszehen schauten gleichermassen nach oben. Dr. Ferdinand trug die Schmerztabletten in den Gesundheitspass ein, den er dem Mann zwischen den rechten Daumen und Zeigefinger schob, der den aufgewachten Jungen in den Armen hielt. Er sollte zur Röntgenkontrolle nach einigen Tagen wiederkommen, wenn es den Strom dafür gab. Da sass nun eine alte Frau auf dem Schemel, die sich den linken Unterarm nach einem Sturz gebrochen und das Gesicht geschürft hatte. Sie bekam die ambulante Behandlung ohne Röntgenbild und bedankte sich, als sie mit dem Gipsverband, der von der Hand bis zum Oberarm reichte, den Gipsraum verliess und den verknitterten Pass, auf dem der Name abgegriffen war, mit dem Eintrag der Schmerztabletten in der rechten Hand hielt. Der junge Mann hatte sich bei einem Schlag gegen den Bolzen den linken Ellenbogen verrenkt. Eine Fraktur war nicht zu tasten. So brachte Dr. Ferdinand den Ellenbogen ins Gelenk zurück und stellte ihn mit einem Gipsverband ruhig. Auch ihm wurde aufgegeben, zur Röntgenkontrolle zu erscheinen, wenn es der Strom wieder tat. Es waren noch andere Patienten mit Knochenbrüchen, die ohne Röntgenbild behandelt werden mussten. Dazwischen wurden Wunden gesäubert und genäht. Die steril in Nierenschalen verpackten Instrumente waren zwischenzeitlich ausgegangen, dass sie gesäubert und in eine Desinfektionslösung gelegt wurden, um sie weiter zu gebrauchen. So machte es der philippinische Kollege auch, denn eine Dampfsterilisation gab es ohne Strom auch nicht. So wurde an allen Ecken improvisiert, um unter den kriegsbedingten Umständen den Menschen zu helfen, soweit es eben ging.
Es war Mittagspause, und der Kollege ging pünktlich nach Hause, um seine Familie zu sehen, an die er während des Granateneinschlags dachte, als die Wände im halbdunklen Teeraum zitterten und er sprachlos Dr. Lizette anschaute, als sie mit ernstem Gesicht ihr "ag nee!" lauter wiederholte, das sie beim Aufheulen der Sirenen über dem Dorfe das erste Mal leiser sagte, und nun bedenklich hinzufügte: "Wenn jetzt Verletzte kommen, können wir nichts machen." Dr. Ferdinand bemerkte es und versuchte ihn zu beruhigen, als er sagte, dass da wohl nichts passiert sei, weil die Detonation so nah auch nicht war. Sie gingen ein kurzes Stück zusammen. Dem Kollegen war die Sorge auf dem Gesicht abzulesen, als er den Weg nach Hause antrat. Dr. Ferdinand ging zum Speiseraum, um zu sehen, ob es da etwas zu essen gab. Der Wärter im weissen Dress in der Teeküche stand hinter der Durchreiche und gab jedem zwei gekochte Eier auf den Teller, wozu der Gasherd gut war. Jeder konnte sich die Scheiben des geschmacklosen Brotes selbst nehmen. Zu trinken gab es Tee, für den das Wasser in einem grossen Topf auf der anderen Gasflamme kochte. So schlecht war es also nicht, es gab zu essen und zu trinken.
Dr. Ferdinand dachte beim Kappen des ersten Eis an die Patienten, wie die wohl über die stromlose Runde mit dem Essen kämen. Da halfen die Angehörigen aus, wenn Frauen und Mütter den Papp von zu Hause brachten. Die Genügsamkeit und Hilfsbereitschaft der einfachen Menschen waren sprichwörtlich und afrikanisch angeboren. Die Menschen bekamen diese Situation ohne unnötige Wort schnell in den Griff. Sie zeigten die Grösse in der Not und liessen keinen Zweifel daran aufkommen, dass das Leben weitergehen musste. Er sass noch eine Weile allein am runden Tisch, goss sich die zweite Tasse Tee ein und steckte sich eine Zigarette an. Er blickte durch die offenstehende Glastür über den kleinen, sandigen Platz zum Flachbau mit den kleinen Wohnstellen und den ockerfarbenen Asbestwänden und versuchte sich die Genügsamkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland vorzustellen. Da musste er bis in die letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre zurückgehen, wo es das auch gegeben hatte. Doch mit dem sogenannten Wirtschaftswunder waren diese Tugenden verkümmert. Der Gnom, der da zurückgeblieben war und sich nur vereinzelt und oft naseweiserisch blicken liess, konnte hier dem afrikanischen Riesen die Hand nicht reichen. Das Besitzdenken dort oberhalb des Äquators hatte die Menschen innerlich arm gemacht. Das Nordsüdgefälle galt für den äusseren Besitz, nicht aber für den inneren Verlust, wenn man bezüglich der inneren Werte eher von einem Nordsüdanstieg oder Südnordgefälle sprechen müsste. Er drückte die Zigarette auf der Untertasse aus, als der Wärter "ha!" rief und mit dem Zeigefinger auf den Kühlschrank wies, dessen Maschine wieder brummte. Er kam in den Speiseraum, um dort das Licht an- und wieder auszuknipsen. Er rief erfreut: "Kyk, nou he ons weer lig!" (schau, jetzt haben wir wieder Licht) und knipste zur Bestätigung den Lichtschalter wieder an und aus. So kehrte nach drei Tagen der Strom ins Hospital zurück, was für die Arbeit von grösster Bedeutung war. Dr. Ferdinand verliess den Speiseraum und ging mit dem Gefühl der Erleichterung zum 'Outpatient department' zurück, um dort die Arbeit an den Patienten fortzusetzen, die da geduldig auf den Bänken vor dem Untersuchungsraum 4 sassen und darauf warteten, gesehen zu werden.
Der philippinische Kollege kam mit entspanntem Gesicht zurück, weil sein Haus noch stand und die hausgemachte Kost in der Vollzähligkeit der Familie besonders gut geschmeckt hat. Er lächelte, als er seinen Stuhl am Tisch einnahm und mit der Arbeit begann. Die Arbeit wurde mit Elan getan, da hatte der Stromanschluss und das heile Haus des Kollegen die Gemüter belebt. Knochenbrüche wurden gerichtet, Fremdkörper entfernt, Abszesse gespalten; es wurde gegipst, genäht und wieder gegipst. Es lief wie am Schnürchen. Da brachte der Kollege ein ausgekugeltes Schultergelenk ohne Schwierigkeit in Ordnung, weil er den zweiten Handgriff der Kocher'schen Methode mit der Auswärtsdrehung und dem Anheben des angelegten, im Ellenbogen rechtwinklig gebeugten Armes bis zur frontalen Ebene beherrschte. Es machte dem Elan nichts aus, dass es mehr Patienten waren, von denen der letzte erst mit Eintritt der Dämmerung den Gipsraum verliess. Die Nachtschwester hatte seit über einer Stunde die Tagschwester abgelöst. Sie schob die Formulare auf dem Tisch zusammen und stapelte die Tüten mit den Röntgenbildern vom Nachmittag auf einen Stoss. Die Doktoren kratzten sich den Gips von den Fingernägeln und Hosen, wuschen die Hände und schlugen sie zum Trocknen durch die warme Luft. Es war ein erfolgreicher Montagnachmittag, an dem der Strom das Hospital wieder zum Leben erweckte. Sie wünschten einander eine ruhige Nacht. Der Kollege ging entspannt nach Hause zurück, und Dr. Ferdinand schaute noch einmal kurz in die Säle.
Die Nachtschwestern waren erleichtert, dass sie aufs Kerzenlicht nicht angewiesen waren, wie in den drei Nächten davor. Das Licht von der Decke machte ihnen Mut, die Nacht leichter durchzustehen. Beim Überqueren des Vorplatzes schaute er nach den Menschen, die auf dem Betonboden vor der Rezeption sassen, aus Blechschüsseln löffelten und Näpfen tranken, alte Frauen an Stummelpfeifen pafften, alte Männer an ihren krummen Stöcken rauf und runter griffen, und Mütter ihre Kinder stillten und in Tücher wickelten. Der Pförtner an der Ausfahrt schob hinter ihm das Tor zu und gab ihm den Nachtgruss durchs Gitter. Dr. Ferdinand nahm den kürzeren Weg zwischen Stacheldraht und zerfleddertem Lattenzaun, ging an den fünf hochgestelzten Blockhäusern vorbei, die leer standen, wo an einigen die Holzstiegen mit den fünf Trittbrettern schon fehlten. Die Sonne hatte sich hinter dem Horizont verabschiedet und zog das letzte Feuerrot aus dem Himmel zurück, als er das zerknitterte 'Permit'-Papier dem Wachhabenden an der Kontrollschranke vorhielt, der es sich ansah, obwohl er nichts sehen konnte und seine Taschenlampe in der Tasche stecken liess. Die streunenden Hunde waren wieder da, die mit waagerecht gehaltenen Schwänzen auf ihn zukamen, im Geradeausblick an ihm vorbeiliefen oder mit eingeklemmten Schwänzen vor ihm wegliefen. Die Fünferkolonne der 'Elands' mit den langen Rohren nahm die Linkskurve Richtung Dorfausgang, als er das Tor zuschob und den Riegel ins Schloss fallen liess. Die Sandalen mit den verschwitzten Korksohlen blieben in der Veranda. Er rieb den Schweiss von den Fusssohlen in den Sand und den Sand auf der Stufe ab, zog sich das klebrige Hemd vom Körper und machte sich in der Küche einen Rotbuschtee, den die Afrikaner 'rooibos' nennen. Mit Tee und Zigarette setzte er sich auf die Eingangsstufe und schaute dem Abend ins Gesicht.
Der zunehmende Halbmond stand schief am Himmel, nahm seinen Weg und schwieg sich aus, wie es die Sterne über ihm taten. Warum Mond und Sterne schwiegen, blieb ihm ein Rätsel, wo es soviel zu erzählen gab. Da knatterte in der Ferne ein MG, als wäre das des Rätsels Lösung. Er sah in das helle Halb des Mondes und ein Gnomengesicht, das ihn verlachte, weil er so naiv war, den Nachthimmel zum Sprechen zu bringen, wo es doch soviel mehr zu sehen gab. Ihn zu fragen, was am Tage auf der Erde ablief, das war absurd. So etwas Kleines fragt man nicht den Grossen. Er liess das Fragen sein und fuhr mit den Augen die Sternbilder ab, ob da etwas zu sehen war, was er noch nicht gesehen hatte. Die Lehre war, dass er jedesmal etwas Neues sehen konnte, wenn er die Augen nur weit genug aufmachte.
Drei Wochen waren fast vergangen, als die Zweierdelegation aus ärztlichem Direktor und dem Superintendenten aus Deutschland zurückkehrte. Sie kamen eine Woche früher als geplant zurück, weil sie vom schwarzen Freitag mit den vielen Toten und Schwerverletzten und dem Zwischenfall mit dem Stromausfall erfahren hatten, als sie Dagmar, die deutsche Studentin, die hier ihr dreimonatiges, klinisches Praktikum abgeleistet hatte, in Lübeck besuchten. Da kürzten sie den Deutschlandbesuch ab, um an den Ort zurückzukehren, wo sie nach den Ereignissen wie diesen hingehörten. Sie erzählten von den Interviews, die sie mit den jungen Ärzten in verschiedenen, westdeutschen Städten geführt hatten. Sie waren durch die Gespräche auf Kollegen und Kolleginnen gestossen, die interessiert und geeignet erschienen und ihr Kommen nach Oshakati zugesagt hatten. Dr. Witthuhn, der ärztliche Direktor, hatte eine amüsante Geschichte zu erzählen: Am deutsch-deutschen Grenzübergang von Ostberlin nach Westberlin schaute der ostdeutsche Grenzkontrolleur mit ostdeutschem Grenzkontrollblick ins Auto, verlangte im sächsischen Dialekt nach den Durchreisedokumenten, sah das Gesicht von Dr. Nestor und sagte erstaunt, dass er so ein schwarzes Gesicht noch nicht gesehen hätte. Dr. Nestor, dem Dr. Witthuhn die deutsch-deutsche Grenzbemerkung aus dem Sächsischen ins Englische übersetzte, lachte und gab dem erstaunten Grenzer recht, als er sagte, dass er auch zum ersten Mal in Deutschland sei. Da lachte auch der Grenzer, sprach sein "nu nuu" und wünschte den beiden Afrikanern eine gute Fahrt. Sie hatten von etwa vierzig Bewerbern, die von den einhundertzweiunddreissig Briefschreibern in die engere Auswahl genommen wurden, fünfzehn ausgesucht, von denen dreizehn zusagten. So war ihr Deutschlandbesuch ein voller Erfolg, und Dr. Nestor schwärmte von der Schönheit und Sauberkeit der Städte, vom Fleiss und Leben der Menschen. Die Kleinanzeige im Deutschen Ärzteblatt hatte sich gelohnt.