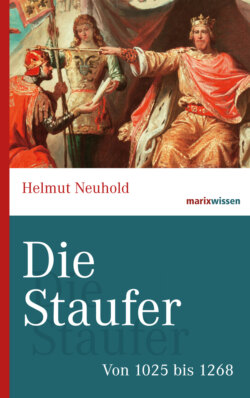Читать книгу Die Staufer - Helmut Neuhold - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EIN STAUFER WIRD KÖNIG
Оглавление»Lothar, der auf dem Rückmarsch (aus Italien) seinem Schwiegersohn die Markgrafschaft Tuszien übertrug, wurde bald von einer schweren Krankheit ergriffen. Wohl konnte er noch die Alpen überschreiten, am 4. XII. 1137 ist er aber in dem Dorf Breitenwang bei Reutte in Tirol gestorben. ... Als Gegner der salischen Partei war Lothar auf den Thron gekommen. Als König bog er aber in die vorgezeichnete Linie der deutschen Königspolitik ein und ist keineswegs, wie man gelegentlich gemeint hat, ein unselbständiger, von der Kirche abhängiger Herrscher gewesen.« (Gehardt 1970, S. 375)
Nachdem Lothar III., der zuletzt ein sehr gestörtes Verhältnis zu Papst Innozenz II. gehabt hatte, gestorben war, begann erneut ein Kampf um die Krone des Reiches. Wurde zunächst erwartet, dass der Schwiegersohn des verstorbenen Kaisers, der Welfe Heinrich der Stolze, seines Zeichens Herzog von Bayern und Sachsen, die größten Chancen bei der Wahl hatte, so entwickelten sich die Dinge rasch anders. Der Papst hatte den geschickten Kardinal Dietwin von Santa Rufina entsandt, der vom Erzbischof Albero von Trier unterstützt wurde. Die beiden setzten alles daran, dass ein anderer das Rennen machte. Zur Wahl des neuen Königs war eine Fürstenversammlung für den 22. Mai 1138 einberufen worden, doch schon vorher konnten die beiden Geistlichen einige Fürsten in Koblenz zusammenbringen. Diese wählten dann wunschgemäß am 7. März den Staufer Konrad zum König. Dieser wurde dann auch recht rasch am 13. März 1138 gekrönt. Kardinal Dietwin setzte ihm als Mann des Papstes die Krone aufs Haupt. Das sollte für die weitere Zukunft Konrads III. bedeutende Folgen haben und ihn in den Augen vieler zum »Pfaffenkönig« stempeln. Diese Art der Königserhebung war eigentlich ein Bruch des herkömmlichen Rechts, wurde jedoch nach und nach von den meisten Fürsten des Reiches akzeptiert. Als Konrad III. zu Pfingsten 1138 einen allgemeinen Reichstag in Bamberg abhielt, kamen viele bedeutende Herren des geistlichen und weltlichen Standes, um ihm zu huldigen.
Der neue König war sich der großen Gefahr bewusst, die von dem Welfen Heinrich dem Stolzen ausging, der ihm auch bezüglich seiner Hausmacht überlegen war. Deshalb verhängte er im Juli 1138 in Würzburg die Reichsacht über den Welfen und entzog ihm seine Herzogtümer. Während der Askanier Albrecht der Bär mit Sachsen belehnt wurde, erhielt Konrads Halbbruder, der Babenberger Leopold IV., das Land Bayern. Das führte natürlich dazu, dass der Konflikt mit den Welfen einen neuen Höhepunkt erreichte. Albrecht der Bär konnte sich in Sachsen als Herzog nicht behaupten, und ein von Konrad III. durchgeführter Kriegszug gegen die Welfen endete mit 1139 mit einem für ihn schmählichen Waffenstillstand.
Der relativ überraschende Tod Heinrichs des Stolzen am 20. Oktober 1139 brachte nur vorübergehend für Konrad III. eine Entlastung, da die Kaiserwitwe Richenza gemeinsam mit einem großen Adelsaufgebot nun die Rechte Heinrichs des Löwen, der ihr noch minderjähriger Enkel war, verfocht. Die Welfen wollten ihr Herzland Sachsen unter keinen Bedingungen aufgeben. Auch in Bayern kam es zu Kampfhandlungen, als Welf VI. sich in einem Gefecht bei Valley am 13. August 1140 gegen Leopold IV. durchsetzen konnte. Doch Konrad III. schaffte es, zumindest hier durch sein Eingreifen die Situation unter Kontrolle bringen. Er besiegte den Welfen am 21. Dezember 1140 bei der Burg Weinsheim.
Konrad III. sah im Geschlecht der Babenberger, das schon lange die Markgrafen von Österreich stellte, eine bedeutende Stütze seiner Herrschaft. So erhielt auch der Babenberger Heinrich Jasomirgott 1140 die Pfalzgrafschaft bei Rhein und somit eine der wichtigsten Positionen im Reich überhaupt. Nach dem Tod Leopolds IV. wurde Heinrich Jasomirgott schließlich zum Herzog von Bayern erhoben. Außerdem vermählte ihn der König 1146 mit der byzantinischen Prinzessin Theodora Komnena, immerhin einer Nichte Kaiser Manuels. Die beiden Babenberger Otto und Konrad erhielten zudem bedeutende geistliche Ämter. Während Konrad 1148 zum Bischof von Passau geweiht wurde, war der wohl bedeutendere Otto bereits seit 10 Jahren Bischof von Freising, wo er eine rege Tätigkeit als Geschichtsschreiber entfaltete und viele Werke produzierte, die heute noch als wichtige historische Quellen angesehen werden.
Die Königsherrschaft des ersten Staufers auf dem Königsthron konnte in den deutschen Territorien regional unterschiedlich stark durchgesetzt werden. Während er sicherlich am Rhein und in Ostfranken als Kernregionen sehr stark war, blieb Sachsen wie später noch so oft in der staufischen Geschichte ziemlich königsfern. Konrad III. konnte während seiner gesamten Herrschaft hier nicht Fuß fassen. Würzburg, Nürnberg, Regensburg, Frankfurt, Speyer und Bamberg wurden die wichtigsten Stützpunkte des Staufers, die der König während seiner Herrschaft immer wieder aufsuchte. In Konrads engstem Umkreis befanden sich einige wenige Fürsten, denen er auch sein Vertrauen schenkte. Dazu gehörten der Erzbischof von Köln, die Bischöfe von Würzburg und Worms, die Babenberger Heinrich Jasomirgott und Otto von Freising, der Königsbruder Friedrich und Albrecht der Bär. Bei seiner Verwaltung setzte der Staufer auf verschiedene Ministerialiengeschlechter, wobei der Ministeriale Arnold von Selenhofen schließlich auch zum Reichskanzler ernannt wurde.
Das Verhältnis zur Kirche des als »Pfaffenkönig« übel beleumdeten Staufers wurde immer wieder kritisch betrachtet und dokumentiert. Konrad III. fühlte sich dem Wormser Konkordat von 1122 verpflichtet und trachtete danach, zu den zu seiner Zeit oft wechselnden Päpsten immer gute Beziehungen zu haben. Er unternahm auch im Gegensatz zu seinem Vorgänger Lothar keinen Versuch, die königlichen Rechte bezüglich der Reichskirche wieder zurückzugewinnen. Da er natürlich Interesse daran hatte, dass bei der Neubesetzung der Bischofssitze ihm genehme Kandidaten zum Zug kamen, versuchte er, Einfluss über die Wahlgremien und Domkapitel zu nehmen, indem er dort auch seine Gefolgsleute unterbrachte. Damit verstieß er nicht gegen die Bestimmungen des Konkordats, konnte aber dennoch einen gewissen Einfluss ausüben. Konrad III. soll sich auch als gleichrangig mit dem Papst betrachtet haben. In der Verwaltung und Diplomatie setzte der Staufer oft auf Geistliche und übergab einigen davon auch politische Ämter in Italien. Konrad III. förderte die Kirche ebenso durch die Übertragung von Reichsbesitzungen und königlichen Schutzurkunden. Diese freundschaftliche und von manchen auch als »unterwürfig« gesehene Politik gegenüber der Kirche führte zu mancher Kritik an dem ersten Stauferkönig.
Durch die Belehnung des jungen Welfen Heinrich, des späteren »Löwen«, mit dem Herzogtum Sachsen, wich Konrad III. aus pragmatischen Gründen davon ab, freigewordene Ämter und Würden durch seine nächsten Verwandten zu besetzen. Daneben benutzte er auch das Mittel der Verschwägerung. So wurde eine seiner Halbschwestern durch Heirat Herzogin von Böhmen, auch der byzantinische Kaiser Manuel heiratete eine Schwester der Königin, und seinen Sohn Heinrich verlobte er mit einer der Töchter des ungarischen Königs Bela. Doch auch diese Maßnahmen konnten den allgemeinen Frieden nicht garantieren. So sah sich Konrad III. genötigt, im Jahre 1142 einen Kriegszug gegen die Böhmen zu unternehmen, da diese seinen Schwager Herzog Wladislaw vertrieben hatten. Dieses Unternehmen verlief erfolgreich, und der Staufer konnte seinen Schwager in recht kurzer Zeit wieder restituieren.
Schon im Hinblick auf die Bedrohung seiner Herrschaft durch die mächtigen Welfen sah sich Konrad III. bemüht, seine Position im Reich durch eine gut organisierte Familienpolitik zu verstärken. Seine eigene Machtbasis schien ihm nicht stark genug, da er neben seinem Eigengut in Schwaben und Franken nur das Elsass und Schwaben im Besitz seines Bruders, sowie das Krongut als Rückhalt vorzuweisen hatte. Deshalb verheiratete der Staufer 1139 seine Nichte Judith mit Herzog Matthäus I. von Oberlothringen. Außerdem vergab er im gleichen Jahr das Herzogtum Niederlothringen an Gottfried II. von Löwen, der den Staufern ebenfalls durch Heirat verbunden war. Konrads Halbbruder, der Babenberger Heinrich, erhielt zudem 1140 die Pfalzgrafschaft bei Rhein, die später Graf Hermann von Stahleck übergeben wurde, nachdem Heinrich im Oktober 1141 die Markgrafschaft Österreich geerbt hatte. Überhaupt erwies sich die Verwandtschaft mit den Babenbergern als nützlich, da mittels kluger Heiratspolitik engere Bindungen zu Polen und Böhmen erreicht werden konnten. Diese hielten die gefürchteten Welfen zusätzlich in Schach.
Der Reichstag von Frankfurt im Mai 1142 brachte Heinrich dem Löwen das Herzogtum Sachsen gegen den Verzicht auf Bayern. Dieser scheinbar dauerhafte Ausgleich mit den Welfen wurde durch die Verheiratung der Herzogswitwe Gertrud mit dem Babenberger Heinrich besiegelt. Der Babenberger erhielt dann auch im Januar 1143 die Belehnung mit Bayern. Doch schon bald zeigte sich, dass mit den Welfen nicht so leicht Frieden zu schließen war. Gertrud starb schon nach einigen Monaten und Welf VI. wollte den Verzicht seines Neffen Heinrich des Löwen auf Bayern nicht anerkennen. Welf verbündete sich deshalb mit König Roger II. von Sizilien und dem ungarischen König Geza II. Konrad III. war deshalb an besseren Beziehungen zu den Byzantinern gelegen, die die Normannen in Sizilien in Schach halten konnten. Der Staufer leitete deshalb die Verheiratung seiner Schwägerin Bertha von Sulzbach mit Manuel I. Komnenos in die Wege, welche dann aber erst 1146 erfolgte.
Überhaupt entwickelte Konrad III. seit 1142 vielseitige außenpolitische Bestrebungen, die mehr oder weniger glücklich verliefen. Dabei hatte er natürlich die ganze Zeit seinen erhofften Romzug im Auge, um auch noch die Kaiserwürde zu erlangen. Doch die Lage in Deutschland wollte sich einfach nicht wirklich beruhigen, und in Rom kam es zu Auseinandersetzungen zwischen großen Teilen der städtischen Bevölkerung und dem Papst. Das schienen keine guten Vorzeichen für einen erfolgreichen Zug des deutschen Königs in die Heilige Stadt. Konrad III. scheute schon vor seiner allfälligen Kaiserkrönung nicht davor zurück, sich als »Augustus« zu bezeichnen.
Von Seiten der Kurie aus gab es ab 1145 verstärkte Bemühungen, den Staufer zu einem Romzug zu motivieren. Immerhin wurde Kaiser Heinrich II. am 4. März 1146 heiliggesprochen, was sicher durch die Anwesenheit Konrads III. mehr Glanz erhalten hätte. Doch der in vielen Dingen recht biedere Staufer bemühte sich vorerst weiterhin, seine und die Macht seiner Familie auszubauen und abzusichern. Er setzte dabei besonders auf die ihm wohlgesonnene Reichskirche, die aufstrebenden Städte und die Reichsministerialen. Es gab zu jener Zeit einen bedeutenden inneren Landesausbau, die Rodung großer Gebiete und auch einige für Konrad III. günstige Gelegenheiten zur Installierung neuer Würdenträger. Andererseits misslangen Unternehmungen, wie das Eingreifen des Königs in die inneren Wirren in Polen im Sommer 1146, was mit einer schweren diplomatischen Niederlage endete.
Konrad III. ergriff nach dem Tod des Herzogs Boleslaw III. Partei in einem polnischen Erbteilungsstreit, da der dabei als Großherzog vorgesehene, aber vertriebene Wladislaw mit einer seiner Halbschwestern verheiratet war. Der deutsche König beschloss nun, diesem Wladislaw bei der Durchsetzung seiner Ansprüche zu helfen. Als Konrad III. mit seinem Heer in Polen einmarschierte, musste er rasch feststellen, dass er seine Gegner unterschätzt hatte. Unter Vermeidung einer offenen Feldschlacht bereiteten ihm die Polen jede Menge Schwierigkeiten und unterbanden den deutschen Nachschub. Da seine Männer hungerten und nicht in bester Stimmung waren, schien ein möglichst ehrenvoller Rückzug angemessen. Es gab in der Folge Verhandlungen, bei denen Konrad III. nicht die beste Figur machte und sich mit der Zusicherung des Erscheinens des von ihm abgelehnten polnischen Herzogs Boleslaw IV. am nächsten deutschen Hoftag und der Stellung einer Geisel vorerst zufriedenstellen ließ, ehe er abmarschierte. Doch wie wohl nicht anders zu erwarten, erschien der abtrünnige Pole nicht am Hoftag, und Konrad III. blieb auf seiner Geisel und seinem Schwager Wladislaw sitzen, dem er nun auch ein standesgemäßes Asyl gewähren musste. Das polnische Problem konnte nie gelöst werden, da sich der Stauferkönig nun mit einem ganz anderen auseinandersetzen musste und eine ungleich schwerere Niederlage auf ihn wartete.
Inzwischen war es für die Streiter Christi im von ihnen besetzten Heiligen Land alles andere als gut verlaufen. Als die Grafschaft Edessa wieder an die Krieger Allahs fiel, erging ein Aufruf zu einem neuen Kreuzzug. Der mächtige Geistliche Bernhard von Clairvaux überredete König Ludwig VII. von Frankreich dazu, das Kreuz zu nehmen. War ursprünglich nur geplant, dass der Franzose einen Kreuzzug unternehmen würde, so entwickelte Bernhard von Clairvaux bald auch großen Eifer, den deutschen König für die Idee zu gewinnen. Der König der Deutschen könnte doch bei einer solchen Unternehmung zum Wohle der Christenheit nicht hinter dem König der Franzosen zurückstehen, wurde argumentiert.
Konrad III. fühlte sich dadurch unter Druck gesetzt, denn er musste natürlich seine Bedeutung als künftiger römischer Kaiser unter Beweis stellen. Der Konflikt mit den Welfen stellte aber eine große Gefahr für seine Herrschaft dar, sollte er wirklich an dem Kreuzzug teilnehmen. Doch Bernhard von Clairvaux schaffte dieses Problem schließlich aus der Welt, als er sich nach einer Unterredung mit Konrad III. anschließend mit Welf VI. traf, von dem er das Versprechen einer Art von »Waffenstillstand« während des Kreuzzuges erhielt. Der wortgewaltige Geistliche stieß dann wieder zu König Konrad III., der zu Weihnachten in Speyer einen Reichstag abhielt. Nachdem Bernhard am 27. Dezember 1146 eine aufrüttelnde Rede gehalten hatte, nahm der Staufer genauso wie viele der versammelten Fürsten das Kreuz.
Dieses von vielen als großes Wunder betrachtete Ereignis war allerdings gründlich vorbereitet worden, und schon bald verpflichteten sich auch Heinrich der Löwe und seine sächsische Gefolgschaft zur Teilnahme an der Kreuzfahrt. Beim Reichstag von Frankfurt im März 1147 wurden schließlich alle wichtigen mit dem Zug ins Heilige Land verbundenen Fragen geklärt. Konrad III. konnte einen allgemeinen Reichsfrieden verkünden und die Wahl seines zehn Jahre alten Sohnes Heinrich zum König erreichen. Der junge Mann sollte mit Hilfe eines Regentschaftsrates während seiner Abwesenheit die Verwaltung des Reiches übernehmen. Es wurde auch beschlossen, dass der Anspruch Heinrichs des Löwen auf Bayern nicht abgewiesen, aber bis zur Rückkehr vom Kreuzzug vertagt würde. Außerdem gestand man den Sachsen einen eher regionalen Kreuzzug gegen die heidnischen Slawenstämme im ostelbischen Gebiet zu. Nachdem sein Sohn Ende März 1147 in Aachen gekrönt worden war, begann König Konrad III. Ende Mai von Regensburg aus seinen Marsch ins Heilige Land. Das ganze Unternehmen sollte ein Fiasko werden.
Die Planung sah vor, dass die Deutschen etwas früher losmarschieren und die Franzosen in einem gewissen Abstand folgen sollten. Nachdem er die Leitha überschritten hatte, wurde der König mit den ungarischen Problemen konfrontiert. Konrad III. bestrafte König Geisa für den Krieg gegen seinen Halbbruder Heinrich durch die Konfiskation großer Geldsummen. Das Heer der deutschen Kreuzfahrer, zu dem auch ein riesiger Tross von Unbewaffneten, Frauen und sogar Kindern gehörte, erreichte in der Folge ohne große Schwierigkeiten Konstantinopel, wo es auf die französischen Kreuzfahrer warten sollte, die unter der Führung König Ludwigs VII. nachkommen sollten. Doch der byzantinische Kaiser, der ein doppeltes Spiel spielte, überredete Konrad III., alleine nach Kleinasien überzusetzen, ohne ihm ortskundige Führer zur Verfügung zu stellen. Womit das Unheil schon vorprogrammiert war. Zudem war der Großteil der als Heer bezeichneten ziemlich inhomogenen Menschenmasse völlig disziplinlos.
Bei Nicäa kam man dann auch noch auf die »glorreiche« Idee, das Heer zu teilen. Der deutsche König zog mit dem Hauptheer weiter durch Kleinasien, während die Pilger und Unbewaffneten ohne große militärische Bedeckung unter der Führung Ottos von Freising entlang der Küste marschieren sollten. Bei Dorylaion wurden die deutschen Ritter am 25. Oktober 1147 in eine plumpe Falle gelockt, was zum Untergang fast der gesamten Kavallerie führte. Konrad III., der wieder einmal ein gewisses militärisches Unvermögen bewiesen hatte, zog sich mit dem Rest seiner Truppe, die nun vor allem aus Fußvolk bestand, vorerst geordnet zurück. Da die Seldschuken sie aber ständig bedrängten und demoralisierten, artete das Unternehmen bald in eine panikartige Flucht aus. Der deutsche König erreichte Anfang November mit etwa 2.500 erschöpften Überlebenden die Stadt Nicäa und flüchtete sich hinter die sicheren Mauern. Konrad III. selbst war wie viele seiner ihm verbliebenen Leute mehrfach verwundet worden. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde die Kolonne unter Otto von Freising auch angegriffen, und es kam erneut zu einem fürchterlichen Massaker, dem die meisten Christen zum Opfer fielen.
Nachdem er und seine Leute sich einigermaßen erholt hatten, stieß Konrad III. zu den inzwischen angekommenen Franzosen, und man marschierte gemeinsam die Küste entlang. Auch der französische König wurde der Situation nicht Herr und immer mehr seiner Männer wurden Opfer der häufig stattfindenden Angriffe der Seldschuken. Außerdem waren das Wetter und die Versorgungslage extrem schlecht, was zu vielen Krankheiten führte. Konrad III. blieb dieses Mal die Teilnahme am völligen Zusammenbruch einer christlichen Streitmacht erspart, da er bereits in Ephesus schwer erkrankte und nach Konstantinopel zurück transportiert wurde. Letztlich erreichten nur sehr wenige der ausgezogenen deutschen und französischen Ritter Palästina.
Als sich der deutsche König wieder besser fühlte, fuhr er mit dem Schiff im April 1148 nach Akkon und besuchte von dort aus Jerusalem. In der Heiligen Stadt bereitete König Balduin III. dem deutschen König einen glänzenden Empfang und überredete ihn, die Eroberung von Edessa nicht mehr als Priorität zu betrachten und im Juli einen Kriegszug gegen Damaskus zu unternehmen. Der französische König Ludwig, der sich inzwischen unter schwersten Verlusten nach Tyrus durchgeschlagen hatte, konnte auch für diesen Plan gewonnen werden. Mitte Juli brach also ein vereintes und durch neue Zuzüge recht zahlreiches Christenheer, das angeblich mehr als 50.000 Mann umfasste, von Tiberias in Richtung Damaskus auf. Die mittelalterlichen Zahlenangaben sind hier allerdings mit großer Vorsicht zu genießen, denn bei der eigenen Stärke und den Verlusten des Gegners wurde meistens maßlos übertrieben. Auch wenn sich die Streitmacht der Christen durch Seuchen, Fahnenflucht und zuletzt auch Kämpfe laufend verringerte, so erreichten genügend die Stadt, die als sehr volkreich galt, und griffen ungestüm an.
Die Kämpfe um Damaskus erwiesen sich wie so oft bei den Kreuzzügen als sehr blutig, und Konrad III. zeigte große Tapferkeit und einen Kampfeswillen, der angeblich seine moslemischen Gegner in Angst und Schrecken versetzte. Die Christen konnten vor allem dank des rücksichtslosen Einsatzes der deutschen Ritter bei den moslemischen Verteidigern die Hoffnung auf weiteren Widerstand vertreiben. Aber als die Stadt bereits so gut wie sturmreif bzw. reif für die Kapitulation war, befiel die Christen eine seltsame Starre, und Konrad III. lieferte erneut ein Beispiel mangelnder Führungseigenschaften. Inzwischen drehte sich das Intrigenkarussel in Jerusalem, und vielen Kreuzrittern stieß die Dominanz der Deutschen übel auf. Außerdem befürchtete man das Eingreifen weiterer moslemischer Machthaber, die Jerusalem direkt bedrohen konnten.
König Konrad und König Ludwig ließen sich überreden, die Stadt weiter zu belagern und keinen Sturmangriff zu unternehmen. Nun kam der Mangel an Wasser und Nahrungsmitteln für Mensch und Tier immer mehr zum Tragen, die moslemischen Verteidiger zeigten wieder neuen Mut und besetzten sogar Stellungen der Belagerer. Konrad III. beschloss nach einigen Tagen schließlich die Aufgabe des Unternehmens und der französische König folgte seinem Beispiel. Ein weiteres kriegerisches Unternehmen des Stauferkönigs war damit gescheitert, und auch die Eroberung Edessas musste ad acta gelegt werden. Konrad III. kehrte schließlich dem Heiligen Land den Rücken und begab sich ins byzantinische Imperium.
Später behauptete der gescheiterte Staufer, er und sein Heer seien niemals von den Ungläubigen besiegt worden, sondern von Hunger und Krankheit. Doch man lastete ihm in der europäischen Öffentlichkeit weitgehend die Schuld an. Neben den riesigen Verlusten an Menschenleben wurde beklagt, dass er nichts »für die Erhabenheit des kaiserlichen und deutschen Namens« erreicht hätte. Viele Fürsten kehrten dem erfolglosen Herrscher nun den Rücken, und es wurde einsamer um König Konrad III.
In Saloniki schloss er schließlich Ende 1148 einen Vertrag mit dem byzantinischen Kaiser Emanuel I., der sich gegen Roger II. von Sizilien richtete, der mit dem schon sehr frühzeitig vom Kreuzzug desertierten Welf VI. ein Bündnis eingegangen war. Die alten Konflikte mit den Welfen waren also wieder aktuell geworden. Die Nachrichten aus seinem Reich waren für Konrad III. auch nicht allzu erfreulich, denn der kleine König Heinrich hatte sich als ziemlich machtlos erwiesen. Überall waren Fehden und Konflikte ausgebrochen, die auch die Macht der Staufer bedrohten.
»So reihte sich Kampf an Kampf, Niederlage an Niederlage. Daneben winkte immer noch vergebens die Kaiserkrone. Von Jahr zu Jahr hoffte Konrad, Zeit zu finden, um über die Alpen zu steigen. Immer neue Kämpfe schoben sich vor die geplante Romfahrt.« (Selchow 1928, S. 201)
Als Konrad III. im Mai 1149 nach Deutschland zurückkehrte, war er ziemlich gelähmt. Der schlimme Ausgang des Kreuzzuges hatte seinem Ansehen schwer geschadet, und außerdem war seine Gesundheit nicht die beste. Vorerst konnte er nicht wirklich aktiv werden. Er musste sein Vorgehen gegen Sizilien und sein geplantes Eingreifen in die chaotischen Verhältnisse in Rom, bei denen sich der Papst in schwerer Bedrängnis befand, aufschieben.
Die Hauptgefahr schienen vorerst die Welfen zu sein, die nun massiv ihren Machtanspruch anmeldeten und durch ein Bündnis mit König Roger von Sizilien zu viel Geld gekommen waren. Graf Welf VI. hatte schon frühzeitig Syrien verlassen und begonnen, die Besitzungen des Königs anzugreifen und auszuplündern, während er gleichzeitig Verbündete unter den deutschen Fürsten suchte. Welf VI. konnte im Februar 1150 bei Flochberg geschlagen und zum Frieden genötigt werden, aber Heinrich der Löwe, der in den mächtigen Zähringern Verbündete gefunden hatte, erhob erneut energisch seinen Anspruch auf Bayern und marschierte sogar in den Süden Deutschlands. Konrad III. glaubte, er könne das Problem durch Verhandlungen auf mehreren von ihm einberufenen Hof- und Reichstagen lösen, doch der Welfe erschien einfach nicht. Als der staufische König schließlich im Vertrauen auf den sächsischen Adel, der zu einem großen Teil welfenfeindlich war, auf eine militärische Lösung setzte und gegen Goslar und Braunschweig marschierte, scheiterte er wieder einmal. Heinrich der Löwe erschien vor Ort und konnte sich behaupten. Konrad III. räumte das Feld und überließ den Widerstand gegen den Welfen dem sächsischen Adel.
»So befand sich der König gegen Ende seiner Regierung auf demselben Punkt wie zu Anfang derselben. Seine Bestrebungen waren gescheitert. ... Es fehlte ihm die Energie des Willens. Was er begonnen hatte, führte er oft nicht zu Ende; er brach ab, wenn sich Hindernisse unerwarteter Art zeigten, oder wenn er den Schein eines Erfolges aufweisen konnte.« (Friedrich von Raumer)
Trotz aller ungelösten Probleme entschloss sich Konrad III. dazu, nach Italien und insbesondere Rom zu marschieren. Dabei wollte er einerseits endlich die Kaiserkrone erhalten und zweitens König Roger von Sizilien in seine Schranken weisen. Zu diesem Zweck wurden Gesandte in wichtige italienische Städte und zum Papst geschickt, sie sollten den Italienzug des Staufers vorbereiten. Doch es sollte alles anders kommen.
Ziemlich ernüchtert vom misslungenen Kreuzzug und seinem persönlichen Scheitern, sah er auch die Rolle der Kirche in einem anderen Licht. Man warf Konrad III., dem »Pfaffenkönig« vor, dass unter seiner Herrschaft die Macht und der Einfluss der Kirche im Reich den Höhepunkt erreicht hätten. Der Staufer versuchte nun, spät aber doch, den Einfluss der Kirche zurückzudrängen und war gegenüber der Kurie »voll ernster Strenge«. Der Abt Wibald von Stablo, der bisher ziemlich erfolgreich die Interessen Roms am Hofe König Konrads III. vertreten hatte, schrieb erzürnt nach Rom: »Jene, die als treulos bekannt sind, werden mit Reichtümern und Ehren überhäuft, ich aber wie ein Fremdling behandelt.« (Lehmann 1978, S. 41)
Seit seiner Teilnahme am gescheiterten Kreuzzug war Konrad III. auch ein schwer kranker Mann. Es gab und gibt verschiedene Vermutungen, woran er gelitten haben könnte, aber es dürfte sich wohl um die Malaria gehandelt haben. Der kranke König musste dennoch unermüdlich in seinem »Reich ohne Hauptstadt« genauso wie seine Vorgänger und Nachfolger herumreiten. Der König musste in Bewegung bleiben und gesehen werden, das war eine wichtige Grundlage der Herrschaft des ersten Stauferkönigs genauso wie vieler seiner Vorgänger und Nachfolger.
Manchmal ging es für Konrad III. dann doch nicht mehr und er verschwand für einige Zeit von der Bildfläche, von heftigen Fieberschüben auf das ungezieferverseuchte Lager geworfen: »Denn schwere Krankheit, von Gott zu Unserer Seele Besserung geschickt, hielt Uns fest. Sie quälte Uns fast sechs Monate lang so sehr, dass Wir unnütz waren für alle notwendigen Geschäfte.« Das führte in einer Gesellschaft, in welcher der persönliche Kontakt viel wichtiger war als institutionelle Bindungen, rasch zu Problemen: »Die günstige Gelegenheit nährte den Frevelmut etlicher Leute und leistete Umtrieben Vorschub, die auszulöschen und zu bezähmen Wir mit aller Wachsamkeit bestrebt waren, als Uns des Himmels Gnade noch mit Gesundheit beschenkte.« (Goez 2010, S. 271)
Der Staufer bemerkte Anfang des Jahres 1152, dass es mit ihm zu Ende gehen würde. Damit entstand für ihn auch das Problem seiner Nachfolge. Sein Sohn und Mitkönig Heinrich war schon 1150 gestorben, und sein zweitgeborener Sohn Friedrich erst sechs Jahre alt. Deshalb entschloss sich der Sterbende, seinen Neffen, Herzog Friedrich III. von Schwaben, zu seinem Nachfolger zu erwählen, und übergab ihm die Regierungsinsignien. Konrad III. starb am 15. Februar 1152 in Bamberg, ohne dass er die von ihm so sehr angestrebte Kaiserwürde erlangt hätte.
Der erste staufische König war niemals das Odium losgeworden, ein »Pfaffenkönig« zu sein, und er hatte es auch niemals geschafft, die Probleme der Innen- und Außenpolitik wirklich zu meistern. Ob seine oft schwankende Politik dabei ein wesentliches Problem darstellte oder der verzweifelte Versuch war, ein Rezept für die Lösung der Probleme zu finden, muss dahingestellt bleiben. In seiner unmittelbaren Umgebung ging Konrad III. jedoch sehr methodisch vor und er konnte neben dem Ausbau der staufischen Hausmacht, den er gemeinsam mit seinem Bruder betrieb, auch einige königliche Institutionen verbessern bzw. stärken. Er sammelte einen Stab von fähigen und erprobten Ratgebern und Helfern und hinterließ diesen auch seinem Nachfolger. Die unter Lothar III. darnieder liegenden Institutionen wie Reichskanzlei und Hofkapelle wurden unter Konrad III. wiederbelebt und der neuen Entwicklung angepasst.
Diese Dinge fanden jedoch wenig Resonanz in der Bevölkerung des Reiches. Man sah in der Person des staufischen Königs immer nur dessen politische Erfolgslosigkeit. Ein Chronist aus Köln ärgerte sich beim Tod Konrads III.: »Die Zeiten dieses Königs waren ziemlich traurig. Unter ihm herrschten schwankendes Wetter, dauernde Hungersnot, wechselnder Kriegslärm. Er war ja ein tapferer Soldat und im Königsamt auch eifrig genug, aber durch eine Art von Glücklosigkeit kam unter ihm das Gemeinleben ins Wanken.« (Borst 1981, S. 17)
Auch wenn man Konrad III. niemals zu den großen Angehörigen des staufischen Hauses und auch nicht zu den großen Königen des deutschen Mittelalters zählte, so war es doch so, dass gerade er die Voraussetzungen für die erfolgreiche Politik seiner ihn bei weitem überstrahlenden Nachfolger schuf. Wenn später Historiker schrieben: »Manchem deutschen König war manches missglückt, keinem, außer Konrad III., alles.« (Selchow 1928, S. 204), dann stimmt das eigentlich nicht. Ihm glückte immerhin die Berufung seines best möglichen Nachfolgers.